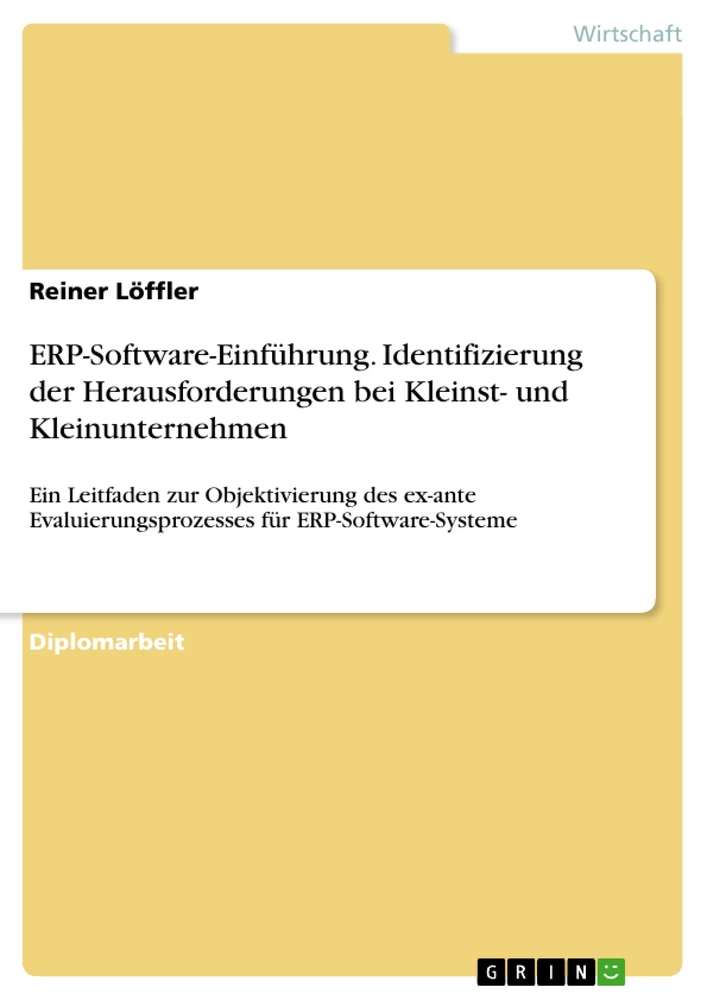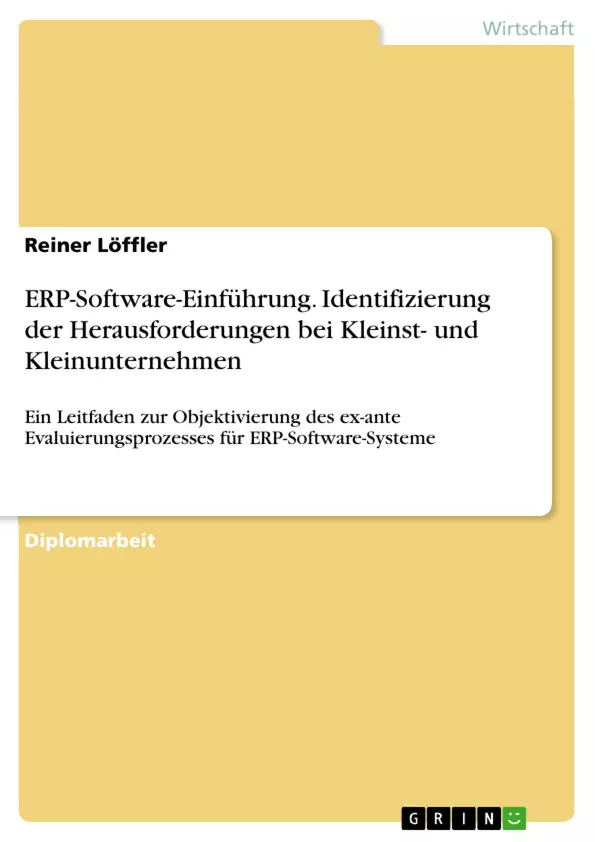Produkte oder Dienstleistungen auf dem Markt erfolgreich anbieten zu können, wird aufgrund steigender Arbeitsteilung und Spezialisierung immer komplexer. Der ebenso hinzukommende Trend nach stärker individualisierten Erzeugnissen bzw. Dienstleistungen lassen den Abstimmungsbedarf zwischen dem Konsument und der gesamten „Supply Chain“ auf ein Rekordniveau steigen (Sharma 2004, S. 1).
Diese Tatsachen und die gleichzeitige Erfordernis nach schnellen Lieferzeiten sind ohne eine enge Verzahnung der Prozesse des eigenen Unternehmens, welche der Lieferanten und denen der Kunden nicht zu realisieren. Eine schnelle Bereitstellung setzt voraus, dass Bearbeitungszeiten in allen ab-laufenden Prozessen gesenkt und die Effizienz und Effektivität auf ein Höchstmaß angehoben werden. Dazu benötigen die Unternehmen ein effizientes Planungs- und Kontrollsystem, welches die gesamten Prozesse in der Wertschöpfungskette optimal zu koordinieren hilft.
Das Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) ist ein strategisches Soft-ware-Werkzeug, welches es den Unternehmen ermöglicht, Prozesse äußerst gestrafft, bei gleichzeitig maximaler Information- und Kostentransparenz, darzustellen. Die Einführung oder ein Wechsel einer solchen integrierten betriebswirtschaftlichen Standardsoftware stellt aber in der Praxis eine Herausforderung der eigenen Art dar. (Hesseler, Görtz 2008, S. 6–7) Gerade kleinere Unternehmen stoßen bei der Auswahl eines geeigneten Produkts an Grenzen, unter anderem wegen der Vielzahl von Angeboten in diesem Marktsegment (Hesseler, Görtz 2008, S. 51).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Motivation
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Begriffliche Abgrenzung
- 1.3.1 Enterprise Resource Planning (ERP) und ERP-Systeme
- 1.3.2 Kleinst- und Kleinunternehmen
- 1.4 Aufbau der Arbeit
- 2 ERP-Systeme als betriebswirtschaftliche Standardsoftware im Wandel
- 2.1 Überblick über die Marktsituation
- 2.2 Historische Entwicklung des Marktangebots
- 2.3 Einordnung von ERP-Systemen im Software-Spektrum
- 2.4 Der Funktionsumfang im Überblick
- 2.5 Typisierung des Nutzens
- 2.6 Typisierung von Herausforderungen und Risiken
- 2.7 Neuer Trend: On Demand ERP
- 2.7.1 Was ist On Demand
- 2.7.2 Unterschied On-Demand-Anwendungen zu Lizenz- bzw. Kaufmodellen
- 2.7.3 Aktueller On-Demand-Markt - Angebot und Nachfrage
- 3 Herausforderungen des Auswahlprozesses
- 3.1 Strukturierungsbedarf und Einsatz von Projektmanagement-Maßnahmen
- 3.2 Sicherstellung von Know-how durch Zusammenstellung des Projektteams
- 3.3 Einbringung von „Best Practice“ durch externe Berater
- 3.4 Ermittlung von Ist- und Soll-Prozessen mittels Zustandsanalyse
- 3.4.1 Ist-Analyse
- 3.4.2 Soll-Konzept
- 3.5 Schaffung der Bewertungsbasis durch Etablierung von Auswahlkriterien
- 3.6 Sammlung der Anforderungen an den Systemanbieter in Form des Lasten-/Pflichtenhefts
- 3.7 Das Durchlaufen der Systemauswahl
- 3.7.1 Marktanalyse als Sichtung des Markt-Angebots an ERP-Lösungen
- 3.7.2 Die Grobauswahl zur Eingrenzung des Angebotes auf relevante Lösungen
- 3.7.3 Die unternehmensspezifische Eignungsprüfung zur weiteren Eingrenzung
- 3.7.4 Die Feinauswahl als mehrinstrumentelle, iterative Entscheidungsphase
- 3.7.4.1 Nutzwertanalyse
- 3.7.4.2 Sensitivitätsanalyse
- 3.7.4.3 Selbstpräsentationen der Hersteller
- 3.7.4.4 Systemtests
- 3.8 Das Vertragsmanagement zur Absicherung der Umsetzung der Entscheidungskriterien
- 4 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Herausforderungen bei der Einführung von ERP-Software, insbesondere in Kleinst- und Kleinunternehmen. Ziel ist es, einen Leitfaden für einen objektiveren ex-ante Evaluierungsprozess zu entwickeln. Die Arbeit analysiert den Auswahlprozess und identifiziert kritische Erfolgsfaktoren.
- Herausforderungen der ERP-Software-Einführung in KMU
- Objektivierung des ex-ante Evaluierungsprozesses
- Analyse des Auswahlprozesses von ERP-Systemen
- Bedeutung von Projektmanagement und externem Know-how
- Entwicklung eines Leitfadens für KMU
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung und die Motivation für die Arbeit. Es werden die Zielsetzung definiert und zentrale Begriffe wie ERP-Systeme und Kleinst- und Kleinunternehmen abgegrenzt. Der Aufbau der Arbeit wird schliesslich skizziert, um dem Leser einen Überblick über den weiteren Verlauf zu geben.
2 ERP-Systeme als betriebswirtschaftliche Standardsoftware im Wandel: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Marktsituation von ERP-Systemen. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Marktes, die Einordnung der Systeme im Software-Spektrum und ihren Funktionsumfang. Der Nutzen von ERP-Systemen wird ebenso typisiert wie die damit verbundenen Herausforderungen und Risiken. Besonderes Augenmerk liegt auf dem aufkommenden Trend des On-Demand ERP und seinen Unterschieden zu traditionellen Lizenzmodellen.
3 Herausforderungen des Auswahlprozesses: Der Kern dieser Arbeit liegt in der detaillierten Analyse der Herausforderungen im Auswahlprozess von ERP-Systemen. Das Kapitel beschreibt den Bedarf an strukturierten Projektmanagement-Maßnahmen, die Sicherstellung des notwendigen Know-hows im Projektteam und die Einbindung externen Experten-Wissens ("Best Practice"). Es werden Methoden zur Ist- und Soll-Analyse vorgestellt, um die Anforderungen an ein neues System zu definieren. Die Etablierung von Auswahlkriterien und die Erstellung eines Lasten-/Pflichtenhefts werden ebenfalls ausführlich behandelt, gefolgt von einer detaillierten Beschreibung des Auswahlprozesses selbst – von der Marktanalyse bis hin zu Systemtests und der Vertragsgestaltung. Verschiedene Entscheidungsfindungsmethoden wie die Nutzwertanalyse und Sensitivitätsanalyse werden erläutert.
Schlüsselwörter
ERP-Systeme, Kleinstunternehmen, Kleinunternehmen, KMU, Software-Einführung, ex-ante Evaluierung, Auswahlprozess, Projektmanagement, Risiken, On-Demand ERP, Nutzwertanalyse, Sensitivitätsanalyse, Lastenheft, Pflichtenheft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Herausforderungen bei der Einführung von ERP-Software in KMU
Was ist der Hauptfokus dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen bei der Einführung von ERP-Software, insbesondere in Kleinst- und Kleinunternehmen (KMU). Ihr Ziel ist die Entwicklung eines Leitfadens für einen objektiveren ex-ante Evaluierungsprozess zur Auswahl geeigneter ERP-Systeme.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Herausforderungen der ERP-Software-Einführung in KMU, die Objektivierung des ex-ante Evaluierungsprozesses, die Analyse des Auswahlprozesses von ERP-Systemen, die Bedeutung von Projektmanagement und externem Know-how, sowie die Entwicklung eines konkreten Leitfadens für KMU.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt das Thema vor und definiert die Zielsetzung. Kapitel 2 bietet einen Überblick über ERP-Systeme, den Markt und den Trend zu On-Demand-Lösungen. Kapitel 3 bildet den Kern der Arbeit und analysiert detailliert die Herausforderungen des Auswahlprozesses, inklusive Methoden wie Ist-/Soll-Analyse, Nutzwertanalyse und Sensitivitätsanalyse. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden zur Analyse des Auswahlprozesses verwendet?
Die Arbeit beschreibt und analysiert verschiedene Methoden, die für einen erfolgreichen Auswahlprozess relevant sind. Dazu gehören die Ist- und Soll-Analyse zur Ermittlung der Unternehmensanforderungen, die Nutzwertanalyse und die Sensitivitätsanalyse zur Bewertung verschiedener ERP-Lösungen, sowie die Einbindung von Projektmanagement-Maßnahmen und externem Expertenwissen.
Welche Rolle spielen Projektmanagement und externes Know-how?
Die Arbeit betont die entscheidende Rolle von strukturierten Projektmanagement-Maßnahmen und dem Einbringen von "Best Practice" durch externe Berater für einen erfolgreichen ERP-Einführungsprozess. Die Sicherstellung des notwendigen Know-hows im Projektteam wird als Schlüsselfaktor für den Erfolg hervorgehoben.
Was ist On-Demand ERP und wie unterscheidet es sich von traditionellen Modellen?
Die Arbeit beleuchtet den aufkommenden Trend des On-Demand ERP und beschreibt seine Unterschiede zu traditionellen Lizenz- oder Kaufmodellen. Dieser Aspekt wird im Kontext der Marktsituation und den damit verbundenen Chancen und Herausforderungen diskutiert.
Welche Werkzeuge und Methoden werden zur Entscheidungsfindung im Auswahlprozess vorgestellt?
Die Arbeit erläutert verschiedene Entscheidungsfindungsmethoden, darunter die Nutzwertanalyse und die Sensitivitätsanalyse, um die Auswahl des optimalen ERP-Systems zu unterstützen. Zusätzlich werden Aspekte wie die Erstellung eines Lasten-/Pflichtenhefts und die Durchführung von Systemtests behandelt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich insbesondere an KMU, die vor der Einführung eines ERP-Systems stehen. Sie bietet einen Leitfaden und wertvolle Erkenntnisse für einen effizienten und objektiven Auswahlprozess. Auch für Berater und Projektmanager im IT-Bereich ist die Arbeit von Interesse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: ERP-Systeme, Kleinstunternehmen, Kleinunternehmen, KMU, Software-Einführung, ex-ante Evaluierung, Auswahlprozess, Projektmanagement, Risiken, On-Demand ERP, Nutzwertanalyse, Sensitivitätsanalyse, Lastenheft, Pflichtenheft.
- Citar trabajo
- Reiner Löffler (Autor), 2010, ERP-Software-Einführung. Identifizierung der Herausforderungen bei Kleinst- und Kleinunternehmen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168617