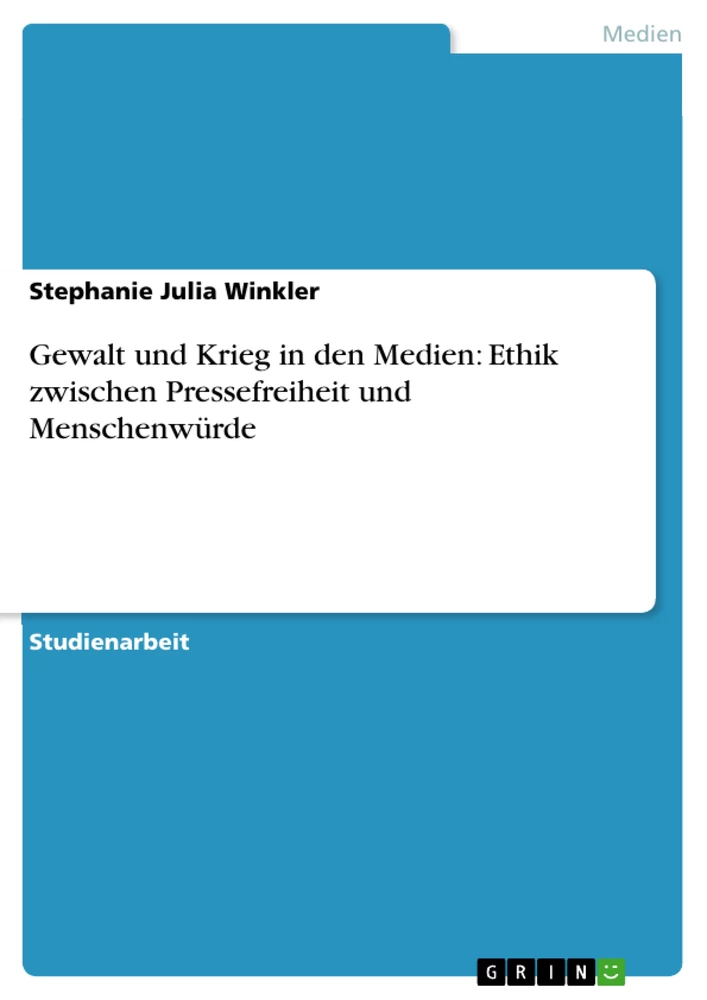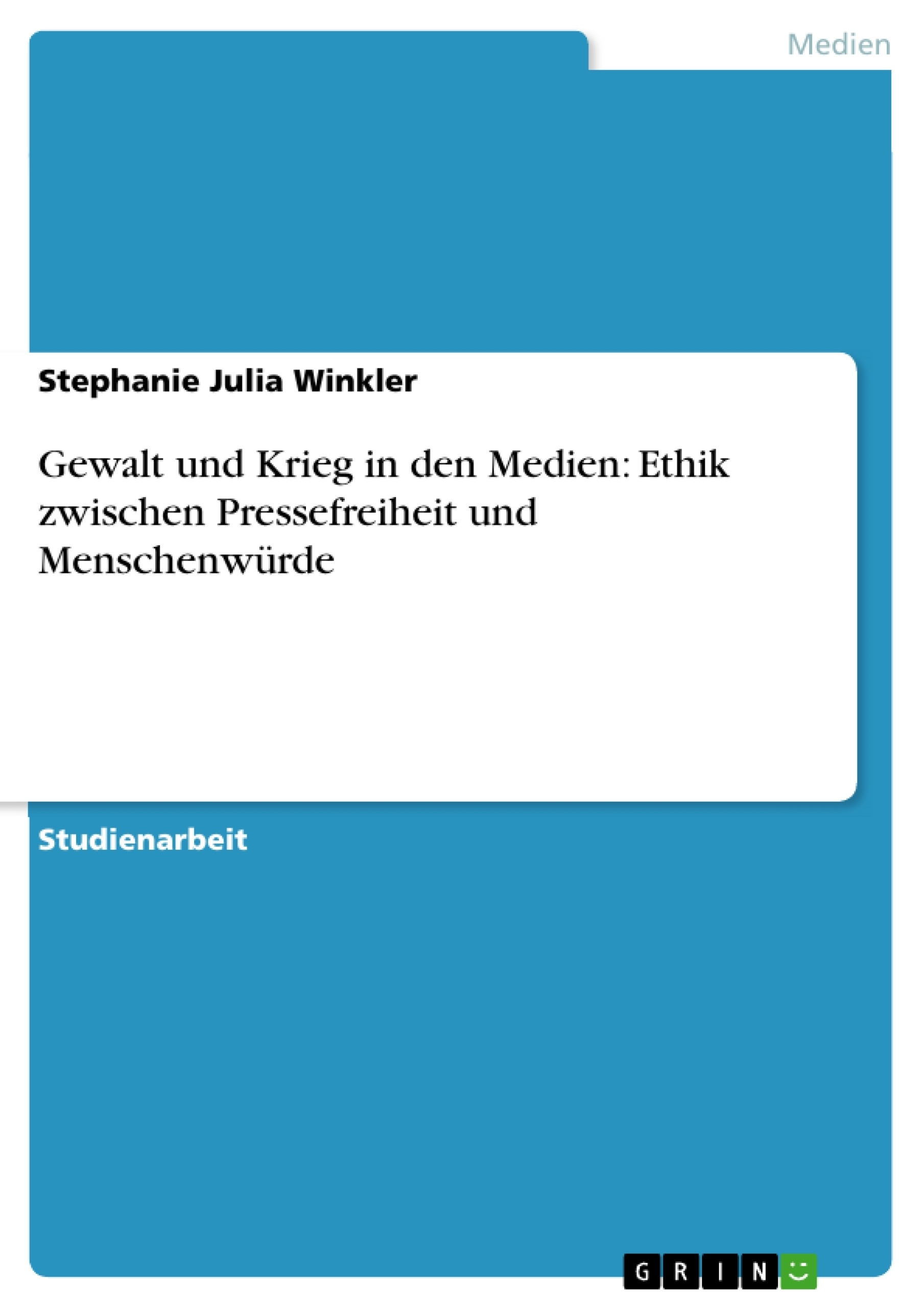,, Gewalt […] gibt es zuhauf und alltäglich auf der ganzen Erde, besonders Kriege und politisch-sozialer gewaltsamer Protest fallen auf[…]. […] Medien berichten darüber, indem sie sich auf Ereignisse beziehen. Aber sie tun dies zum Teil auch in spekulativer Absicht zur Erhöhung der Rendite in einem gnadenlosen kommerziellen Wettbewerb. Gewaltdarstellungen fesseln die Aufmerksamkeit, sind spannend, unterhalten. Ein friedensorientierter Ethiker bestreitet dies nicht, unterscheidet aber zwischen Berichten, die geeignet sind, die Gewalt als etwas darzustellen, das bekämpft und zurückgedrängt werden muss,[…] und anderen Formen, die ,,action‘‘ betonen und gewalthaltige Ereignisse für die kommerziellen Zwecke ausbeuten, ohne nach irgendwelchen Menschheitsanliegen zu fragen.‘‘
Das Zitat von Wolfgang Wunden, Mitbegründer der ,,Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur‘‘ und Autor zahlreicher medienethischer Publikationen, zeigt, dass man Gewalt nicht per se verurteilen kann, sondern sehr genau differenzieren muss und auch die systemrelevanten Rahmenbedingungen im ökonomischen Feld mit einzubeziehen hat. Bevor diese Hausarbeit jedoch auf praktischer Seite auf die Darstellung von Gewalt in den Medien eingehen kann müssen zunächst einige grundlegende Fragen geklärt werden. Zu allererst gilt es die, auf globaler Ebene, ursächliche Relevanz der Medien als ethische Akteure festzuhalten. Dabei soll vor allem der Einfluss der Medien auf die Gesellschaft akzentuiert, und die Frage nach dem Sinn der medienethischen Analyse gestellt werden. Ausgehend von der Feststellung, dass es durchaus einen gestiegenen Ethik in der Gesellschaft gibt, erfolgt eine anschließende definitorische Abgrenzung zwischen den beiden Begriffen der Moral und der Ethik und eine tiefergehende Unterscheidung der ethischen Teilbereiche. Vorbereitend auf den praktischen Teil soll eine genauere Beleuchtung nach der Frage der Verantwortung im Bereich der Medienethik Klarheit schaffen, wobei der Schwerpunkt, ausgehend vom kantischen Pflichtbegriff, besonders auf der Identifizierung von Handlungs- und Verantwortungsträgern im System der vertikalen Integration liegt. Um die Frage zu klären, warum Gewalt heutzutage ein so großes Publikum findet wird kurz auf die gesellschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten eingegangen, die stets von kontinuierlichen technischen Entwicklungen geprägt war, und die Möglichkeit der Omnipräsenz der Bilder geschaffen hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Theorie
- 2.1.1 Die globale Relevanz der Medien als ethische Akteure
- 2.1.2 Medienethische Grundfragen
- 2.1.3 Die Frage nach der Verantwortung
- 2.1.4 Omnipräsenz der Bilder & Gewalt in den Medien
- 2.2 Praxis
- 2.2.1 Tod via Youtube: Der Fall Neda Soltan und der Reuters Skandal
- 2.2.2 Pressefreiheit versus Menschenwürde im Kontext von Artikel 1 des deutschen Pressecodexes
- 2.2.3 Pro- und Kontra-Diskussion zur Veröffentlichung von sogenannten,,Schockbildern"
- 2.2.4. Fünf elementare Grundregeln für eine ethisch korrekte Krisen- und Kriegsberichterstattung
- 2.1 Theorie
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die ethischen Herausforderungen, die sich aus der Darstellung von Gewalt und Krieg in den Medien ergeben. Dabei wird der Fokus auf die Spannungsfelder zwischen Pressefreiheit und Menschenwürde gelegt. Die Arbeit analysiert die Relevanz der Medien als ethische Akteure in der globalisierten Medienlandschaft, beleuchtet grundlegende medienethische Fragen und untersucht die Verantwortung von Medienakteuren in Bezug auf die Darstellung von Gewalt.
- Die Relevanz der Medien als ethische Akteure in der globalisierten Medienlandschaft
- Die Spannungsfelder zwischen Pressefreiheit und Menschenwürde in der Berichterstattung über Gewalt und Krieg
- Die ethische Verantwortung von Medienakteuren in Bezug auf die Darstellung von Gewalt
- Die Auswirkungen der Omnipräsenz von Gewaltbildern in den Medien auf die Gesellschaft
- Die Entwicklung von Leitlinien für eine ethisch korrekte Krisen- und Kriegsberichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Gewalt und Krieg in den Medien ein und stellt die Relevanz der medienethischen Analyse heraus. Der Hauptteil thematisiert die theoretischen Grundlagen der Medienethik, insbesondere die Relevanz der Medien als ethische Akteure in der globalisierten Gesellschaft. Es werden grundlegende medienethische Fragen beleuchtet, wie die Frage nach der Verantwortung im Bereich der Medienethik. Der zweite Teil des Hauptteils befasst sich mit praktischen Beispielen aus der Medienlandschaft, wie dem Fall Neda Soltan und den Reuters-Journalisten, um die ethischen Herausforderungen der Berichterstattung über Gewalt und Krieg zu verdeutlichen. Die Diskussion um die Veröffentlichung von Schockbildern und die Abwägung zwischen Pressefreiheit und Menschenwürde stehen im Mittelpunkt. Schließlich werden fünf elementare Grundregeln für eine ethisch korrekte Krisen- und Kriegsberichterstattung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Medienethik, Gewalt, Krieg, Pressefreiheit, Menschenwürde, Schockbilder, Krisenberichterstattung, Kriegsberichterstattung, Verantwortung, Medienakteure, Globalisierung, Kommerzialisierung, Medienkultur, Ethik, Moral.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Julia Winkler (Autor:in), 2010, Gewalt und Krieg in den Medien: Ethik zwischen Pressefreiheit und Menschenwürde, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168436