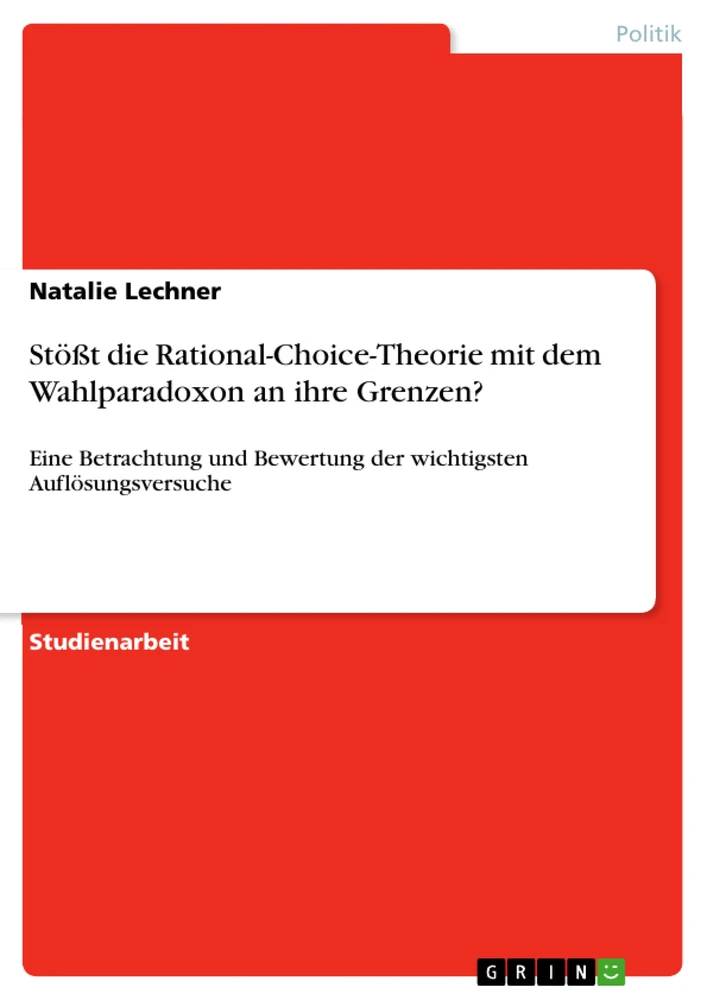"Wenn Wahlverhalten wirklich instrumentelles Verhalten ist, das ausschließlich auf
die Auswahl einer Regierung gerichtet ist, dann macht es in Massendemokratien für
den einzelnen letztlich keinen Sinn, sich an Wahlen zu beteiligen."
Bürklin und Klein machen mit diesem Zitatdeutlich, mit welcher geringen
Wahrscheinlichkeit eine einzelne Stimme den Ausgang einer Wahl entscheidend
beeinflussen kann. Zahlen für diese Wahrscheinlichkeit finden sich bei Müller, ihm
zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit,dass ein Wähler die entscheidende Stimme
abgibtbei , sie ist also fast Null.2
Es stellt sich somit die Frage, aus welchen Gründen ein Wahlberechtigter bereit ist
die Kosten einer Wahl, die ihm durch Informationsbeschaffung und Zeit entstehen,
zu tragen, wenn seine Stimme ohnehin nur eine infinitesimal kleine
Entscheidungskraft hat.
[...]
In dieser Arbeit soll es nun um die Frage gehen, ob die RCT bei der Erklärung der
Wahlbeteiligung tatsächlich an ihre Grenzen gestoßen ist und "aufgegessen wurde",
oder ob die Zusammenhänge bisher einfach falsch interpretiert wurden.
Dazu werden zunächst die, für diese Untersuchung wichtigen,Grundannahmen der
RCT, sowie die Zusatzannahmen von Anthony Downs, vorgestellt, da dieser"als
Pionier der RCT bezeichnet werden"7 kann und "die überwältigende Mehrheit aller
Beiträge aus der Wahlforschung, die dem Rational-Choice-Ansatz zuzurechnen sind,
[...] als Erweiterungen, Abwandlungen oder Anwendungen des von Downs
skizzierten Modells verstanden werden [können]"8.Eine weitere Ergänzung bildet
anschließend das Parteiendifferential, dessen Kenntnis für das Verständnis der
untersuchten Auflösungsversuche erforderlich ist.
Das nächste Kapitel ist der genauen Beschreibung des Wahlparadoxons gewidmet,
um anschließend auf die zu untersuchenden Auflösungsversuche eingehen zu
können. Um die Arbeit übersichtlich zu gestalten, wurden die verschiedenen
Versuche nach den Parametern geordnet, an denen sie ansetzen.
Natürlich findet sich in der Literatureine geraume Menge verschiedenster Versuche
das Wahlparadoxon aufzulösen, deren genaue Beschreibung den Rahmen dieser
Arbeit allerdings sprengen würde. Daher wird sich diese Arbeit nur auf die wichtigsten, weil am häufigsten zitierten und am meisten beachteten, Versuche
konzentrieren. In diese Kategorie gehören zweifellos der Ansatz von Riker und
Ordershook sowie das Modell von Grafstein, die versuchen die
Entscheidungswahrscheinlichkeit neu zu interpretieren, um das Wahlparadoxon [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rational-Choice-Theorie
- Die Down´schen Zusatzannahmen
- das Parteiendifferential
- Das Wahlparadoxon
- Auflösungsversuche
- Neuinterpretation der Entscheidungswahrscheinlichkeit p
- Neuinterpretation der Kosten C
- Neuinterpretation des Nutzens B
- Einführung neuer Parameter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Wahlparadoxon aus der Perspektive der Rational-Choice-Theorie. Es wird untersucht, ob die RCT in der Lage ist, die Wahlbeteiligung zu erklären oder ob sie an ihre Grenzen stößt. Dazu werden die Grundannahmen der RCT, sowie die Zusatzannahmen von Anthony Downs vorgestellt. Anschließend wird das Wahlparadoxon genauer beleuchtet und verschiedene Auflösungsversuche betrachtet.
- Grundannahmen der Rational-Choice-Theorie
- Das Wahlparadoxon
- Auflösungsversuche
- Bewertung der Auflösungsversuche
- Bedeutung der Ergebnisse für die politische Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Wahlparadoxon vor und erläutert die Problematik, dass die Wahlbeteiligung aus Sicht der Rational-Choice-Theorie irrational erscheint. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Grenzen der RCT in Bezug auf die Erklärung der Wahlbeteiligung zu untersuchen.
Die Rational-Choice-Theorie
Dieses Kapitel erläutert die Grundannahmen der Rational-Choice-Theorie und stellt die Zusatzannahmen von Anthony Downs vor. Es wird auf das Parteiendifferential eingegangen, das für das Verständnis der späteren Auflösungsversuche relevant ist.
Das Wahlparadoxon
Das Kapitel beschreibt das Wahlparadoxon genauer und zeigt auf, warum die Wahlbeteiligung aus der Perspektive der RCT als irrational erscheint. Es werden die wichtigsten empirischen Befunde zur Wahlbeteiligung dargestellt.
Auflösungsversuche
Dieses Kapitel stellt verschiedene Versuche vor, das Wahlparadoxon zu lösen. Es werden die wichtigsten Ansätze nach den Parametern geordnet, an denen sie ansetzen (Entscheidungswahrscheinlichkeit, Kosten, Nutzen, neue Parameter).
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Rational-Choice-Theorie, das Wahlparadoxon, Wahlbeteiligung, Kosten und Nutzen, empirische Forschung, Auflösungsversuche, Entscheidungswahrscheinlichkeit, Parteiendifferential.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Wahlparadoxon"?
Es beschreibt das Problem, dass die Teilnahme an einer Massenwahl aus rationaler Sicht irrational ist, da die Kosten (Zeit, Information) den Nutzen (Einfluss der einzelnen Stimme fast Null) übersteigen.
Was besagt die Rational-Choice-Theorie (RCT) zum Wahlverhalten?
Die RCT geht davon aus, dass Wähler eine Kosten-Nutzen-Abwägung treffen. Da die Wahrscheinlichkeit, die entscheidende Stimme abzugeben, infinitesimal klein ist, dürfte eigentlich niemand wählen gehen.
Welche Zusatzannahmen machte Anthony Downs?
Downs führte unter anderem das "Parteiendifferential" ein, um zu erklären, wie Wähler den Nutzen aus dem Sieg einer bestimmten Partei berechnen.
Wie versuchen Forscher das Wahlparadoxon aufzulösen?
Durch Neuinterpretation der Parameter: z.B. wird der Nutzen (B) um den Wert der "Bürgerpflicht" ergänzt oder die Kosten (C) werden als sehr gering eingeschätzt.
Stößt die RCT beim Wahlverhalten an ihre Grenzen?
Die Arbeit analysiert, ob die Theorie "aufgegessen" wurde oder ob durch neue Parameter (wie bei Riker und Ordeshook) die Wahlbeteiligung doch noch rational erklärt werden kann.
- Citar trabajo
- Natalie Lechner (Autor), 2010, Stößt die Rational-Choice-Theorie mit dem Wahlparadoxon an ihre Grenzen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167711