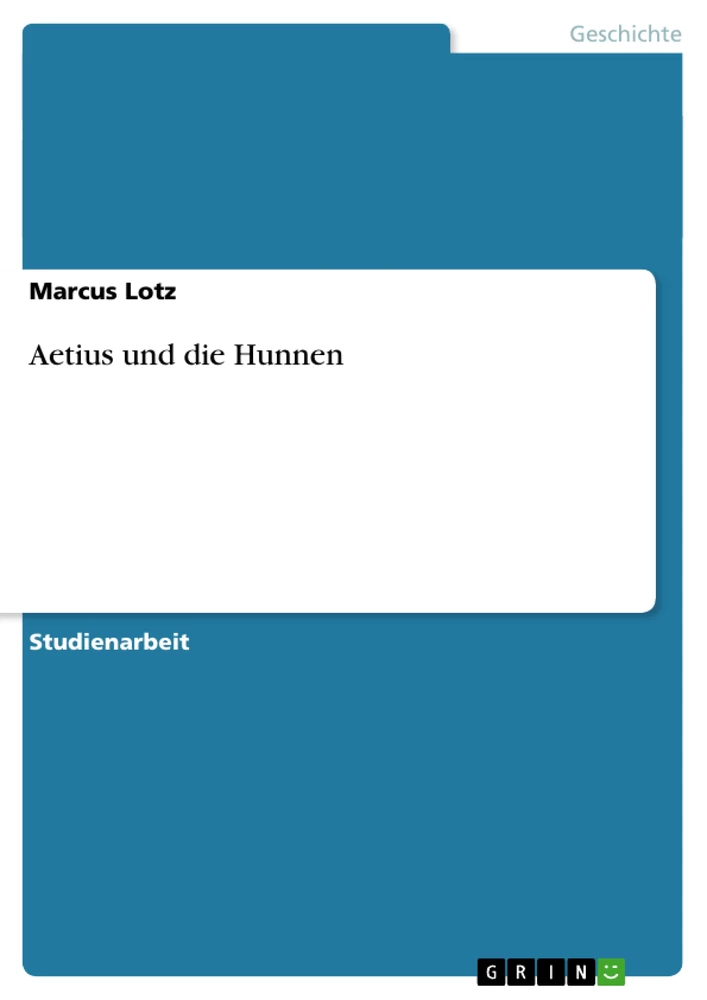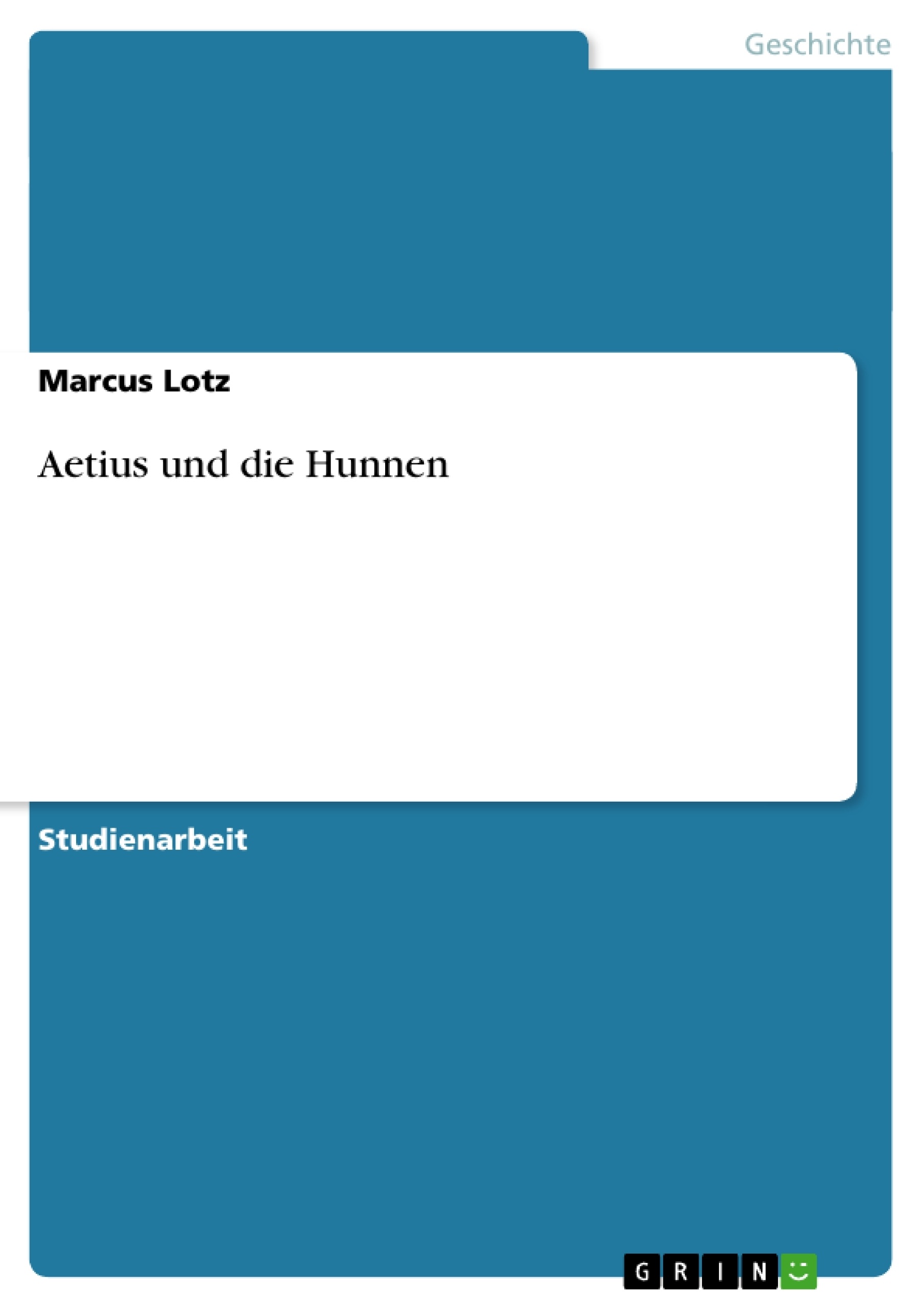Wenn der Name ,,Attila“ fällt, so bringen ihn die meisten wohl mit dem Volk der Hunnen in Verbindung, einem Reiterstamm, der zu Zeiten von Römern und Barbaren in Europa einfiel und scheinbar grausam plündernd durch die Lande zog. Weniger bekannt, aber für die vorliegende Arbeit nicht weniger von Bedeutung ist sein Zeitgenosse Aëtius, ein römischer Heermeister, dem es bestimmt war, Attilas Widersacher zu werden. Viel ist im Laufe der Jahre über die Persönlichkeiten beider Männer spekuliert worden, viel wurde über ihre Charakterzüge, ihre politischen Ziele und Ambitionen und ihre Motivlage diskutiert, zumeist nur aufgrund vager Quellen und Indizien. War Aëtius wirklich ,,der letzte Römer“, wie er gerne genannt wird oder waren die Fehler des Heermeister im Umgang mit den Hunnen so offensichtlich, dass man ihm im Nachhinein ohne weiteres Unfähigkeit bescheinigen könnte?
Es kann und soll nicht das Ziel dieser Arbeit sein, eine klare Antwort auf diese Frage zu finden. Das Ziel soll es viel eher sein, die vorhandenen Quellen- und Literaturangebote einer kritischen Untersuchung zu unterziehen, um so nach und nach ein möglichst realistisches Bild dieser beiden Männer und ihrer Beziehung zueinander zu zeichnen.
Im Hinblick auf den historischen Kontext soll die Frage geklärt werden, wie das Verhältnis zwischen dem Weströmischen Reich und dem Hunnenkönig Attila im Rahmen unseres Untersuchungszeitraumes zu charakterisieren ist. Hierbei soll insbesondere auf die Bedeutung der oströmischen Politik und auf die Rolle der Schwester des römischen Kaisers, Justa Grata Honoria eingegangen werden. Ausgehend von diesem Verhältnis möchte ich den Verlauf dieses Konflikts verfolgen, der mit der berühmten Schlacht auf den Katalaunischen Feldern eine Eskalation erlebte. Hierbei soll die Frage geklärt werden, welche beiden Konstellationen sich in dieser Schlacht gegenüberstanden und welche Ambitionen beide Parteienverbände verfolgten. Schließlich werde ich mich dem entscheidenden Höhepunkt des Konflikts, dem Einfall der Hunnen in Oberitalien widmen und versuchen, eine Antwort auf die Frage zu finden, welche Faktoren Aëtius seinen Sieg über Attila im Jahre 451/52 zu verdanken hatte.
In meinem abschließenden Resümee möchte ich versuchen, anhand der verfügbaren Quellen und Literatur ein möglichst umfassendes Gesamtbild des Verhältnisses zwischen Römern und Hunnen zu kreieren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Von Attila, dem Hunnenkönig und Aëtius, dem Heermeister Roms
- II. Die Welten zweier Männer
- III. Römisch-Hunnische Diplomatie
- IV. Der Tod Theodosius II. und die Hinwendung nach Westen
- V. Die Honoria-Affäre
- VI. Der Gallienfeldzug
- VII. Attila in Italien
- VIII. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen dem römischen Heermeister Aëtius und dem Hunnenkönig Attila. Ziel ist es, anhand einer kritischen Analyse verfügbarer Quellen und Literatur ein möglichst realistisches Bild beider Männer und ihrer Beziehung zueinander zu zeichnen. Dabei steht die Gotengeschichte des Jordanis im Mittelpunkt der Quellenanalyse.
- Die Persönlichkeiten Aëtius' und Attilas und ihre jeweiligen Lebenswege
- Die römisch-hunnische Diplomatie und ihre Bedeutung
- Der Einfluss der oströmischen Politik auf das Verhältnis zwischen Rom und den Hunnen
- Die Schlacht auf den Katalaunischen Feldern und ihre Hintergründe
- Attilas Italienfeldzug und die Faktoren, die Aëtius' Sieg beeinflussten
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Von Attila, dem Hunnenkönig und Aëtius, dem Heermeister Roms: Die Einleitung stellt die beiden Hauptfiguren, Attila und Aëtius, vor und skizziert die Forschungsfrage nach der Natur ihres Verhältnisses. Sie betont die Schwierigkeit, aufgrund der spärlichen und teilweise vagen Quellenlage ein eindeutiges Urteil zu fällen. Das Ziel der Arbeit wird definiert: eine kritische Analyse der Quellen, insbesondere der Gotengeschichte des Jordanis, um ein möglichst realistisches Bild der Beziehung zwischen Aëtius und Attila zu erhalten. Der historische Kontext, insbesondere die Rolle der oströmischen Politik und Justa Grata Honoria, wird als wichtiger Aspekt der Untersuchung hervorgehoben.
II. Die Welten zweier Männer: Dieses Kapitel zeichnet ein Bild von Aëtius und Attila, wobei die Jugend Aëtius' als Geisel bei Westgoten und Hunnen als prägend für seine spätere Karriere hervorgehoben wird. Es wird die These diskutiert, dass Aëtius' Kontakte zu den Hunnen ihm halfen, seine Macht im weströmischen Reich zu festigen. Im Kontrast dazu wird Attila vorgestellt, dessen Aufstieg zum Führer der Hunnen geschildert wird. Die These eines möglichen Aufenthalts Attilas als Geisel in Rom wird diskutiert, um Parallelen zu Aëtius' Lebenslauf zu ziehen und mögliche Motivationen Attilas zu erklären. Der Kapitel schliesst mit der Feststellung der Heterogenität der hunnischen Bevölkerungsgruppe und den Machtkämpfen innerhalb des hunnischen Führungszirkel.
Schlüsselwörter
Aëtius, Attila, Hunnen, Weströmisches Reich, Römisch-Hunnische Beziehungen, Diplomatie, Schlacht auf den Katalaunischen Feldern, Gotengeschichte, Jordanis, Oströmische Politik, Honoria.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Aëtius und Attila – Ein Verhältnis im Spannungsfeld zwischen Rom und den Hunnen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das komplexe Verhältnis zwischen dem römischen Heermeister Aëtius und dem Hunnenkönig Attila. Ziel ist es, anhand einer kritischen Quellenanalyse ein möglichst realistisches Bild ihrer Beziehung zu zeichnen, wobei die Gotengeschichte des Jordanis im Mittelpunkt steht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der Beziehung zwischen Aëtius und Attila, darunter die Persönlichkeiten beider Männer und ihre Lebenswege, die römisch-hunnische Diplomatie, den Einfluss der oströmischen Politik, die Schlacht auf den Katalaunischen Feldern und Attilas Italienfeldzug.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist die Gotengeschichte des Jordanis. Die Arbeit stützt sich aber auch auf eine kritische Analyse weiterer verfügbarer Quellen und Literatur.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, die Vorstellung der Lebenswelten Aëtius' und Attilas, die römisch-hunnische Diplomatie, der Tod Theodosius' II. und die Hinwendung nach Westen, die Honoria-Affäre, der Gallienfeldzug, Attilas Italienfeldzug und ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Beziehung zwischen Aëtius und Attila.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein möglichst realistisches Bild der Beziehung zwischen Aëtius und Attila zu zeichnen, basierend auf einer kritischen Analyse der Quellenlage. Konkrete Schlussfolgerungen werden im Fazit der Arbeit präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Aëtius, Attila, Hunnen, Weströmisches Reich, Römisch-Hunnische Beziehungen, Diplomatie, Schlacht auf den Katalaunischen Feldern, Gotengeschichte, Jordanis, Oströmische Politik, Honoria.
Wie wird die Rolle der oströmischen Politik dargestellt?
Die Arbeit betont die Bedeutung der oströmischen Politik für das Verhältnis zwischen Rom und den Hunnen als wichtigen Einflussfaktor.
Welche Bedeutung hat die Schlacht auf den Katalaunischen Feldern?
Die Schlacht auf den Katalaunischen Feldern wird als ein zentraler Punkt in der Beziehung zwischen Aëtius und Attila untersucht und deren Hintergründe analysiert.
Welche Rolle spielt die Honoria-Affäre?
Die Honoria-Affäre wird als ein wichtiger Aspekt des Verhältnisses zwischen Aëtius und Attila behandelt und deren Einfluss auf die Ereignisse untersucht.
- Quote paper
- Marcus Lotz (Author), 2010, Aetius und die Hunnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167401