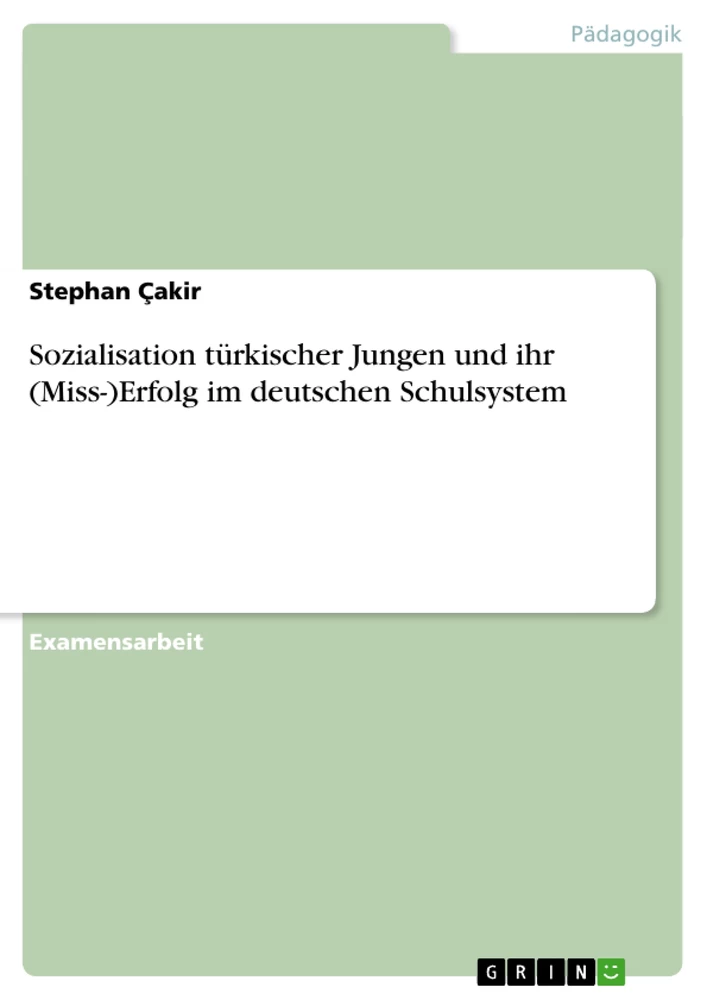"... absolut abfallend sind die türkische Gruppe und die Araber. Auch in der dritten Generation haben sehr viele keine vernünftigen Deutschkenntnisse, viele gar keinen Schulabschluss, und nur ein kleiner Teil schafft es bis zum Abitur.“ (Sarrazin/Berberich 2009, S.200)
Die Fragen, die Sarrazin´s Interview zweifellos aufgeworfen, durch verschiedene Medien weitergetragen und zu einer regen Diskussion in allen Gesellschaftsschichten geführt haben, sollen nachfolgend in dieser Arbeit differenziert betrachtet werden, auch wenn sie nicht als entscheidender Ausgangspunkt für das Thema der Arbeit angesehen werden können (siehe Vorwort).
Steht es erstens um Deutschlands Integrationsbemühungen, den dazugehörigen Angeboten sowie deren Nutzung seitens ethnischer Minderheiten wirklich so schlecht, so dass sich die Hälfte der Bevölkerung der Meinung Sarrazins anschließt, nach der türkischstämmige (und arabischstämmige) Menschen weder integrationsfähig noch integrationswillig sind? Stimmt es zum zweiten weiterhin, dass Türken unterdurchschnittliche Bildungserfolge erzielen, wenn sie mit deutschen Schülern oder aber anderen Migrantengruppen verglichen werden? Und drittens: Welche Erfolge und Versäumnisse kann die Integration in Deutschland vorweisen, welche Bedingungen finden Migranten im Bildungssystem vor und welchen Benachteiligungen sehen sie sich ausgesetzt? Diese drei zentralen Fragen sollen als Leitfaden dienen, an dem sich die vorliegende Arbeit orientiert.
Ausgehend von soziologischen Theorielinien, die jeweils verkürzt erläutert werden, versuche ich mithilfe empirischer Daten und wissenschaftlicher Beiträge einen differenzierten Blickwinkel zur Sozialisation türkischer Jungen einzunehmen. Am Ende der jeweiligen Teilabschnitte fasst ein Resümee die Zusammenhänge jeweils zusammen, die sich dann am Ende der Arbeit im vierten Kapitel zu einem Fazit bündeln lassen. Hier soll aus den vorher gesammelten Informationen gefolgert werden, wie sich die Sozialisation türkischer Jungen auf einen (Miss-)Erfolg im deutschen Schulsystem auswirkt und wie dieser gedeutet werden kann.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 EINLEITUNG
- 1.1 Fragestellung und Vorgehensweise
- 2 MIGRATION UND INTEGRATION
- 2.1 Die Arbeitsmigration in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2.2 Einwanderungsgeschichte der türkischen Bevölkerung
- 2.3 Integration als Begriff der Migrationsforschung
- 2.4 Das Integrationskonzept nach Esser
- 2.4.1 Systemintegration
- 2.4.2 Vier Bereiche sozialer Integration
- 2.4.3 Sozialintegration von Migranten
- 2.4.4 Systemintegration: Multiethnische Gesellschaft oder strukturelle Assimilation
- 2.4.5 Zusammenfassung
- 2.5 Systemintegration der türkischen Bevölkerung
- 2.6 Soziale Integration der türkischen Bevölkerung
- 2.6.1 Zusammenhang zwischen den Integrationsbereichen - Theorie und Realität
- 2.7 Zwischenfazit
- 3 SOZIALISATION
- 3.1 Theorien zur Sozialisation
- 3.1.1 Strukturfunktionalistischer und rollentheoretischer Ansatz
- 3.1.2 Entwicklungsbezogener, psychodynamischer Ansatz
- 3.1.3 Reflexiv-handlungstheoretischer Ansatz
- 3.1.4 Systemtheoretisch-ökologischer Ansatz
- 3.1.5 Zusammenfassung
- 3.2 Sozialisation in der Familie
- 3.2.1 Was ist eine Familie?
- 3.2.2 Familienspezifische Umwelt türkischer Jungen – sozio-ökonomische Daten
- 3.2.2.1 Erwerbstätigkeit und berufliche Stellung
- 3.2.2.2 Einkommen
- 3.2.2.3 Wohnsituation
- 3.2.2.4 Soziales Umfeld
- 3.2.2.5 Außerfamiliäre Anregungen
- 3.2.3 Innerfamiliäres Sozialisationsgeschehen in türkischen Familien
- 3.2.3.1 Erziehungsziele
- 3.2.3.2 Erziehungsstil
- 3.2.3.3 Sprache
- 3.2.4 Zusammenfassung
- 3.3 Sozialisation in der Schule
- 3.3.1 Funktionen der Schule
- 3.3.2 Rollenan-und Überforderung des Schülers
- 3.3.3 Bildungsabschlüsse türkischer Jugendlicher
- 3.3.4 Institutionelle Benachteiligung
- 3.3.4.1 Eintritt in die Grundschule
- 3.3.4.2 Überweisung auf eine Sonderschule
- 3.3.4.3 Übergang zu weiterführenden Schulen
- 3.3.4.4 Ebenen der institutionellen Diskriminierung
- 3.3.5 Verschlungene Bildungspfade
- 3.3.6 Zusammenfassung
- 3.4 Sozialisation und Geschlecht
- 3.4.1 Gleichberechtigte Verhältnisse oder traditionelle Geschlechtsrollen?
- 3.4.2 Freizeitaktivitäten
- 3.4.3 Mitschüler oder Türke?
- 3.4.4 Berufliche und private Lebensentwürfe
- 3.4.5 Trotziger Außenseiter, Familienmann oder Bildungsaufsteiger?
- 3.4.6 Zusammenfassung
- Migrationsgeschichte und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland
- Theorien zur Sozialisation und ihre Relevanz für die Integration von Migrantenkindern
- Familiäre und schulische Sozialisationsbedingungen türkischer Jungen
- Einfluss von Geschlechterrollen auf die Sozialisation und Integration
- Institutionelle und soziale Faktoren, die den (Miss-)Erfolg im deutschen Schulsystem beeinflussen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Sozialisation türkischer Jungen in Deutschland und ihrem (Miss-)Erfolg im deutschen Schulsystem. Ziel der Arbeit ist es, die sozialen und kulturellen Bedingungen aufzuzeigen, die die Integration von türkischen Jungen in die deutsche Gesellschaft beeinflussen. Dabei stehen insbesondere die familiäre und schulische Sozialisation im Mittelpunkt der Betrachtung.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel dieser Arbeit gibt einen Einblick in die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise. Das zweite Kapitel beleuchtet die Thematik Migration und Integration anhand der Arbeitsmigration in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, der Einwanderungsgeschichte der türkischen Bevölkerung und der Integration als Begriff der Migrationsforschung. Darüber hinaus wird das Integrationskonzept nach Esser vorgestellt und angewendet, um die Systemintegration und soziale Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland zu analysieren. Im dritten Kapitel werden zunächst Theorien zur Sozialisation vorgestellt, wobei verschiedene Ansätze wie der strukturfunktionalistische, der entwicklungsbezogene und der systemtheoretische Ansatz beleuchtet werden. Anschließend wird die Bedeutung der Familie für die Sozialisation türkischer Jungen untersucht. Dabei werden sozio-ökonomische Faktoren der familiären Umwelt, wie Erwerbstätigkeit, Einkommen und Wohnsituation betrachtet. Des Weiteren wird das innerfamiliäre Sozialisationsgeschehen in türkischen Familien anhand von Erziehungszielen, Erziehungsstil und Sprache analysiert. Das dritte Kapitel widmet sich der Sozialisation in der Schule und beleuchtet die Funktionen der Schule, die Rollenan-und Überforderung des Schülers, die Bildungsabschlüsse türkischer Jugendlicher und die institutionelle Benachteiligung, die türkische Jungen im Bildungssystem erfahren. Zuletzt wird die Bedeutung von Geschlecht für die Sozialisation und Integration türkischer Jungen untersucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Sozialisation, Integration, Migration, türkische Jungen, Deutschland, Schulsystem, Familie, Schule, Geschlecht, Bildung, sozio-ökonomische Faktoren, Erziehung, Diskriminierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum erzielen türkische Jungen oft geringere Bildungserfolge?
Die Arbeit nennt eine Kombination aus sozio-ökonomischen Faktoren der Familie, sprachlichen Barrieren und institutioneller Benachteiligung im deutschen Schulsystem.
Was ist das Integrationskonzept nach Esser?
Hartmut Esser unterscheidet zwischen Systemintegration (Zusammenhalt des Ganzen) und Sozialintegration (Einbindung des Individuums in Bereiche wie Bildung, Arbeit und soziale Kontakte).
Welche Rolle spielt die familiäre Sozialisation?
Erziehungsstile, Bildungsaspirationen der Eltern und die häusliche Sprachumgebung prägen die Startvoraussetzungen der Kinder maßgeblich.
Was bedeutet "institutionelle Diskriminierung" in der Schule?
Damit sind Mechanismen im Bildungssystem gemeint, die Migrantenkinder benachteiligen, etwa bei der Empfehlung für weiterführende Schulen oder der Zuweisung zu Sonderschulen.
Wie beeinflussen Geschlechterrollen den Schulerfolg?
Traditionelle Männlichkeitsbilder können in Konflikt mit den Anforderungen der Schule stehen, was zu einer Identität als "trotziger Außenseiter" führen kann.
- Citation du texte
- Stephan Çakir (Auteur), 2010, Sozialisation türkischer Jungen und ihr (Miss-)Erfolg im deutschen Schulsystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167381