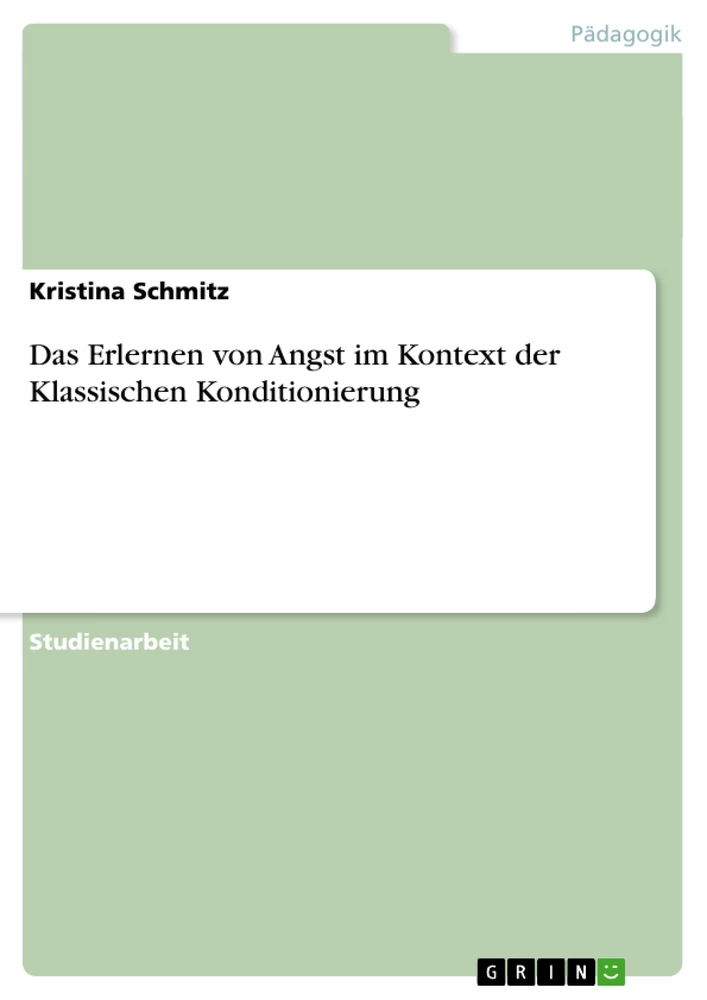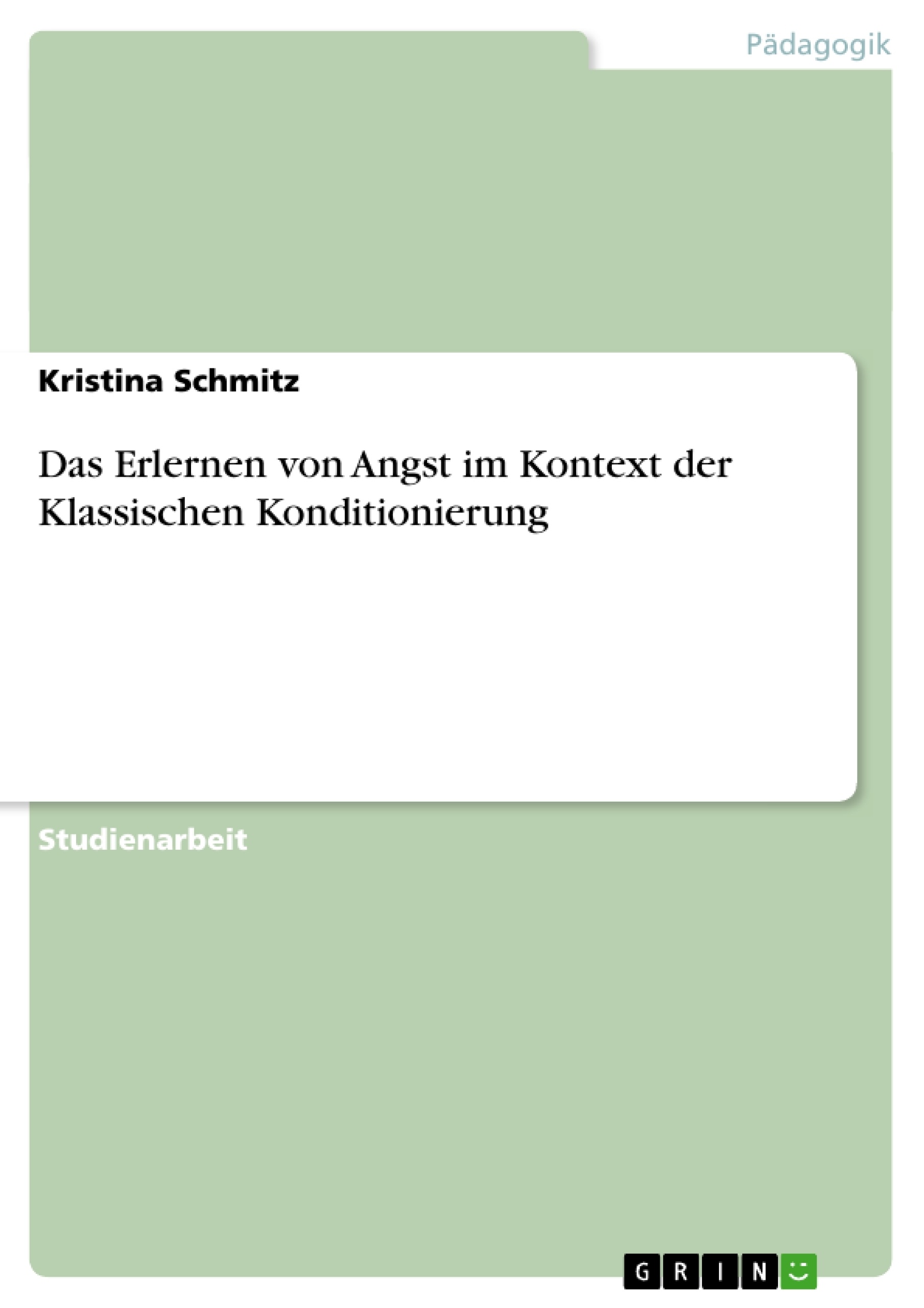Ein Schüler, der immer schon gern zur Schule ging und seit der Grundschule recht
fleißig und strebsam ist, zeigt eine auffällige Begabung für Mathematik. Im Laufe
der Pubertät verlagern sich jedoch seine Interessen und er beginnt, die Schule zu
vernachlässigen. Das führt dazu, dass er besonders von seinem Mathematik-Lehrer
immer häufiger getadelt wird. Als Reaktionen auf diese Tadel entwickelt der
Schüler mit der Zeit sowohl eine Abneigung gegenüber dem Fach Mathematik als
auch Angst seinem Lehrer gegenüber.
Ein anderes Fallbeispiel:
Hat man beim Zahnarzt schlechte und vor allem schmerzhafte Erfahrungen
gemacht, kann allein der Anblick des Bohrers bei manchen Patienten die gleiche
reflektorische Ausweichreaktion auslösen wie die eigentliche Anwendung des
Geräts.
Darüber hinaus vermag der weiße Kittel eines Verkäufers im Supermarkt bei einem
kleinen Kind unter Umständen genauso Angst auszulösen wie der Arzt, der einige
Zeit zuvor eine Spritze verabreicht hat.
Durch diese Fallbeispiele wird ein zentrales Muster der Lernpsychologie
veranschaulicht: die Klassische Konditionierung.
Die Erforschung dieser Form der Konditionierung wurde über einen langen
Zeitraum hinweg als Schlüssel zum Verständnis erlernten Verhaltens bei Tier und
Mensch und zur Überwindung unerwünschten sowie zur Förderung positiven
Verhaltens gesehen.
Lerntheoretische Prinzipien nehmen eine wichtige Rolle in der menschlichen
Interaktion ein.
Im folgenden werde ich versuchen, mich zuerst mit Lernen, der Klassischen
Konditionierung im allgemeinen und dem Reiz-Reaktions-Lernen zu befassen.
Anschließend möchte ich das Erlernen emotionaler Reaktionen, besonders das
Erlernen und Verlernen von Angst, schwerpunktmäßig erfassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Lernen?
- 3. Das Klassische Konditionieren
- 4. Das Reiz-Reaktions-Lernen
- 4.1. Reiz und Reaktion
- 4.2. Das Erlernen emotionaler Reaktion
- 4.2.1. Das Erlernen von Angst
- 4.2.1.1. Der Fall Albert
- 4.2.2. Das Verlernen von Angst
- 4.2.2.1. Der Fall Peter
- 4.2.3. Das Bedingen von Angst
- 4.2.1. Das Erlernen von Angst
- 4.3. Kritik an den Experimenten
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Erlernen von Angst im Kontext der Klassischen Konditionierung. Ziel ist es, dieses Lernprinzip zu erläutern und anhand von Beispielen zu veranschaulichen, wie Angst gelernt und verlernt werden kann. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der Klassischen Konditionierung und ihre Relevanz für das Verständnis menschlichen Verhaltens.
- Definition und Erklärung des Lernprozesses
- Das Prinzip des Klassischen Konditionierens
- Das Erlernen und Verlernen von Angst
- Beispiele aus der Praxis (z.B. Fall Albert, Fall Peter)
- Kritische Auseinandersetzung mit den Experimenten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und präsentiert zwei Fallbeispiele, die den Lernprozess von Angst veranschaulichen: ein Schüler entwickelt Angst vor Mathematik und seinem Lehrer aufgrund wiederholter Tadel, und ein Patient entwickelt eine Angst vor dem Zahnarztbesuch aufgrund negativer Erfahrungen. Diese Beispiele dienen als Ausgangspunkt für die Erläuterung der Klassischen Konditionierung als zentrales Muster der Lernpsychologie und deren Bedeutung für das Verständnis von erlerntem Verhalten bei Mensch und Tier. Die Einleitung kündigt die weitere Struktur der Arbeit an.
2. Was ist Lernen?: Dieses Kapitel widmet sich verschiedenen Definitionen des Begriffs „Lernen“. Es wird zwischen dem umgangssprachlichen Verständnis von Lernen als schulischer Wissens- und Fertigkeitserwerb und den wissenschaftlichen Definitionen unterschieden. Zimbardo's Definition von Lernen als Prozess, der zu relativ stabilen Verhaltensveränderungen führt, wird vorgestellt. Gudjons' Unterscheidung zwischen Lernen als wertneutralem Begriff im Gegensatz zu Erziehung wird ebenfalls diskutiert. Das Kapitel betont, dass Lernen ein Prozess ist, der Zeit benötigt, sowohl bewusst als auch unbewusst stattfinden kann und an Veränderungen im Verhalten messbar ist. Gage & Berliner's Ergänzungen zur Unterscheidung zwischen Lernen und Veränderungen physischer Eigenschaften werden einbezogen. Das Kapitel schliesst mit der Einführung von Lerntheorien als systematische Erklärungen von Lernprozessen und führt zum folgenden Kapitel über die Klassische Konditionierung über.
Schlüsselwörter
Klassische Konditionierung, Angst, Lernen, Reiz-Reaktions-Lernen, emotionale Reaktionen, Fall Albert, Fall Peter, Lerntheorien, Verhaltenstheorien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Lernpsychologie und Klassische Konditionierung
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Klassische Konditionierung und deren Rolle beim Erlernen und Verlernen von Angst. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Erläuterung des Lernprinzips der Klassischen Konditionierung anhand von Beispielen wie dem "Fall Albert" und dem "Fall Peter".
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: Definition und Erklärung von Lernen, das Prinzip der Klassischen Konditionierung, das Erlernen und Verlernen von Angst, Beispiele aus der Praxis (Fall Albert, Fall Peter), kritische Auseinandersetzung mit den Experimenten zur Klassischen Konditionierung und verschiedene Definitionen von Lernen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Was ist Lernen?, Das Klassische Konditionieren, Das Reiz-Reaktions-Lernen (inkl. Unterkapiteln zum Erlernen und Verlernen von Angst und Kritik an den Experimenten), und Resümee.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte?
Die Zielsetzung des Textes ist die Untersuchung des Erlernens von Angst im Kontext der Klassischen Konditionierung. Es soll erläutert werden, wie Angst gelernt und verlernt werden kann, verschiedene Aspekte der Klassischen Konditionierung beleuchtet und deren Relevanz für das Verständnis menschlichen Verhaltens dargestellt werden.
Welche Beispiele werden im Text verwendet?
Als zentrale Beispiele dienen die klassischen Fälle von "Albert" (Erlernen von Angst) und "Peter" (Verlernen von Angst). Zusätzlich werden einleitend Beispiele eines Schülers mit Angst vor Mathematik und einem Patienten mit Angst vor dem Zahnarzt verwendet, um den Lernprozess von Angst zu veranschaulichen.
Wie wird der Begriff "Lernen" definiert?
Der Text unterscheidet zwischen dem umgangssprachlichen Verständnis von Lernen und wissenschaftlichen Definitionen. Es werden verschiedene Definitionen vorgestellt, darunter Zimbardos Definition von Lernen als Prozess, der zu relativ stabilen Verhaltensveränderungen führt, und Gudjons' Unterscheidung zwischen Lernen und Erziehung. Der Text betont, dass Lernen ein zeitlicher Prozess ist, der sowohl bewusst als auch unbewusst stattfinden kann und an Veränderungen im Verhalten messbar ist.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Die Schlüsselwörter umfassen: Klassische Konditionierung, Angst, Lernen, Reiz-Reaktions-Lernen, emotionale Reaktionen, Fall Albert, Fall Peter, Lerntheorien, Verhaltenstheorien.
Was ist die Kernaussage des Textes?
Die Kernaussage des Textes ist, dass Angst, wie andere Verhaltensweisen auch, durch Klassische Konditionierung erlernt und verlernt werden kann. Der Text veranschaulicht dieses Prinzip anhand von Beispielen und wissenschaftlichen Definitionen und bietet einen kritischen Überblick über die entsprechenden Experimente.
- Quote paper
- Kristina Schmitz (Author), 2001, Das Erlernen von Angst im Kontext der Klassischen Konditionierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16730