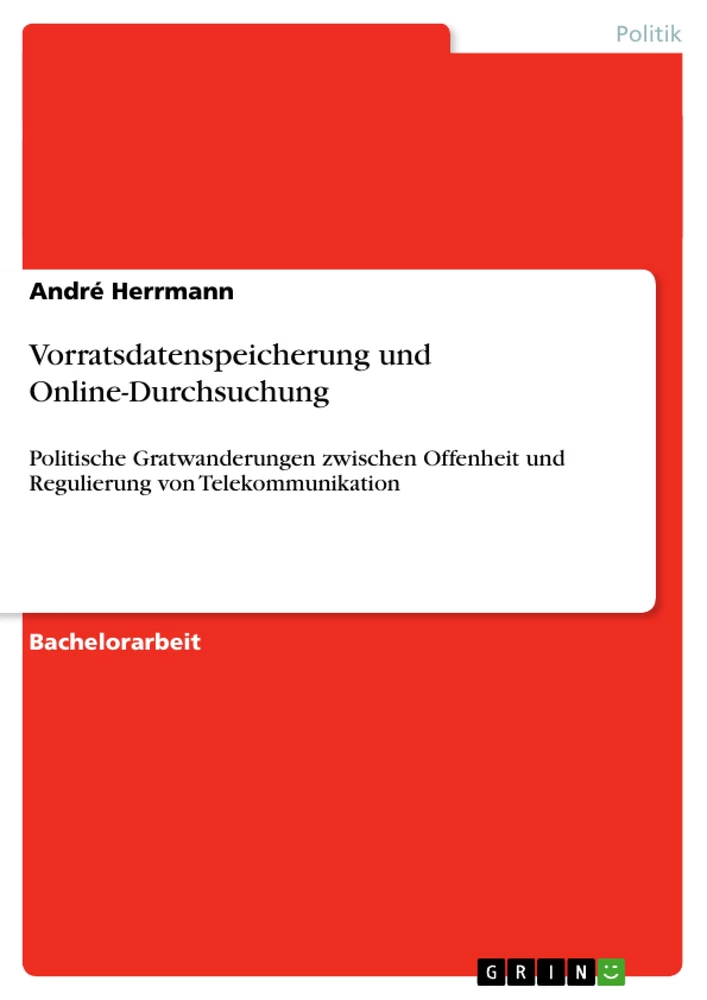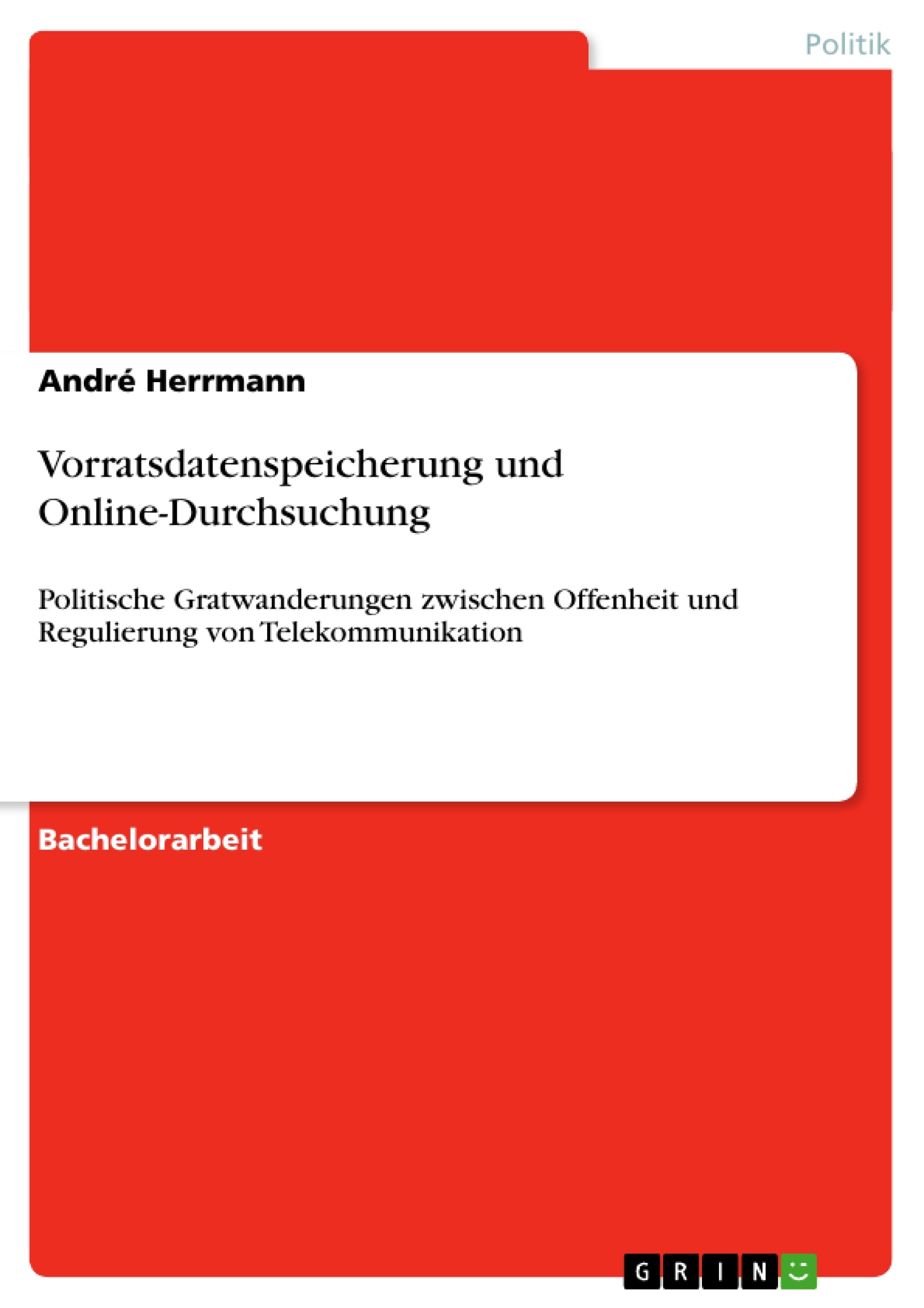Seit dem Ende der 90er Jahre erlebt die Welt nicht nur die rasend schnelle Verbreitung des
Internets, sondern auch fortwährende Bestrebungen, das schier unsichtbare
Kommunikationsnetz, das so bedeutend für die Menschen geworden ist, rechtlich
handhabbar zu machen. Als am 07. November 2007 das Gesetz zur Neuregelung der
Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie
zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG im Bundestag beschlossen wurde1, ging ein
Aufschrei durch die Medien. Weniger als 2 Monate später, am 31. Dezember 2007, folgte
einem Aufruf des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung die größte
Verfassungsbeschwerde in der Geschichte der BRD2. Den Weg bis zur Aufhebung des
Gesetzes durch das Bundesverfassungsgericht am 02. März 20103 begleiteten unzählige
mit Schlagworten durchsetzte Debatten über Terrorismusbekämpfung, Datenschutz und
Freiheit im Kontext ausufernder Sicherheitsbestrebungen.
Diesen Kanon aufnehmend, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit kritisch mit der
Gesetzgebung im Rahmen der in Deutschland getroffenen Maßnahmen zur
Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten beschäftigen und gibt einen Ausblick
auf die Online-Durchsuchung.
Dazu soll zuerst ein historischer Rückblick gegeben werden, der aufzeigt, wann und aus
welchen Gründen auf EU-Ebene begonnen wurde, nach Möglichkeiten zu suchen, eine
Speicherung von Kommunikationsdaten zur Prävention und Strafverfolgung über einen
bestimmten Zeitraum vorzunehmen. Welcher Zusammenhang lässt sich insbesondere zu
den terroristischen Anschläge in New York, Madrid und London herstellen? Weiterhin soll
geklärt werden, wie sich der Prozess der Gesetzgebung in Deutschland hin zum Gesetz zur
Vorratsdatenspeicherung gestaltete, ab welchem Zeitpunkt in Deutschland versucht wurde,
Telekommunikationdaten auf Vorrat zu speichern und inwieweit sich die deutsche Politik
dabei von den Bestrebungen auf EU-Ebene beeinflussen ließ.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der lange Weg zur Vorratsdatenspeicherung
- 2.1 Die Europäische Union und die Richtlinie 2006/24/EG
- 2.1.1 Vor dem 11. September 2001
- 2.1.2 Nach den Anschlägen vom 11. September 2001
- 2.1.3 Nach den Madrider Zuganschlägen vom 11. März 2004
- 2.1.4 Nach den Londoner Anschlägen vom 07. Juli 2005
- 2.2 Deutschland und das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG
- 3. Absehbares Scheitern
- 3.1 Eine kurze Definition der Vorratsdatenspeicherung
- 3.2 Kritische Betrachtung
- 3.2.1 Unstimmigkeiten in Bezug auf Europäisches Vertragsrecht
- 3.2.2 Verstoß gegen das Grundgesetz für die BRD
- 3.2.3 Viele Daten, nicht normierte Sicherung, hohe Kosten
- 3.2.4 Mögliche Bildung von Persönlichkeits- und Bewegungsprofilen
- 3.2.5 Leichte Umgehbarkeit
- 3.2.6 Schwerwiegende Folgen
- 4. Vorratsdatenspeicherung und Vetospielertheorem
- 4.1 Definition
- 4.2 Anwendung
- 4.2.1 Europäische Union: Der Druck des Rates
- 4.2.2 Deutschland: Umweg über Europa
- 5. Eingreifen des Bundesverfassungsgerichts
- 5.1 Verfassungsbeschwerden
- 5.2 Einstweilige Anordnung vom 11. März 2008
- 5.3 Wiederholung und Ausweitung der einstweiligen Anordnung
- 5.4 Endgültige Entscheidung vom 02. März 2010
- 5.5 Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
- 6. Schlussteil
- 7. Kurzer Ausblick auf die Online-Durchsuchung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert kritisch die Gesetzgebung zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, beleuchtet den historischen Kontext auf EU-Ebene und untersucht die Folgen des Eingreifens des Bundesverfassungsgerichts. Die Arbeit untersucht die politischen und rechtlichen Herausforderungen im Umgang mit digitaler Kommunikation.
- Historische Entwicklung der Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene
- Der Gesetzgebungsprozess in Deutschland und der Einfluss der EU
- Rechtliche und verfassungsrechtliche Kritik an der Vorratsdatenspeicherung
- Das Vetospielertheorem im Kontext der Gesetzgebung
- Ausblick auf die Online-Durchsuchung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der rasanten Verbreitung des Internets und die damit verbundenen Bestrebungen, das Kommunikationsnetz rechtlich zu regulieren. Sie führt in die Thematik der Vorratsdatenspeicherung ein, die im November 2007 in Deutschland gesetzlich verankert wurde und unmittelbar zu einer großen Verfassungsbeschwerde führte. Die Arbeit kündigt eine kritische Auseinandersetzung mit der Gesetzgebung und einen Ausblick auf die Online-Durchsuchung an.
2. Der lange Weg zur Vorratsdatenspeicherung: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte der Vorratsdatenspeicherung, beginnend mit Bestrebungen vor dem 11. September 2001, die primär auf die Bekämpfung von Kriminalität abzielten. Es wird der Einfluss der Terroranschläge von New York, Madrid und London auf die Entwicklung der EU-Richtlinie 2006/24/EG und die anschließende deutsche Gesetzgebung detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der schrittweisen Eskalation der Forderungen nach Datenspeicherung auf EU-Ebene und der Übernahme dieser Bestrebungen durch Deutschland.
3. Absehbares Scheitern: Dieses Kapitel befasst sich mit einer kritischen Analyse der Vorratsdatenspeicherung. Es definiert den Begriff, untersucht Unstimmigkeiten mit dem europäischen Vertragsrecht, den Verstoß gegen das Grundgesetz, die hohen Kosten und die unzureichende Datensicherung. Weiterhin werden die Möglichkeiten zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen, die leichte Umgehbarkeit des Systems und die schwerwiegenden Folgen der Datenspeicherung eingehend erläutert. Die Argumentation basiert auf einer Analyse einschlägiger Fachliteratur und zeigt die tiefgreifenden und umfassenden Möglichkeiten auf, die sich aus dem Gesetz ergaben.
4. Vorratsdatenspeicherung und Vetospielertheorem: Dieses Kapitel wendet das Vetospielertheorem an, um den Gesetzgebungsprozess kritisch zu beleuchten. Es wird gezeigt, wie der fortwährende Druck des Rates der Europäischen Union und die britische Ratspräsidentschaft die Vorratsdatenspeicherung auf europäischer Ebene beeinflussten. Der Fokus liegt auf der Darstellung des "Umwegs über Europa" als Strategie zur Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland.
5. Eingreifen des Bundesverfassungsgerichts: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess des Eingreifens des Bundesverfassungsgerichts, beginnend mit den Verfassungsbeschwerden, über die einstweiligen Anordnungen bis hin zur endgültigen Entscheidung vom 02. März 2010. Es wird detailliert dargestellt, wie das Gericht auf die rechtlichen Bedenken reagierte und welche Folgen sich auf deutscher und europäischer Ebene ergaben.
Schlüsselwörter
Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, Datenschutz, Grundrechte, Telekommunikationsüberwachung, Terrorismusbekämpfung, EU-Richtlinie 2006/24/EG, Bundesverfassungsgericht, Vetospielertheorem, Gesetzgebungsprozess, digitale Kommunikation, Rechtliche Regulierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert kritisch die Gesetzgebung zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Sie beleuchtet den historischen Kontext auf EU-Ebene und untersucht die Folgen des Eingreifens des Bundesverfassungsgerichts. Ein weiterer Fokus liegt auf den politischen und rechtlichen Herausforderungen im Umgang mit digitaler Kommunikation.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene, den Gesetzgebungsprozess in Deutschland und den Einfluss der EU, die rechtliche und verfassungsrechtliche Kritik an der Vorratsdatenspeicherung, das Vetospielertheorem im Kontext der Gesetzgebung und gibt einen Ausblick auf die Online-Durchsuchung.
Wie wird die Vorgeschichte der Vorratsdatenspeicherung dargestellt?
Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung beginnend mit Bestrebungen vor dem 11. September 2001. Es wird der Einfluss der Terroranschläge von New York, Madrid und London auf die Entwicklung der EU-Richtlinie 2006/24/EG und die anschließende deutsche Gesetzgebung detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der schrittweisen Eskalation der Forderungen nach Datenspeicherung auf EU-Ebene und der Übernahme dieser Bestrebungen durch Deutschland.
Welche Kritikpunkte an der Vorratsdatenspeicherung werden genannt?
Kapitel 3 kritisiert die Vorratsdatenspeicherung aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem europäischen Vertragsrecht, dem Verstoß gegen das Grundgesetz, hohen Kosten und unzureichender Datensicherung. Weitere Kritikpunkte sind die Möglichkeiten zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen, die leichte Umgehbarkeit des Systems und die schwerwiegenden Folgen der Datenspeicherung.
Welche Rolle spielt das Vetospielertheorem?
Kapitel 4 wendet das Vetospielertheorem an, um den Gesetzgebungsprozess zu analysieren. Es zeigt den Einfluss des Rates der Europäischen Union und der britischen Ratspräsidentschaft auf die Vorratsdatenspeicherung und die Strategie der Umsetzung in Deutschland über einen "Umweg über Europa".
Wie hat das Bundesverfassungsgericht reagiert?
Kapitel 5 beschreibt das Eingreifen des Bundesverfassungsgerichts, beginnend mit den Verfassungsbeschwerden, über die einstweiligen Anordnungen bis zur endgültigen Entscheidung vom 02. März 2010. Es werden die Reaktionen des Gerichts auf rechtliche Bedenken und die Folgen auf deutscher und europäischer Ebene dargestellt.
Was ist der Ausblick der Arbeit?
Die Arbeit gibt einen Ausblick auf die Online-Durchsuchung und die damit verbundenen rechtlichen und politischen Herausforderungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, Datenschutz, Grundrechte, Telekommunikationsüberwachung, Terrorismusbekämpfung, EU-Richtlinie 2006/24/EG, Bundesverfassungsgericht, Vetospielertheorem, Gesetzgebungsprozess, digitale Kommunikation, Rechtliche Regulierung.
- Quote paper
- André Herrmann (Author), 2010, Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166726