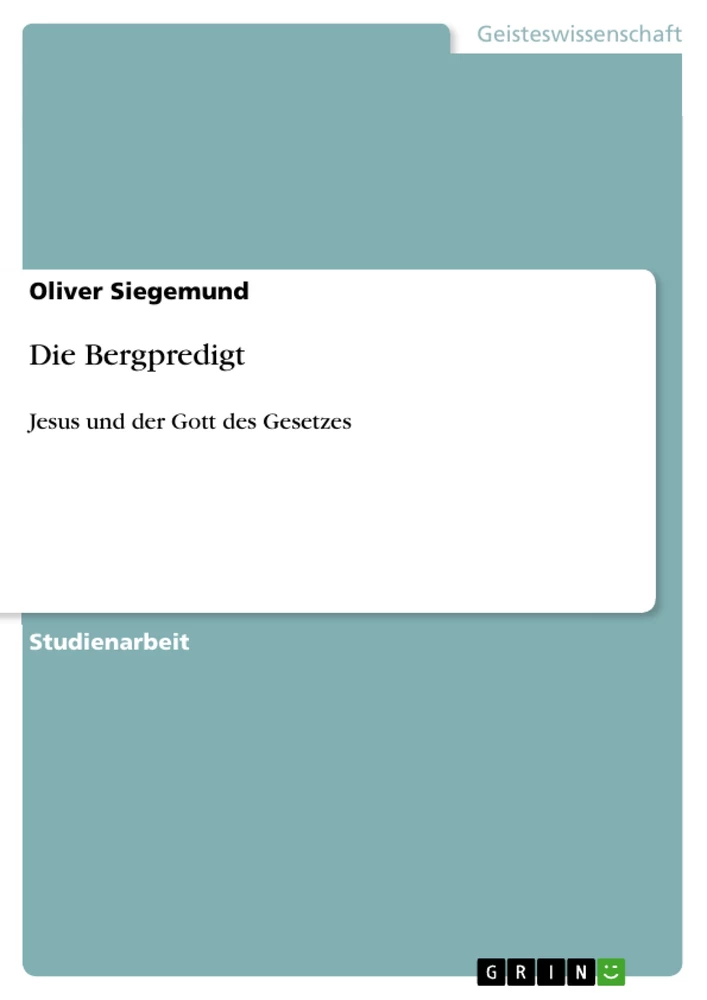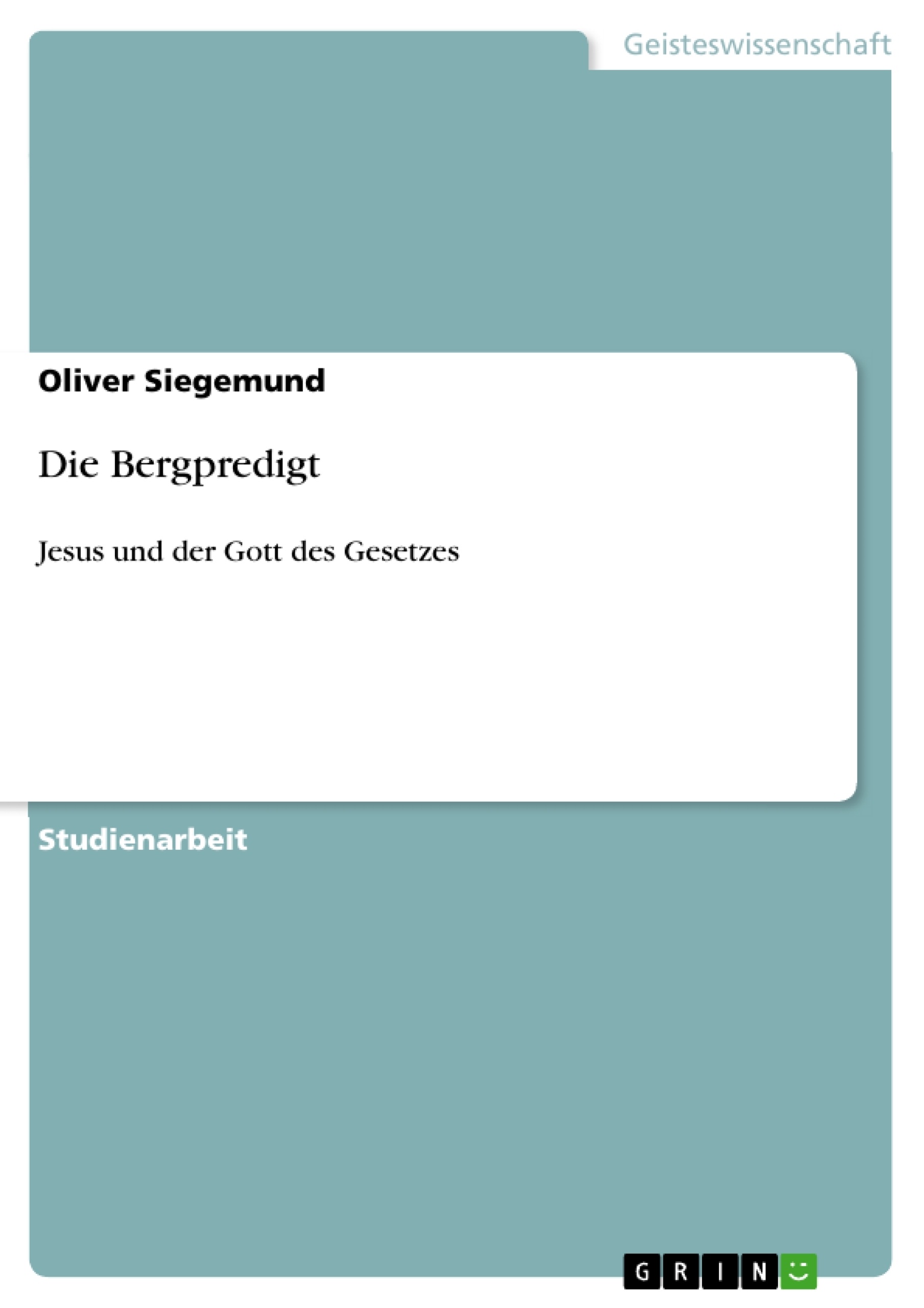Fast kein anderer Text der christlichen Literatur wurde öfter zitiert und ausgelegt, so dass es sich in Anbetracht der niederschmetternden Quantität an Literatur über die Bergpredigt etwas schwieriger gestalten lässt neue Forschungsimpulse liefern zu wollen. Überdies habe ich den Fokus dieser Arbeit deshalb enger fassen müssen, weil es nicht gelingen kann sämtliche Aspekte der Bergpredigt in einer Hauptseminararbeit abzuhandeln.
Herausheben möchte ich deshalb vier Schwerpunkte: Während die hermeneutischen Einleitungsfragen der historisch-kritischen Betrachtung Rechnung tragen und versuchen wollen die Ebene des historischen Jesus und des Verfassers zum umreißen, wird der zusammenfassende Abriss über die zwei besonders herausstechenden Elemente der Bergpredigt, die Seligpreisungen und die Antithesen, eine zusammengefasste Programmatik verdichten. Schließlich bildet die Verdichtung ein geeignete Basis den ethischen Deutungskanon der Bergpredigt auszubreiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einleitungsfragen zum Matthäusevangelium und der Bergpredigt
- 2.1. Autor, Abfassungszeit, -ort und Adressaten
- 2.2. Quellen
- 2.3. Aufbau
- 3. Theologische Betrachtung der Bergpredigt
- 3.1. Die Seligpreisungen (Mt 5,3-12) als Auftakt der Bergpredigt
- 3.2. Die Torakritik Jesu in den Antithesen
- 3.2.1. Die Legitimationsfrage
- 3.2.2. Zur Form der Antithesen
- 3.2.3. Der Inhalt der Antithesen
- 3.2.4. Ergebnis der inhaltlichen Prüfung auf Antithetik der Thesen
- 4. Auslegungstypen, Praxis und Realität
- 4.1. Die Bergpredigt als erfüllbare Forderung (schwärmerisch)
- 4.2. Die Bergpredigt als Gesetz und Evangelium (lutherisch)
- 4.3. Der religionsgeschichtliche Horizont der Bergpredigt (historisch-kritisch)
- 4.4. Die Bergpredigt unter dem Einfluss dialektischer Theologie
- 5. Schlussbetrachtung
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bergpredigt des Matthäusevangeliums. Ziel ist es, vier Schwerpunkte herauszuarbeiten: die historisch-kritische Betrachtung der Einleitungsfragen, die Analyse der Seligpreisungen und Antithesen als zentrale Elemente, sowie eine Auseinandersetzung mit verschiedenen ethischen Deutungsmustern. Die Arbeit fokussiert sich auf eine eingegrenzte Perspektive, da eine umfassende Behandlung aller Aspekte der Bergpredigt den Rahmen sprengen würde.
- Historisch-kritische Analyse der Bergpredigt
- Untersuchung der Seligpreisungen und Antithesen
- Ethische Deutung der Bergpredigt
- Vergleichende Betrachtung verschiedener Auslegungstypen
- Zusammenhang zwischen göttlichem Anspruch und weltlicher Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die umfangreiche vorhandene Literatur zur Bergpredigt und die Notwendigkeit, den Fokus auf ausgewählte Aspekte zu beschränken. Vier Schwerpunkte werden genannt: die hermeneutischen Einleitungsfragen, die Analyse der Seligpreisungen und Antithesen, sowie die ethische Deutung.
2. Einleitungsfragen zum Matthäusevangelium (MtEv) und der Bergpredigt: Dieses Kapitel befasst sich mit Fragen zur Autorschaft, Abfassungszeit, -ort und Adressaten des Matthäusevangeliums. Es wird die Zweiquellentheorie (Markus und Q-Quelle) erläutert und die jüdische Herkunft des Autors und seiner Adressaten anhand verschiedener Merkmale belegt (Stammbaum, Bezeichnung „Sohn Davids“, Zitate aus dem Alten Testament, Polemik gegen jüdische Autoritäten, etc.). Die Frage nach der Originalität der Bergpredigt als direkte Rede Jesu wird kritisch hinterfragt.
2.2. Quellen: Dieses Kapitel vertieft die Diskussion um die Quellen des Matthäusevangeliums und der Bergpredigt. Es wird die Zweiquellentheorie detailliert dargelegt, welche die Verwendung des Markusevangeliums und der hypothetischen Q-Quelle postuliert. Die Existenz von „minor agreements“ wird als Hinweis auf möglicherweise zwei Fassungen der Q-Quelle interpretiert. Die Bergpredigt in ihrer vorliegenden Form wird somit als redaktionelle Zusammenstellung wichtiger Jesusworte durch Matthäus verstanden.
Schlüsselwörter
Bergpredigt, Matthäusevangelium, Seligpreisungen, Antithesen, Torakritik, historisch-kritische Methode, Auslegungstypen, ethische Deutung, Zweiquellentheorie, Q-Quelle, göttliches Gesetz, weltliche Praxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Bergpredigt des Matthäusevangeliums"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bergpredigt des Matthäusevangeliums. Der Fokus liegt auf vier Schwerpunkten: der historisch-kritischen Betrachtung der Einleitungsfragen, der Analyse der Seligpreisungen und Antithesen als zentrale Elemente, sowie einer Auseinandersetzung mit verschiedenen ethischen Deutungsmustern. Eine umfassende Behandlung aller Aspekte der Bergpredigt wird aufgrund des Umfangs bewusst vermieden.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: historisch-kritische Analyse der Bergpredigt (Autorschaft, Abfassungszeit, Adressaten, Quellen), Untersuchung der Seligpreisungen und Antithesen (inkl. deren theologischer Bedeutung und Legitimationsfrage), ethische Deutung der Bergpredigt im Vergleich verschiedener Auslegungstypen (schwärmerisch, lutherisch, historisch-kritisch, dialektische Theologie) und den Zusammenhang zwischen göttlichem Anspruch und weltlicher Praxis.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine historisch-kritische Methode zur Analyse der Bergpredigt. Dies beinhaltet die Untersuchung der Quellen (Zweiquellentheorie, Q-Quelle), die Analyse des Kontextes (jüdische Tradition, Verhältnis zum Alten Testament) und die Auseinandersetzung mit verschiedenen Auslegungstraditionen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Einleitungsfragen zum Matthäusevangelium und der Bergpredigt (inkl. Autor, Abfassungszeit, Quellen und Aufbau), Theologische Betrachtung der Bergpredigt (Seligpreisungen und Antithesen), Auslegungstypen, Praxis und Realität, Schlussbetrachtung und Literaturverzeichnis.
Wie werden die Seligpreisungen und Antithesen behandelt?
Die Seligpreisungen und Antithesen werden als zentrale Elemente der Bergpredigt analysiert. Die Arbeit untersucht deren theologische Bedeutung, die Legitimationsfrage und die Form der Antithesen. Die inhaltliche Prüfung auf Antithetik der Thesen wird ebenfalls detailliert dargestellt.
Welche Auslegungstypen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Auslegungstypen der Bergpredigt: eine schwärmerische Auslegung als erfüllbare Forderung, eine lutherische Auslegung als Gesetz und Evangelium, eine historisch-kritische Auslegung unter Berücksichtigung des religionsgeschichtlichen Horizonts und eine Auslegung unter dem Einfluss der dialektischen Theologie.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bergpredigt, Matthäusevangelium, Seligpreisungen, Antithesen, Torakritik, historisch-kritische Methode, Auslegungstypen, ethische Deutung, Zweiquellentheorie, Q-Quelle, göttliches Gesetz, weltliche Praxis.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden sich im ausführlichen Inhaltsverzeichnis und in der Zusammenfassung der Kapitel innerhalb der Arbeit. Ein Literaturverzeichnis verweist auf weiterführende Literatur.
- Quote paper
- Oliver Siegemund (Author), 2010, Die Bergpredigt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166712