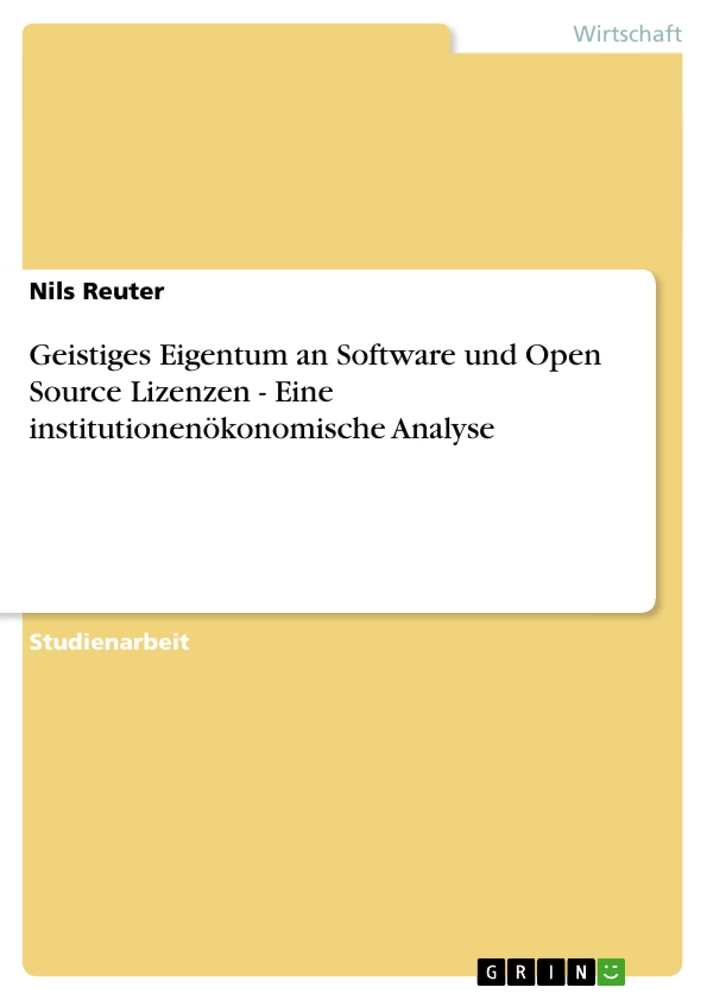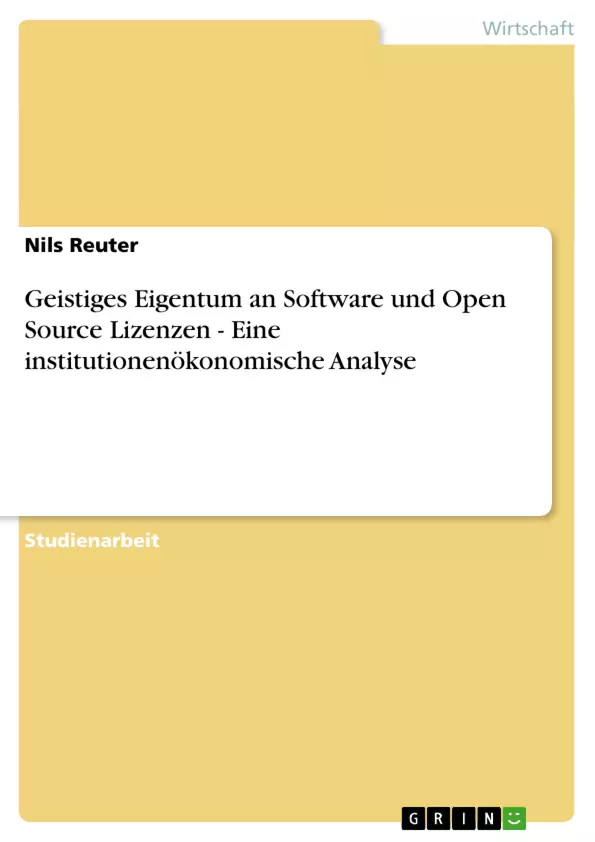Geistiges Eigentum besteht an Software heute in erster Linie durch das Urheberrecht.
Ökonomen sind sich weitgehend einig, daß solche Verfügungsrechte dazu geeignet und
erforderlich sind, Anreize zur Herstellung von Gütern zu schaffen.
Betrachtet man Open Source Projekte vor diesem Hintergrund, so fällt folgendes sofort auf:
Die Open Source Software Entwickler verzichten auf Verwertungsrechte und lassen andere,
ohne ein Entgelt zu verlangen, an der Nutzung teilhaben. Erklären könnte man dieses
Phänomen mit einem irrationalen Verhalten der Entwickler. Bedacht werden sollte aber, daß
es sich nicht nur um einige wenige „Verrückte“ handelt, sondern daß zum Beispiel sogar
einige größere Softwareunternehmen mittlerweile Engagement in der Open Source
Community zeigen. Man sollte das Verhalten daher nicht vorschnell als irrational abtun.
Will man das Bild des homo oeconomicus im Grundsatz aufrecht erhalten, muß man wohl
anerkennen, daß es auch Anreize zur Herstellung von Software gegeben kann, die nicht auf
Verfügungsrechten beruhen. Aber auch allein das erklärt noch nicht das Phänomen. Rational
handelnde Entwickler würden dennoch nicht freiwillig auf Verwertungsrechte verzichten, es
sei denn, die Anreize dazu sind noch stärker ausgeprägt, als die, die durch Verfügungsrechte
bedingt sind.
Jedenfalls gibt das Phänomen der Open Source Software dem Ökonomen genügend Anlaß,
die Frage des geistigen Eigentums an Software neu zu stellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Einführung in die Problematik
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Das Informationsdilemma
- 1.3 Das Untersuchungsprogramm
- 2 Institutionenökonomische Referenzbasis
- 2.1 Der Institutionenbegriff
- 2.2 Ökonomische Modelle zur Analyse von Institutionen
- 2.3 Normative Festlegung: Wie Institutionen ausgestaltet sein sollten
- 3 Analyse des Urheberrechtsschutzes von Software
- 3.1 Charakteristik
- 3.2 Transaktionskosten
- 3.3 Allokationswirkung (auf der nachgelagerten Stufe)
- 3.4 Anreizwirkung
- 3.5 Ergebnis
- 4 Open Source Lizenzen im bestehenden rechtlichen Rahmen
- 4.1 Charakteristik der Open Source Lizenzen
- 4.2 Transaktionskosten
- 4.3 Allokationswirkung
- 4.4 Anreizwirkung
- 4.5 Interdependenzen
- 5 Institutionelle Alternativen
- 5.1 Verzicht auf Urheberrechtsschutz für Software
- 5.2 Verstärkte Durchsetzung des Urheberrechtsschutzes
- 5.3 Verpflichtung zur Offenlegung von Schnittstellenspezifikationen
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ökonomischen Auswirkungen des Urheberrechts auf Software und analysiert das Phänomen von Open-Source-Lizenzen. Ziel ist es, die Anreizwirkungen beider Systeme zu vergleichen und mögliche institutionelle Alternativen zu erörtern, die das Informationsdilemma im Kontext von Software besser lösen könnten. Die Arbeit konzentriert sich auf die institutionenökonomische Perspektive.
- Analyse des Urheberrechtsschutzes von Software und dessen ökonomischer Auswirkungen.
- Untersuchung der Anreizwirkungen von Open-Source-Lizenzen.
- Vergleich der Transaktionskosten bei urheberrechtlich geschützter und Open-Source-Software.
- Bewertung der Allokations- und Anreizwirkungen beider Systeme.
- Diskussion möglicher institutioneller Alternativen zur Optimierung der Softwarebereitstellung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Einführung in die Problematik: Der Text beginnt mit einer Einführung in das Thema geistiges Eigentum an Software, wobei der Fokus auf dem Widerspruch zwischen dem traditionellen Urheberrecht und dem Auftreten von Open-Source-Software liegt. Das Informationsdilemma wird als zentrales Problem dargestellt: die Schwierigkeit, gleichzeitig Anreize für die Softwareentwicklung und eine optimale Allokation der Software zu schaffen. Der Autor stellt die These auf, dass Open-Source-Software trotz des Verzichts auf Verwertungsrechte eine ausreichende Anreizwirkung für Entwickler bietet, was eine Neubewertung des geistigen Eigentums an Software notwendig macht. Das Untersuchungsprogramm skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit.
2 Institutionenökonomische Referenzbasis: Dieses Kapitel legt die institutionenökonomische Grundlage der Arbeit dar. Es werden verschiedene Institutionenbegriffe und ökonomische Modelle zur Analyse von Institutionen eingeführt und die normative Frage nach der optimalen Gestaltung von Institutionen diskutiert. Dies bildet die theoretische Basis für die spätere Analyse des Urheberrechts und der Open-Source-Lizenzen.
3 Analyse des Urheberrechtsschutzes von Software: Dieses Kapitel analysiert den Urheberrechtsschutz von Software im Detail. Es beschreibt den Schutzgegenstand, die Schutzrechte, die Durchsetzung des Schutzes und die damit verbundenen Transaktionskosten. Die Allokations- und Anreizwirkungen des Urheberrechts werden kritisch beleuchtet, unter Berücksichtigung der nachgelagerten Stufe der Nutzung. Das Kapitel mündet in einer Bewertung der Effektivität des Urheberrechtsschutzes im Hinblick auf die angestrebten Ziele.
4 Open Source Lizenzen im bestehenden rechtlichen Rahmen: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse von Open-Source-Lizenzen. Es definiert Open-Source-Software, kategorisiert verschiedene Lizenztypen und präsentiert Beispiele. Die Analyse konzentriert sich auf die Transaktionskosten, die Allokations- und Anreizwirkungen von Open-Source-Lizenzen im Vergleich zum Urheberrechtsschutz. Die Interdependenzen zwischen verschiedenen Lizenzen und das Zusammenspiel mit dem bestehenden rechtlichen Rahmen werden betrachtet.
5 Institutionelle Alternativen: Dieser Abschnitt beleuchtet mögliche institutionelle Alternativen zum bestehenden System. Der Verzicht auf Urheberrechtsschutz, eine verstärkte Durchsetzung des Urheberrechts und die Verpflichtung zur Offenlegung von Schnittstellenspezifikationen werden als Optionen diskutiert und jeweils hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile bewertet. Diese Optionen werden im Kontext des Informationsdilemmas und der zuvor analysierten Systeme betrachtet.
Schlüsselwörter
Geistiges Eigentum, Software, Open Source Lizenzen, Urheberrecht, Informationsdilemma, Institutionenökonomie, Transaktionskosten, Allokation, Anreizwirkungen, institutionelle Alternativen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ökonomische Auswirkungen des Urheberrechts auf Software und Open-Source-Lizenzen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die ökonomischen Auswirkungen des Urheberrechts auf Software und analysiert Open-Source-Lizenzen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Anreizwirkungen beider Systeme und der Erörterung möglicher institutioneller Alternativen zur besseren Lösung des Informationsdilemmas im Kontext von Software. Die Analyse erfolgt aus institutionenökonomischer Perspektive.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem den Institutionenbegriff, ökonomische Modelle zur Institutionenanalyse, die Charakteristik des Urheberrechtsschutzes von Software (inkl. Transaktionskosten, Allokations- und Anreizwirkungen), die Charakteristik von Open-Source-Lizenzen (ebenfalls mit Transaktionskosten, Allokations- und Anreizwirkungen), Interdependenzen zwischen Lizenzen und mögliche institutionelle Alternativen wie den Verzicht auf Urheberrechtsschutz, verstärkte Durchsetzung des Urheberrechts oder die Verpflichtung zur Offenlegung von Schnittstellenspezifikationen.
Was ist das Informationsdilemma im Kontext von Software?
Das Informationsdilemma beschreibt den Widerspruch zwischen dem Bedarf an Anreizen für die Softwareentwicklung und dem Ziel einer optimalen Allokation der Software. Es ist schwierig, gleichzeitig Anreize für die Entwicklung zu schaffen und den Zugang zu Software für alle zu gewährleisten.
Wie werden Urheberrechtsschutz und Open-Source-Lizenzen verglichen?
Der Vergleich erfolgt anhand von institutionenökonomischen Kriterien, insbesondere Transaktionskosten, Allokations- und Anreizwirkungen. Die Arbeit untersucht, wie effektiv beide Systeme Anreize für die Entwicklung setzen und Software optimal verteilen. Dabei wird auch die nachgelagerte Nutzung von Software berücksichtigt.
Welche institutionellen Alternativen werden diskutiert?
Es werden drei institutionelle Alternativen diskutiert: Der vollständige Verzicht auf Urheberrechtsschutz für Software, eine verstärkte Durchsetzung des bestehenden Urheberrechts und die Verpflichtung zur Offenlegung von Schnittstellenspezifikationen. Jede Option wird hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile im Kontext des Informationsdilemmas bewertet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung und Einführung in die Problematik, Institutionenökonomische Referenzbasis, Analyse des Urheberrechtsschutzes von Software, Open Source Lizenzen im bestehenden rechtlichen Rahmen, Institutionelle Alternativen und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geistiges Eigentum, Software, Open Source Lizenzen, Urheberrecht, Informationsdilemma, Institutionenökonomie, Transaktionskosten, Allokation, Anreizwirkungen, institutionelle Alternativen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss (genaueres Fazit im Kapitel 6), dass die Open-Source-Software trotz des Verzichts auf Verwertungsrechte eine ausreichende Anreizwirkung für Entwickler bietet. Dies erfordert eine Neubewertung des geistigen Eigentums an Software und die kritische Auseinandersetzung mit den institutionellen Rahmenbedingungen.
- Citation du texte
- Nils Reuter (Auteur), 2003, Geistiges Eigentum an Software und Open Source Lizenzen - Eine institutionenökonomische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16665