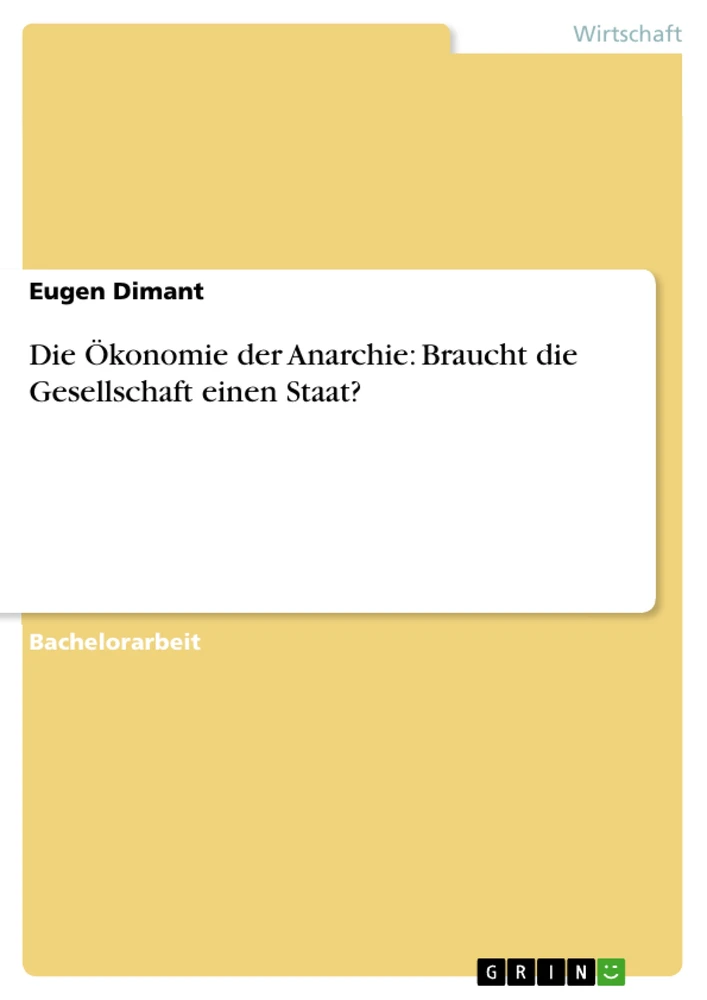In Zeiten von wirtschaftlichen Krisen, Bankenkollapsen und Rezessionsängsten wird die Frage laut, wie wirksam staatliche Interventionen sind, inwiefern sie ausgeweitet oder be-grenzt werden sollten und ob überhaupt ein System staatlicher Regulierungen den gestellten Anforderungen gerecht wird.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich die staatlichen Interventionen in ihrer Vielfalt vergrößert. Der Staat schützt nicht mehr lediglich vor Raub und sichert das Eigentum eines jeden Individuums, welches im Einflussbereich des Staates ist. Vielmehr sind nun auch Rassendiskriminierung sowie unternehmensspezifische Regulierungen Gegenstand präsenter staatlicher Eingriffe [Becker 1968: S. 169]. Als ökonomische Rechtfertigung dient dabei das Selektionsprinzip, welches von Hans-Werner Sinn, einem der anerkanntesten deutschen Ökonomen, definiert wurde: „Das Selektionsprinzip besagt, dass Staaten jene ökonomische Aktivitäten übernommen haben, für deren Erledigung sich der private Markt als unfähig erwies.“ [Sinn 1997: S. 248]. Dadurch ergibt sich nach Sinn für den Staat die Implikation, dass dieser als essentielles Glied in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen muss, um die Unzulänglichkeit privater Institutionen auszugleichen.
Beispielhaft hierfür ist die Entwicklung der Staatsquote in Deutschland. Seit 1960 hat die Staatsquote bedingt durch Sozialreformen von 32,9% auf 48,5% (2003) zugenommen. Der von Bundesfinanzminister Steinbrück vorangetriebene Konsolidierungskurs führt nun erst seit 2004 zu einer stetigen Abnahme dieser Quote und rangierte im Jahr 2007 bei 43,8%. Allgemeine ökonomische Ansätze vertreten dabei den Standpunkt, dass eine adäquate Absenkung der Staatsquote „als positiv für das Wirtschaftswachstum eingeschätzt“ werden kann [Bundesinnenministerium für Finanzen 2008]. Daher ist die Staatsquote, zumindest der Theorie nach, ein Kalkül, um die Einfluss staatlicher Interventionen auf das wirtschaftliche System zu messen.
Vor dem Hintergrund des aktuellen wirtschaftlichen Zusammenbruchs, welcher zumindest teilweise Ausdruck eines Staatsversagens ist, ist es allerdings fraglich, ob die abnehmenden staatlichen Eingriffe zu mehr Prosperität führen.
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung und Gliederung der Arbeit.
- Ökonomische Konzeptionen in der Anarchie
- Die zwei Sichtweisen in der ökonomischen Lehre der Anarchie
- Ökonomische Betrachtung von Kooperation
- Kritische Folgerungen aus der Anarchie.
- Staatliches System als Status Quo
- Staatliche Evolution aus der Kooperation: Eine modelltheoretische Analyse .....
- Wirtschaftliche und soziale Begründung staatlicher Interventionen
- Auflösung des staatlichen Verbundes
- Motive und Rechtfertigungsgründe für die Wiederabschaffung des Staates .....
- Konzeption eines Minimalstaates als alternative Herrschaftsform
- Zusammenfassung und Politikimplikationen....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Anarchie eine mögliche und optimalitätsfördernde Alternative zu einem Staat darstellt. Es wird untersucht, wie die Ökonomie der Anarchie beschaffen ist und welche grundlegenden Anforderungen an ein solches staatsfreies System gestellt werden müssen. Die Arbeit analysiert die verschiedenen ökonomischen Konzeptionen der Anarchie und beleuchtet die Bedingungen für die Entstehung von Kooperation in einem staatsfreien System. Außerdem werden die Argumente für und gegen den Staat sowie die Möglichkeiten eines Minimalstaates als Kompromiss zwischen Anarchie und Staat erörtert.
- Die ökonomischen Konzeptionen der Anarchie
- Kooperation in einem staatsfreien System
- Die Entstehung des Staates aus dem anarchischen Zustand
- Die Rechtfertigung staatlicher Interventionen
- Die Möglichkeit eines Minimalstaates
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beleuchtet die formale Konzeption der Anarchie und erörtert die aktuelle Relevanz der thematischen Diskussionen über die Anarchie sowie deren ökonomische Grundlagen. Dabei werden wichtige ökonomische Grundsätze der Anarchie ausgeführt und Bedingungen für die Entstehung von Kooperation in einem staatsfreien System näher beleuchtet. Abschließend wird ein Überblick über die Prämissen der Anarchie gegeben und fundamentale Kritik an diesen geübt.
Das dritte Kapitel thematisiert das staatliche System und beleuchtet wissenschaftliche Ansichten, welche die Entstehung eines Staates aus dem anarchischen Zustand als Kausalitätskette verstehen. Dabei werden die Anforderungen, die an einen Staat gestellt werden, behandelt und deren Problematik dargelegt. Hierbei soll auch die ökonomische Diskussion über den Umfang von staatlichen Interventionen und deren Rechtfertigung im Blickpunkt stehen.
Das vierte Kapitel führt mögliche Gründe für die Wiederabschaffung des Staates auf und erörtert zum Abschluss den Minimalstaat als mögliche Alternative zwischen den Extremen von Anarchie und Staat. Abschließend dient die Schlussbemerkung als kritischer Rückblick auf die behandelte Thematik und wird durch Politikimplikationen abgerundet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Wirtschaftswissenschaft, insbesondere mit den Konzepten der Anarchie und des Staates. Es werden wichtige ökonomische Prinzipien wie Kooperation, Wohlfahrtsförderung und staatliche Interventionen beleuchtet. Die Arbeit betrachtet die Rolle von Information, Marktversagen und staatlicher Regulierung in der Wirtschaft. Im Fokus stehen außerdem die Entwicklung der Staatsquote, das Selektionsprinzip und die Public Choice Theorie.
Häufig gestellte Fragen
Kann eine Gesellschaft ohne Staat funktionieren?
Die Arbeit untersucht ökonomische Konzeptionen der Anarchie und analysiert, unter welchen Bedingungen Kooperation in einem staatsfreien System entstehen kann.
Was besagt das "Selektionsprinzip" nach Hans-Werner Sinn?
Es besagt, dass der Staat jene ökonomischen Aktivitäten übernimmt, bei denen der private Markt versagt hat, um die Unzulänglichkeit privater Institutionen auszugleichen.
Was ist ein Minimalstaat?
Ein Minimalstaat ist eine alternative Herrschaftsform, die staatliche Eingriffe auf ein absolutes Minimum (z. B. Schutz von Eigentum und Sicherheit) reduziert, um Prosperität zu fördern.
Wie hat sich die Staatsquote in Deutschland entwickelt?
Die Staatsquote stieg von 32,9 % im Jahr 1960 auf 48,5 % im Jahr 2003 an, bevor sie durch Konsolidierungskurse wieder leicht sank.
Was ist die Public-Choice-Theorie?
Diese Theorie wendet ökonomische Methoden auf die Politik an und untersucht, wie politische Entscheidungen durch die Eigeninteressen von Akteuren und staatliche Regulierungen beeinflusst werden.
- Citation du texte
- Eugen Dimant (Auteur), 2009, Die Ökonomie der Anarchie: Braucht die Gesellschaft einen Staat?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165867