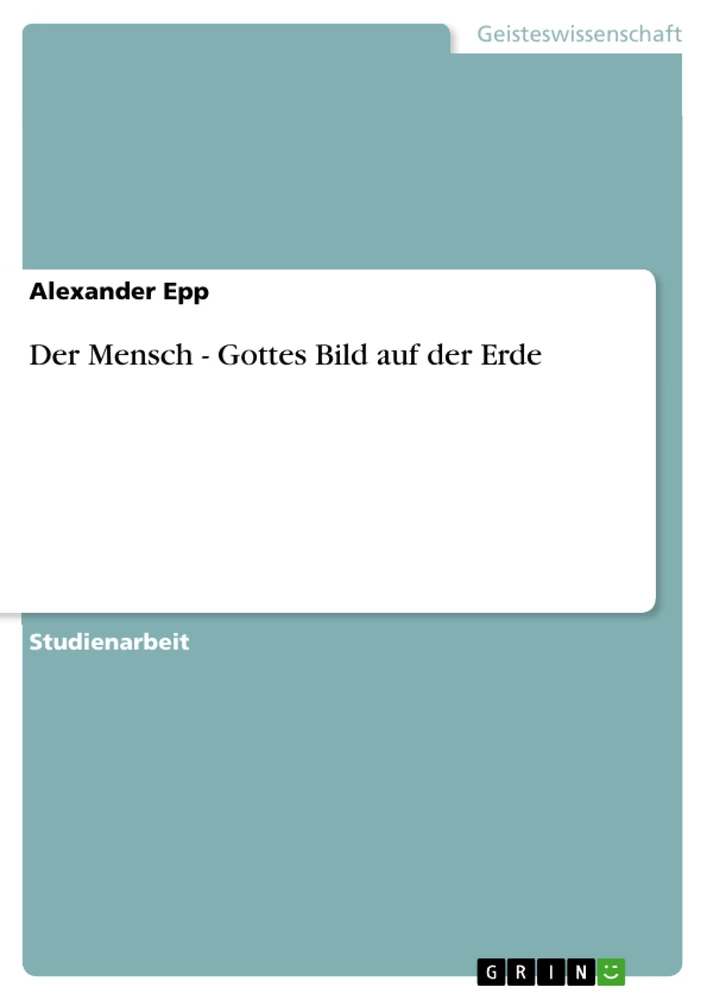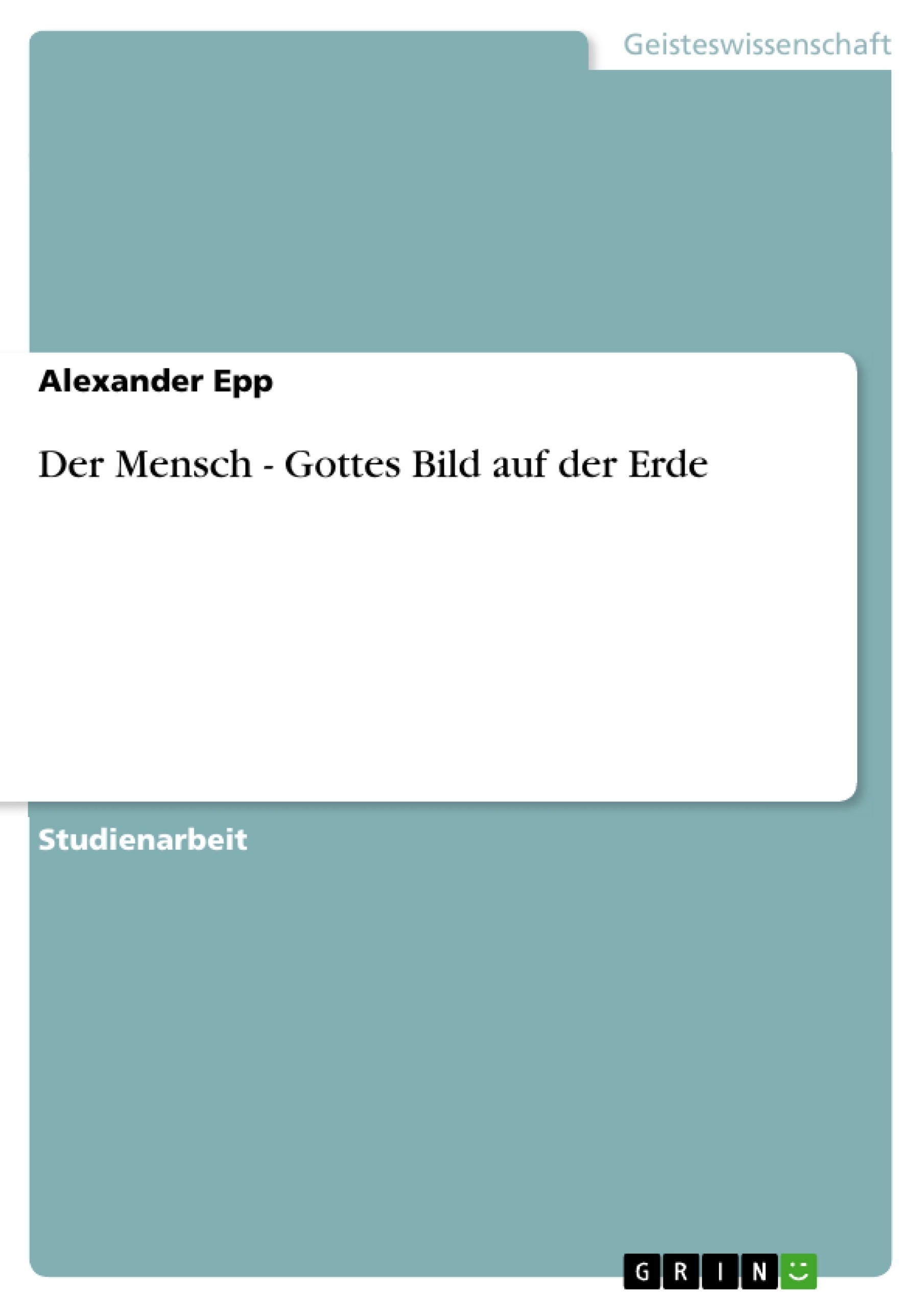Was ist und bewirkt die Ebenbildlichkeit Gottes, die den Menschen vom Rest der Schöpfung unterscheiden sollte? Ist nun das „Bild, das Gott ähnlich sei“ eine analogia entis – eine Entsprechung im Sein, oder eine analogia relationis – eine Entsprechung in der Beziehung? Diese und weitere Fragen und Gedanken können entstehen, wenn man sich den Auszug aus dem biblischen Schöpfungsbericht durchliest, welche die Erschaffung des Menschen beschreibt.
„Und Gott sprach: Wir wollen Menschen machen nach unserm Bild uns ähnlich; die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht!“
Um einige Fragen zu diesem biblischen Textabschnitt zu beantworten und Gedanken zu diesem Abschnitt zu sammeln, werde ich in dieser Hausarbeit die Antworten und Ansichten einiger Autoren anführen, die sich mit der Bedeutung dieser Bibelstelle auseinandergesetzt haben. Dieser Hausarbeit zugrundegelegt werden jedoch Dietrich Bonhoeffers Gedanken in seinem Aufsatz „Das Bild Gottes auf Erden“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitend
- Die Schöpfung, ausgenommen der Mensch, ist nicht Ebenbild Gottes
- Zur Tragweite der Schöpfungsworte „Lasset uns.../ Wir wollen...“
- Was ist die Ebenbildlichkeit des Menschen?
- Das Paradoxon der geschaffenen Freiheit
- Ebenbildlichkeit = analogia entis oder analogia relationis?
- Freiheit für Gott ist Freiheit vom Rest der Schöpfung!
- Die verlorene Gottebenbildlichkeit
- Eigene Stellungnahme zur Ebenbildlichkeit des Menschen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung der Aussage „Gott schuf den Menschen nach seinem Bild“, die im ersten Schöpfungsbericht der Bibel vorkommt. Sie befasst sich mit der Frage, was die Ebenbildlichkeit Gottes für den Menschen bedeutet und wie sie sich von der restlichen Schöpfung unterscheidet. Die Arbeit analysiert die Ansichten verschiedener Theologen, insbesondere Dietrich Bonhoeffers, und beleuchtet die verschiedenen Interpretationen dieses zentralen Themas.
- Untersuchung der Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen im Kontext des biblischen Schöpfungsberichts
- Analyse der Ansichten verschiedener Theologen, insbesondere Dietrich Bonhoeffers, zur Ebenbildlichkeit
- Diskussion der Bedeutung des Schöpfungsberichts im Plural „Lasset uns...“
- Einordnung der Ebenbildlichkeit des Menschen im Verhältnis zu anderen Schöpfungsgeschöpfen
- Untersuchung des Begriffs der Freiheit im Kontext der Ebenbildlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitend: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung der Ebenbildlichkeit Gottes für den Menschen und den Unterschied zur restlichen Schöpfung. Sie definiert die grundlegende Problematik und die Relevanz des Themas.
- Die Schöpfung, ausgenommen der Mensch, ist nicht Ebenbild Gottes: Dieser Abschnitt analysiert Bonhoeffers Ansicht, dass die Schöpfung, mit Ausnahme des Menschen, nicht Ebenbild Gottes sein kann. Bonhoeffer argumentiert, dass Gottes Werk zwar seine Gestalt trägt, aber in seiner Lebendigkeit tot ist, da es nicht frei ist.
- Zur Tragweite der Schöpfungsworte „Lasset uns.../ Wir wollen...“: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Plurals in der Schöpfungsgeschichte, der bei der Erschaffung des Menschen zum ersten Mal verwendet wird. Bonhoeffer deutet dies als Ausdruck der Freiheit in der Erschaffung des Menschen.
- Was ist die Ebenbildlichkeit des Menschen?: Das Kapitel behandelt die Frage nach dem Wesen der Ebenbildlichkeit des Menschen und untersucht verschiedene Interpretationen.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Ebenbildlichkeit, Schöpfungsbericht, Dietrich Bonhoeffer, Freiheit, Analogia entis, Analogia relationis, Mensch, Gott, Schöpfung, Plural, „Lasset uns...“, biblische Interpretation.
- Citar trabajo
- Alexander Epp (Autor), 2009, Der Mensch - Gottes Bild auf der Erde, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165790