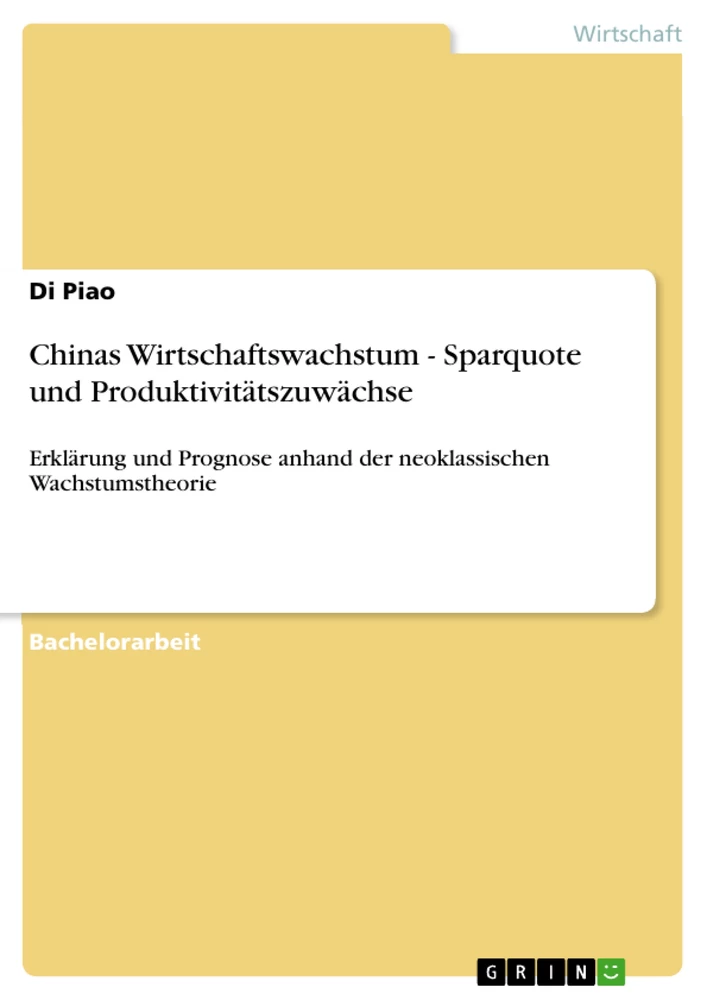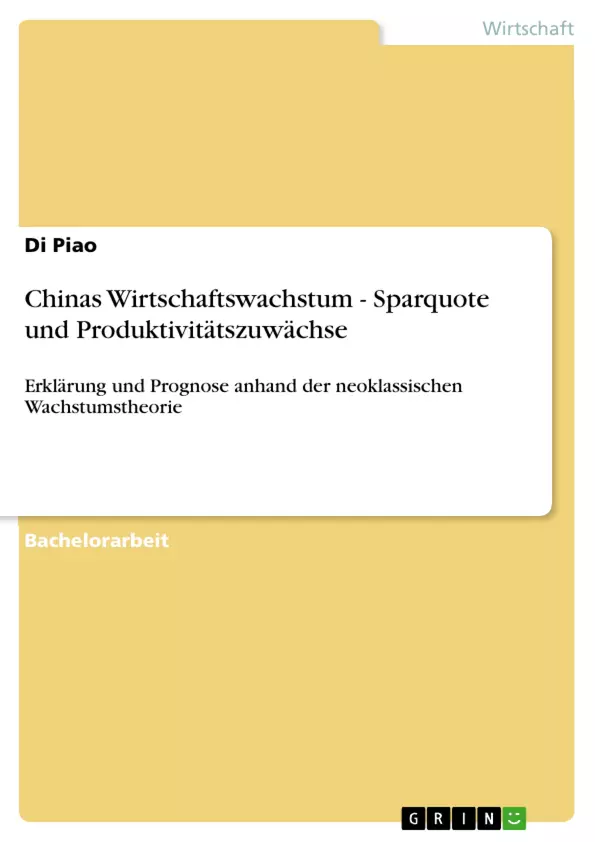„Crossing the river by touching the stones”
“Reform ohne Verlierer”
So lauteten die Leitsätze zum chinesischen Reformbeginn im Jahre 1978, eingeleitet durch den damaligen Landesführer der Volksrepublik China, Deng Xiaoping. Er definierte eine klare Zielsetzung bezüglich des Transformationsprozesses des damaligen, landwirtschaftlich dominierten Staates. Diese lautete, eine „around-well-off-society“ zu kreieren und führte zur obersten Priorität, ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen jedes Einwohners zu garantieren, das eine Existenz zwischen Überleben und Wohlstand sichern sollte, ungeachtet der regionalen Position innerhalb des Staates. Dazu griff man auf die Methodik des experimentellen Gradualismus zurück, der einen so genannten „dual track approach“ mit einschloss. Es wurden parallel zur Freigabe von marktwirtschaftlichen Aktivitäten fortführend planwirtschaftliche Strukturen aufrechterhalten, um eine Schocktransformation, wie beispielsweise in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, zu vermeiden. Das heutige Resultat spiegelt sich in einer rekordträchtigen, stabilen Wachstumsrate innerhalb der letzten drei Dekaden wider. Heute zählt China zur viertgrößten Volkswirtschaft und drittgrößten Handelsnation der Welt. Es konnte im Zeitverlauf die mit Abstand größten Devisenreserven bilden, zählt die größten Banken der Welt zu seinen Eigenen und rangiert in zahlreichen Wirtschaftsbranchen auf dem ersten Platz der internationalen Ökonomie. An diesem Punkt lässt sich die grundlegende Frage nach dem chinesischen Erfolgsrezept aufwerfen, die im Zuge dieser Arbeit beantwortet werden soll. Hierfür dient als Basis die neoklassische Theorie zur Erklärung langfristigen Wachstums einer Ökonomie, entwickelt in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Dieses wird im zweiten Kapitel ausführlich thematisiert. Das darauf folgende dritte Kapitel erläutert im Groben die wichtigsten China-typischen Merkmale, die die hauptverantwortlichen Komponenten der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes darstellten. Im Anschluss darauf werden im vierten Kapitel diese Faktoren mit den grundlegenden Mechanismen der Theorie in Interaktion gesetzt, um den Bestandteilen des chinesischen Wirtschaftswachstums eine klare Gewichtung beizumessen, deren Einfluss zu verifizieren und eine Prognose für zukünftige Entwicklungen zu erstellen. Das Schlusslicht dieser Thesis bilden das Fazit sowie das Literaturverzeichnis in den jeweiligen Kapiteln fünf und sechs.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die neoklassische Wachstumstheorie
- 2.1. Die Entwicklung des Modells
- 2.2. Wechselwirkung zwischen Produktion und Kapitalakkumulation
- 2.2.1. Das langfristige Gleichgewicht
- 2.2.2. Der Einfluss der Sparquote
- 2.3. Der technische Fortschritt
- 2.3.1. Humankapital
- 2.4. Das Solow-Residuum
- 3. Der chinesische Wachstumsmechanismus
- 3.1. Faktor Kapital
- 3.1.1. Investitionsdynamik und Staatsunternehmen
- 3.1.2. Makropolitische Faktoren
- 3.1.3. Das chinesische Sparverhalten
- 3.2. Faktor Arbeit
- 3.2.1. Demografie und Arbeitsmarktstruktur
- 3.2.2. Sektoraler Strukturwandel
- 3.3. Faktor technischer Fortschritt
- 3.3.1. Diffusion und Innovationskraft
- 3.3.2. Humankapitalbildung
- 3.1. Faktor Kapital
- 4. Analyse
- 4.1. Produktivitätszuwächse durch Kapitalakkumulation und steigende effektive Arbeit
- 4.2. Produktivitätszuwächse durch Populationswachstum und Humankapitalbildung
- 4.3. Risiken durch mögliche Wachstumsbarrieren
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erklärung und Prognose des chinesischen Wirtschaftswachstums anhand der neoklassischen Wachstumstheorie. Sie untersucht, inwiefern die Theorie die beeindruckende Entwicklung der chinesischen Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten erklären kann und welche Faktoren zukünftig eine wichtige Rolle spielen werden.
- Analyse des chinesischen Wachstumsmodells
- Bedeutung der neoklassischen Wachstumstheorie für die Erklärung des chinesischen Wirtschaftswachstums
- Rolle von Kapitalakkumulation, technischem Fortschritt und Humankapital
- Identifizierung möglicher Risiken und Wachstumsbarrieren
- Prognose der zukünftigen Entwicklung des chinesischen Wirtschaftswachstums
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit vor. Sie beleuchtet den historischen Kontext des chinesischen Reformbeginns 1978 und die Bedeutung des Wirtschaftswachstums für die Entwicklung der Volksrepublik China. Anschließend wird die neoklassische Wachstumstheorie im Detail vorgestellt, wobei die wichtigsten Elemente und Konzepte erläutert werden.
Das dritte Kapitel widmet sich den Besonderheiten des chinesischen Wachstumsmodells. Es analysiert die Faktoren, die den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas beflügelt haben, insbesondere die Bedeutung von Kapitalakkumulation, dem Einfluss der staatlichen Wirtschaftspolitik und dem Sparverhalten der Bevölkerung. Außerdem werden die demografische Entwicklung und die Veränderung der Arbeitsmarktstruktur sowie die Rolle des technischen Fortschritts und der Humankapitalbildung beleuchtet.
Das vierte Kapitel untersucht die Interaktion der im vorherigen Kapitel dargestellten Faktoren mit den Mechanismen der neoklassischen Wachstumstheorie. Es werden die produktivitätsfördernden Effekte von Kapitalakkumulation, Humankapitalbildung und technischem Fortschritt analysiert und mögliche Risiken und Wachstumsbarrieren betrachtet.
Schlüsselwörter
Chinesisches Wirtschaftswachstum, neoklassische Wachstumstheorie, Kapitalakkumulation, technischer Fortschritt, Humankapital, Sparquote, Investitionsdynamik, Staatsunternehmen, demografische Entwicklung, Arbeitsmarktstruktur, Sektoraler Strukturwandel, Innovationskraft, Produktivitätszuwächse, Wachstumsbarrieren.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Erfolgsrezept des chinesischen Wirtschaftswachstums?
Chinas Wachstum basierte auf dem experimentellen Gradualismus, dem "Dual Track Approach" und einer massiven Kapitalakkumulation durch hohe Sparquoten.
Was besagt die neoklassische Wachstumstheorie?
Sie erklärt langfristiges Wachstum durch die Faktoren Kapital, Arbeit und technischen Fortschritt (Solow-Modell).
Welche Rolle spielt die Sparquote in China?
Die außergewöhnlich hohe Sparquote ermöglichte enorme Investitionen in die Infrastruktur und Staatsunternehmen, was das BIP-Wachstum über Jahrzehnte stützte.
Was bedeutet "Dual Track Approach"?
Es beschreibt das parallele Bestehen von planwirtschaftlichen Strukturen und marktwirtschaftlichen Aktivitäten, um eine Schocktransformation zu vermeiden.
Welche Risiken könnten Chinas Wachstum bremsen?
Mögliche Barrieren sind der demografische Wandel, abnehmende Grenzerträge des Kapitals und die Notwendigkeit, von Imitation zu echter Innovation überzugehen.
- Citar trabajo
- Di Piao (Autor), 2010, Chinas Wirtschaftswachstum - Sparquote und Produktivitätszuwächse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165682