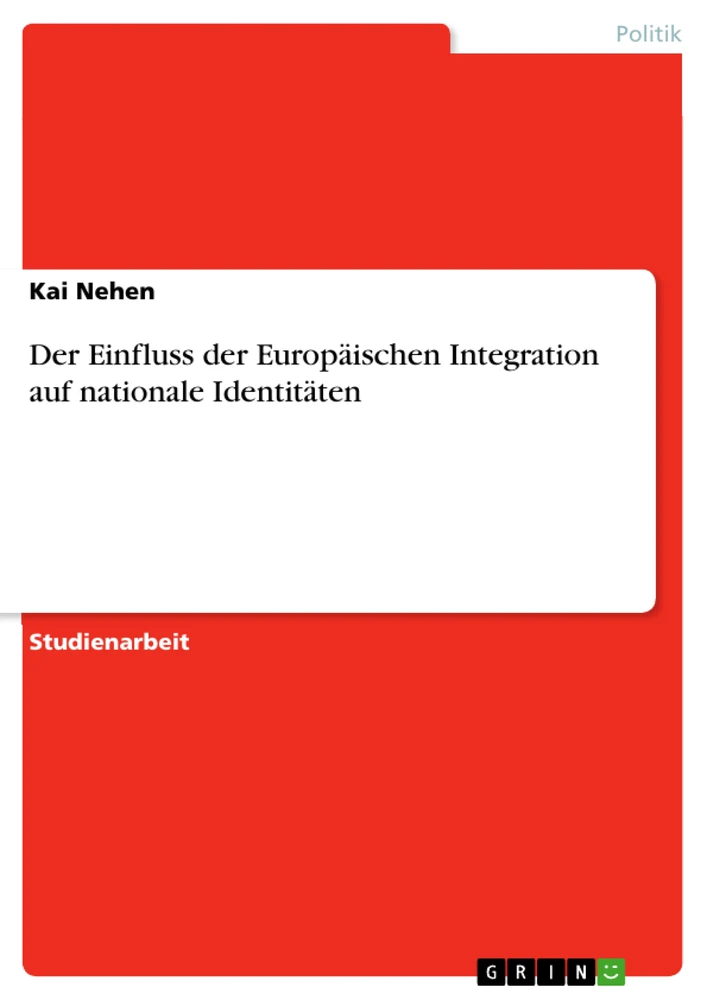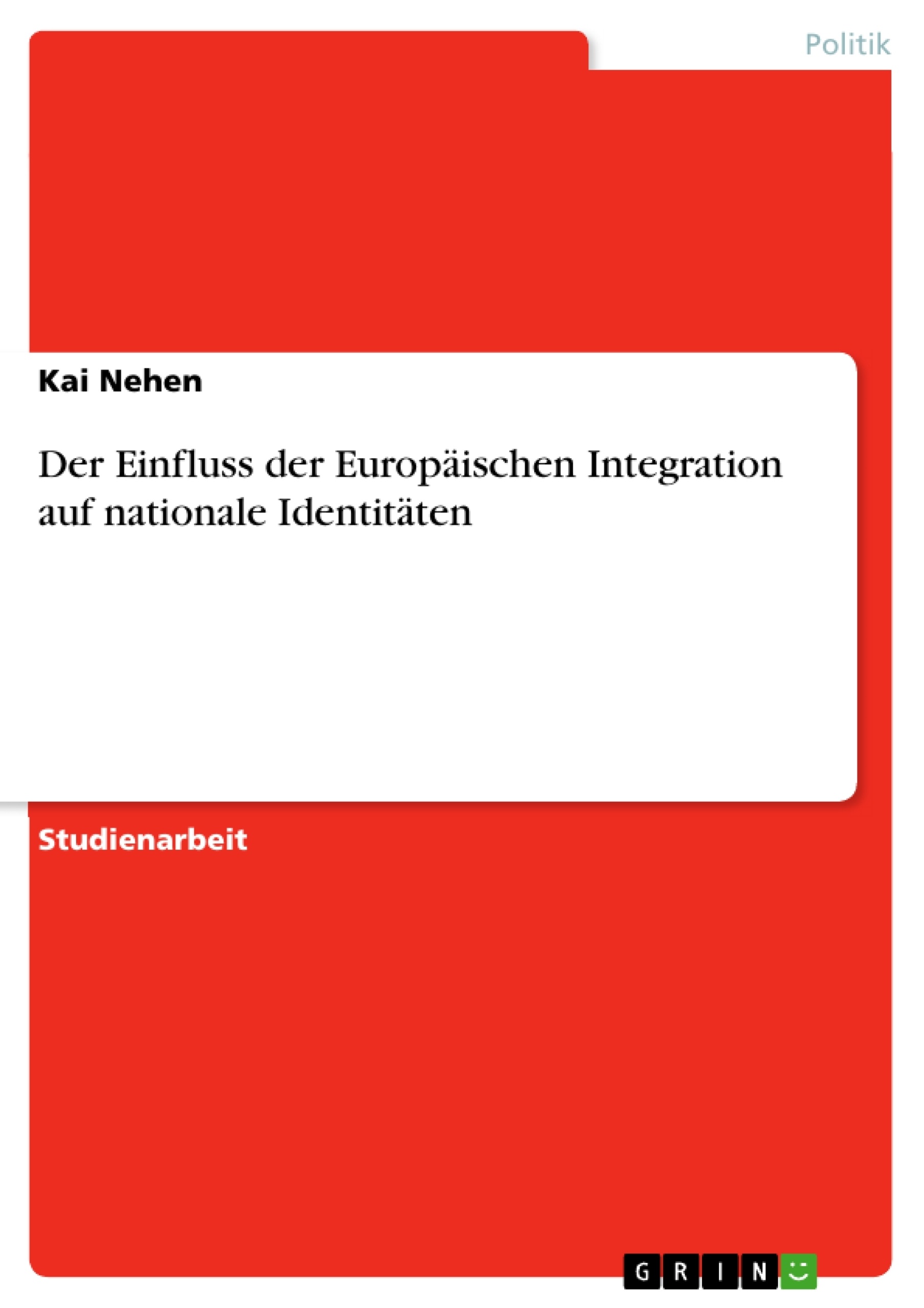1.0 Einleitung
Im Diskurs um die Frage nach der Vereinbarkeit von nationaler und europäischer Identität hat Laura Cram mit ihrer These, dass „European integration facilitates the flourishing of diverse national identities rather than convergence around a single European identity“ (Cram 2009a, 110) frischen Wind gebracht. Ziel dieser Arbeit ist es, diese These mittels einer qualitativ vergleichenden Analyse1 empirisch zu überprüfen (vgl. Ragin 1987; Schneider/Wagemann 2007). In einem ersten Schritt definiere ich hierfür das Konzept der Europäischen Integration. Anschließend stelle ich den aktuellen Stand der Forschung zu der Frage dar, inwiefern der Prozess der Europäischen Integration vorhandene Identitätsstrukturen beeinflusst und wie diese aufgebaut sind. In einem nächsten Schritt führe ich die entsprechenden unabhängigen Variablen2 und die abhängige Variable3 ein. Die darauf folgende Analyse und das abschließende Fazit reflektieren kritisch die Brauchbarkeit der Methode für die verwendete Fragestellung und geben einen Ausblick auf zukünftige notwendige Forschungsarbeiten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Theorie und Konzepte
- 2.1 Das Konzept der Europäischen Integration
- 2.2 Einfluss der Europäischen Integration auf Identitätsstrukturen
- 3. Forschungsdesign
- 4. Empirie
- 4.1 Fallauswahl
- 4.2 Die Variablen
- 4.2.1 Politische Freiheit
- 4.2.2 Wirtschaftliche Freiheit
- 4.2.3 Soziale Freiheit
- 4.2.4 Europäische Integration
- 4.2.5 Nationale Identität
- 4.3 Die Analyse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der These, dass die Europäische Integration diverse nationale Identitäten stärkt anstatt zu einer einheitlichen europäischen Identität zu führen. Ziel ist es, diese These durch eine qualitative vergleichende Analyse zu überprüfen. Zunächst werden das Konzept der Europäischen Integration und der aktuelle Forschungsstand zum Einfluss der Integration auf nationale Identitätsstrukturen dargestellt. Anschließend werden die relevanten Variablen für die Analyse eingeführt. Die Analyse und das Fazit reflektieren die Brauchbarkeit der Methode und geben einen Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten.
- Einfluss der Europäischen Integration auf nationale Identitätsstrukturen
- Vergleichende Analyse von verschiedenen Theorien zur Entstehung nationaler Identitäten
- Anwendung der Methode der qualitativen vergleichenden Analyse (QCA) zur Überprüfung der These
- Einführung relevanter Variablen wie politische und wirtschaftliche Freiheit sowie die Europäische Integration
- Untersuchung der Auswirkungen der Europäischen Integration auf die nationale Identität in verschiedenen Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage sowie die These der Arbeit vor. Im Kapitel "Theorie und Konzepte" werden das Konzept der Europäischen Integration und der aktuelle Forschungsstand zum Einfluss der Integration auf nationale Identitätsstrukturen erläutert. Das Forschungsdesign erläutert die qualitative vergleichende Analyse (QCA) als Methode der Untersuchung. Im Kapitel "Empirie" werden die Fallauswahl und die relevanten Variablen vorgestellt, darunter politische und wirtschaftliche Freiheit sowie die Europäische Integration. Zudem werden die Indikatoren zur Messung der Variablen erläutert. Das Kapitel "Analyse" präsentiert die Ergebnisse der QCA und interpretiert die Ergebnisse. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen, diskutiert Limitationen der Analyse und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, nationale Identität, qualitative vergleichende Analyse (QCA), politische Freiheit, wirtschaftliche Freiheit, Freedom House Index, Index of Economic Freedom, Eurobarometer, nationale Identitätsstrukturen, multiplen Identitäten, Theorie der sozialen Identität.
Häufig gestellte Fragen
Führt die europäische Integration zu einer einheitlichen Identität?
Laut der These von Laura Cram stärkt die europäische Integration eher die Vielfalt nationaler Identitäten, anstatt sie zu einer einzigen europäischen Identität verschmelzen zu lassen.
Was ist die „Qualitative Vergleichende Analyse“ (QCA)?
Die QCA ist eine sozialwissenschaftliche Methode, die in dieser Arbeit genutzt wird, um systematisch die Bedingungen für die Entwicklung nationaler Identitäten in Europa zu vergleichen.
Welche Faktoren beeinflussen die nationale Identität in der EU?
Die Arbeit untersucht Variablen wie politische Freiheit, wirtschaftliche Freiheit, soziale Freiheit und den Grad der europäischen Integration selbst.
Können Menschen mehrere Identitäten gleichzeitig haben?
Ja, die Forschung zu Identitätsstrukturen geht davon aus, dass nationale und europäische Identitäten nebeneinander existieren können (multiple Identitäten).
Welche Datenquellen werden in der Arbeit verwendet?
Zur Messung der Variablen werden unter anderem der Freedom House Index, der Index of Economic Freedom und Daten des Eurobarometers herangezogen.
Was ist das Ziel des Forschungsdesigns dieser Arbeit?
Ziel ist es, empirisch zu überprüfen, ob die Integration tatsächlich das Aufblühen nationaler Identitäten erleichtert oder eher eine Konvergenz erzwingt.
- Quote paper
- Kai Nehen (Author), 2011, Der Einfluss der Europäischen Integration auf nationale Identitäten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165239