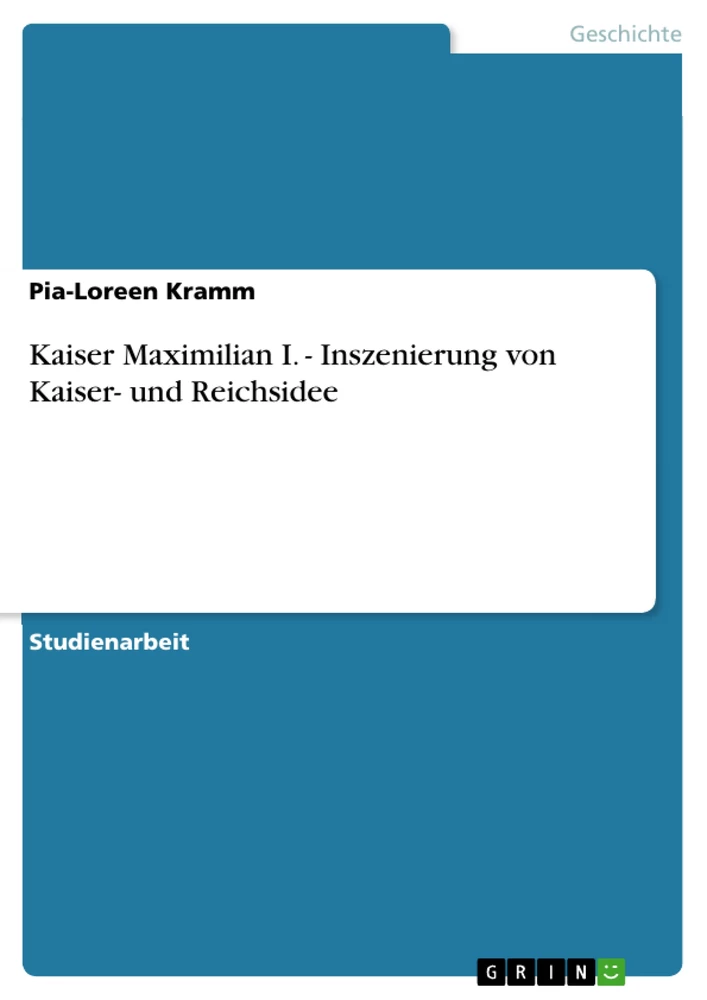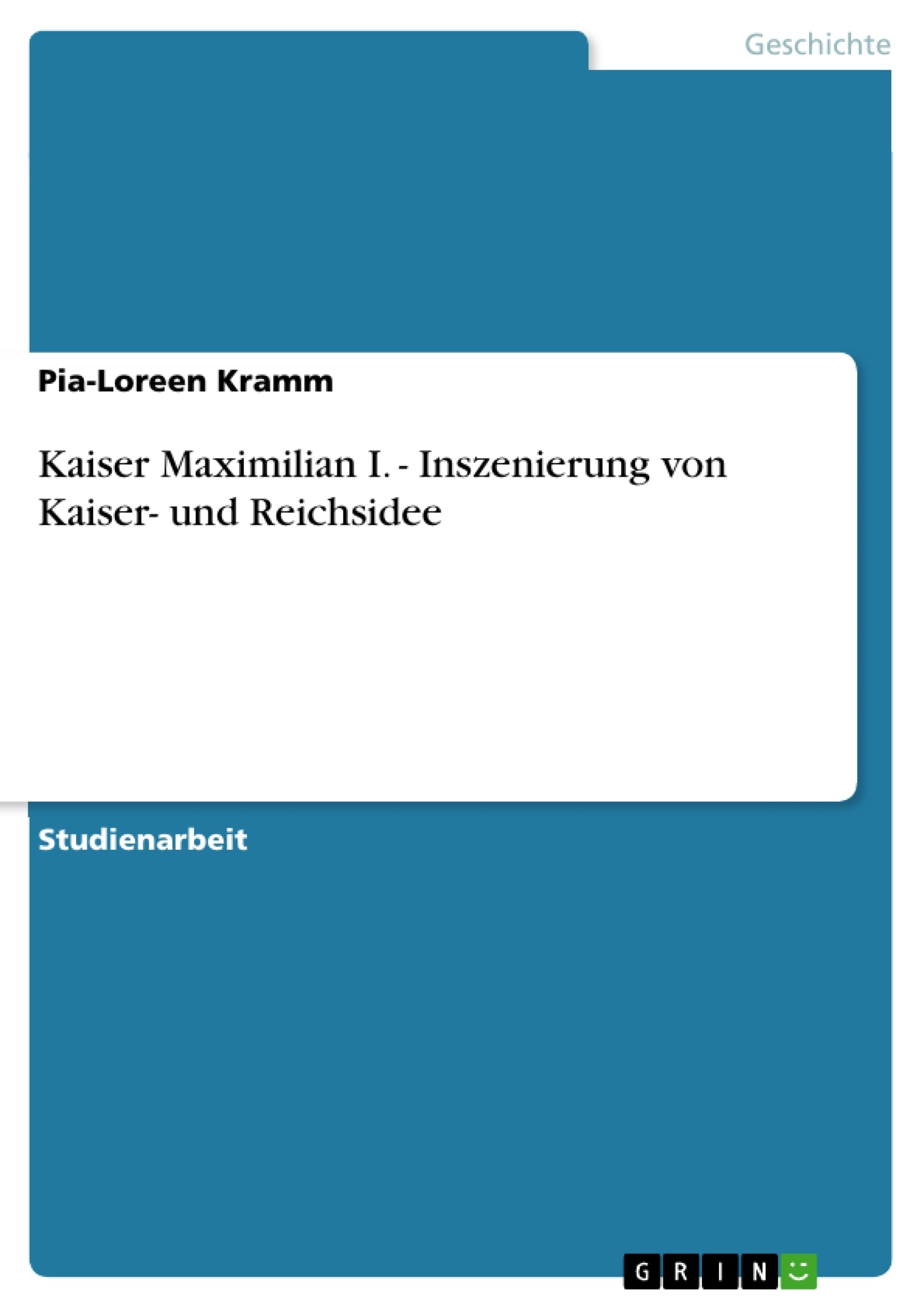Auf der Schaumünze von 1507/ 08 wird die Identifizierung mit dem alten Ritterideal deutlich und die Betitelung Maximilians als „letzter Ritter“ verständlich. Die Rückseite zeigt ihn als „Reiter im Harnisch mit erhobenem Schwert[...,d]ie Pferdedecke hat das Andreaskreuz als kaiserliches Symbol [...u]nterhalb des Pferdes sind die Wappen Ungarns, Burgunds, Habsburgs und Österreichs angebracht.“ Sowohl die Herrschaftsgestik des Reiters als auch das Erscheinen der Wappen auf der Schaumünze verweisen wohl auf den Machtanspruch und die Inszenierung der eigenen Stärke Maximilians.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Maximilians I. Jugend- und Jahre der Bewährung
- II.1. Erziehung
- II.2. Trierer Tag
- II.3. Burgundischer Erbfolgekrieg und Gefangenschaft
- II.4. Königswahl und -Krönung
- II.5. Tiroler Erbe
- II.6. Reformen
- II.7. Italienzug
- II.8. Finanzen
- III. Kaiser Maximilian I. als Ehemann, Vater und Sohn
- III.1. Ansehen und Reichtum mit Maria von Burgund
- III.2. Bianca Maria Sforza, reiche Enkelin eines „Schusters“
- III.3. Spanien! Der Kinder sei Dank.
- III.4. Die Begründung der Donaumonarchie durch Verkuppeln der Enkel
- III.5. Dem Vater zur Ehre
- IV. Maximilians I. Auftreten als Kaiser
- IV.1. Kaiserkrönung in Trient
- IV.2. Legitimation über die Verbreitung seiner Macht mittels der Münzprägung
- IV.3. Legitimation über das Gottesgnadentum
- IV.4. Legitimation über die Ahnen
- V. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Inszenierung der Kaiser- und Reichsidee durch Kaiser Maximilian I. Der Fokus liegt darauf, wie Maximilian seine Errungenschaften – wie das Burgunder und Tiroler Erbe, die Erblichkeit des Kaisertums, und die Grundsteinlegung für die Donaumonarchie und das habsburgische Spanien – noch grandioser erscheinen ließ. Die Arbeit stützt sich dabei auf Quellen und die Werke von Hermann Wiesflecker und Erich Egg.
- Maximilians Jugend und seine prägenden Erfahrungen
- Die Rolle seiner Ehen und Nachkommen für die Inszenierung seiner Reichsidee
- Maximilians Auftreten als Kaiser und seine Legitimationsstrategien
- Die Bedeutung von Münzprägung für die Darstellung von Macht
- Die Entwicklung und Durchsetzung der habsburgischen Reichsidee
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse der Inszenierung der Kaiser- und Reichsidee durch Maximilian I. und wie er seine Errungenschaften vergrößert darstellte. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der auf Quellen und Sekundärliteratur basiert, und gibt einen Überblick über die Kapitelstruktur, beginnend mit Maximilians Jugend und seinen prägenden Ereignissen, über seine Ehen und Nachkommen, bis hin zu seiner Legitimation als Kaiser.
II. Maximilians I. Jugend- und Jahre der Bewährung: Dieses Kapitel behandelt die frühen Jahre Maximilians, geprägt von widersprüchlichen Prognosen über seine Herrschaft und Kritik an seinem nicht rein deutschen Adel. Seine Erziehung, beeinflusst vom Vater Friedrich III., aber auch von anderen Vorbildern, wird analysiert. Der Trierer Tag als sein erstes außenpolitisches Erlebnis und der Burgundische Erbfolgekrieg mit seiner Gefangenschaft in Brügge werden detailliert beschrieben. Schließlich werden sein Aufstieg zum König, die Erbschaft Tirols, seine Reformen und der Italienzug als wichtige Stationen seines frühen Lebens betrachtet, die seine zukünftige Kaiseridee formten. Sein Umgang mit Finanzen wird ebenfalls kurz beleuchtet.
III. Kaiser Maximilian I. als Ehemann, Vater und Sohn: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Maximilians Rollen als Ehemann, Vater und Sohn, und deren Einfluss auf seine Inszenierung der Reichsidee. Die Ehen mit Maria von Burgund und Bianca Maria Sforza werden verglichen, wobei ihr Wert für seine politische Strategie hervorgehoben wird. Die Bedeutung seiner Kinder und Enkel für die Verwirklichung seiner politischen Ziele, insbesondere die Begründung der Donaumonarchie und das habsburgische Spanien, wird umfassend analysiert. Das Verhältnis zu seinem Vater, Kaiser Friedrich III., und dessen Einfluss auf Maximilian wird ebenfalls untersucht.
IV. Maximilians I. Auftreten als Kaiser: Dieses Kapitel befasst sich mit Maximilians Kaiserkrönung in Trient und analysiert seine Legitimationsstrategien. Die Arbeit untersucht die Verbreitung seiner Macht durch die Münzprägung, die Legitimation durch das Gottesgnadentum und die Betonung seiner Ahnenreihe als wichtige Elemente seiner Selbstdarstellung als rechtmäßiger Kaiser. Es wird die Frage behandelt, wie diese Maßnahmen zur Stärkung seines Images als Kaiser beitrugen und seine Reichsidee unterstützten.
Schlüsselwörter
Kaiser Maximilian I., Reichsidee, Habsburger, Burgundisches Erbe, Tiroler Erbe, Donaumonarchie, Münzprägung, Legitimation, Gottesgnadentum, Ahnen, Erziehung, Ehen, Kinder, Politik, Inszenierung, Repräsentation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Kaiser Maximilian I. und seine Inszenierung der Reichsidee"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert, wie Kaiser Maximilian I. seine Kaiser- und Reichsidee inszenierte und seine Errungenschaften (Burgunder und Tiroler Erbe, Erblichkeit des Kaisertums, Donaumonarchie, habsburgisches Spanien) größter erscheinen ließ. Der Fokus liegt auf Maximilians Legitimationsstrategien und der Selbstdarstellung als rechtmäßiger Kaiser.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf Quellen und den Werken von Hermann Wiesflecker und Erich Egg.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Maximilians Jugend und prägende Erfahrungen, die Rolle seiner Ehen und Nachkommen für die Inszenierung seiner Reichsidee, sein Auftreten als Kaiser und seine Legitimationsstrategien (Münzprägung, Gottesgnadentum, Ahnen), sowie die Entwicklung und Durchsetzung der habsburgischen Reichsidee.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Maximilians Jugend und Bewährungsprobe, seine Rolle als Ehemann, Vater und Sohn, sein Auftreten als Kaiser und einen Schluss. Jedes Kapitel untersucht spezifische Aspekte von Maximilians Inszenierung seiner Reichsidee.
Was wird im Kapitel "Maximilians I. Jugend und Jahre der Bewährung" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt Maximilians Erziehung, den Trierer Tag, den Burgundischen Erbfolgekrieg, seine Gefangenschaft, seine Königswahl und Krönung, das Tiroler Erbe, seine Reformen, den Italienzug und seinen Umgang mit Finanzen. Es analysiert die widersprüchlichen Prognosen über seine Herrschaft und die Kritik an seinem nicht rein deutschen Adel.
Was ist der Fokus des Kapitels "Kaiser Maximilian I. als Ehemann, Vater und Sohn"?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf Maximilians Ehen mit Maria von Burgund und Bianca Maria Sforza und deren politische Bedeutung. Es analysiert die Rolle seiner Kinder und Enkel für die Begründung der Donaumonarchie und des habsburgischen Spanien sowie sein Verhältnis zu seinem Vater, Kaiser Friedrich III.
Wie werden Maximilians Legitimationsstrategien im Kapitel "Maximilians I. Auftreten als Kaiser" untersucht?
Dieses Kapitel untersucht Maximilians Kaiserkrönung in Trient und seine Legitimationsstrategien durch Münzprägung, Gottesgnadentum und die Betonung seiner Ahnenreihe. Es analysiert, wie diese Maßnahmen zur Stärkung seines Images und seiner Reichsidee beitrugen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Kaiser Maximilian I., Reichsidee, Habsburger, Burgundisches Erbe, Tiroler Erbe, Donaumonarchie, Münzprägung, Legitimation, Gottesgnadentum, Ahnen, Erziehung, Ehen, Kinder, Politik, Inszenierung, Repräsentation.
Welche Methode wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Quellen und Sekundärliteratur, insbesondere die Werke von Hermann Wiesflecker und Erich Egg.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die konkrete Schlussfolgerung ist nicht explizit im gegebenen Text zusammengefasst, aber die Arbeit zielt darauf ab, die Strategien Maximilians I. zur Inszenierung seiner Reichsidee zu analysieren und zu beleuchten.)
- Quote paper
- Pia-Loreen Kramm (Author), 2010, Kaiser Maximilian I. - Inszenierung von Kaiser- und Reichsidee, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165218