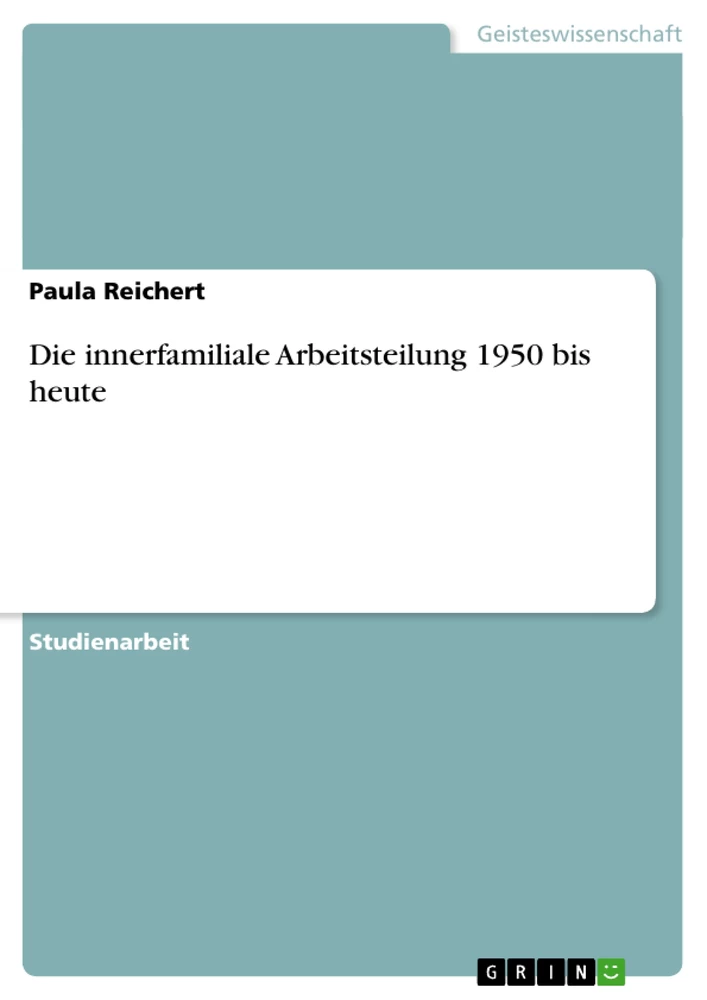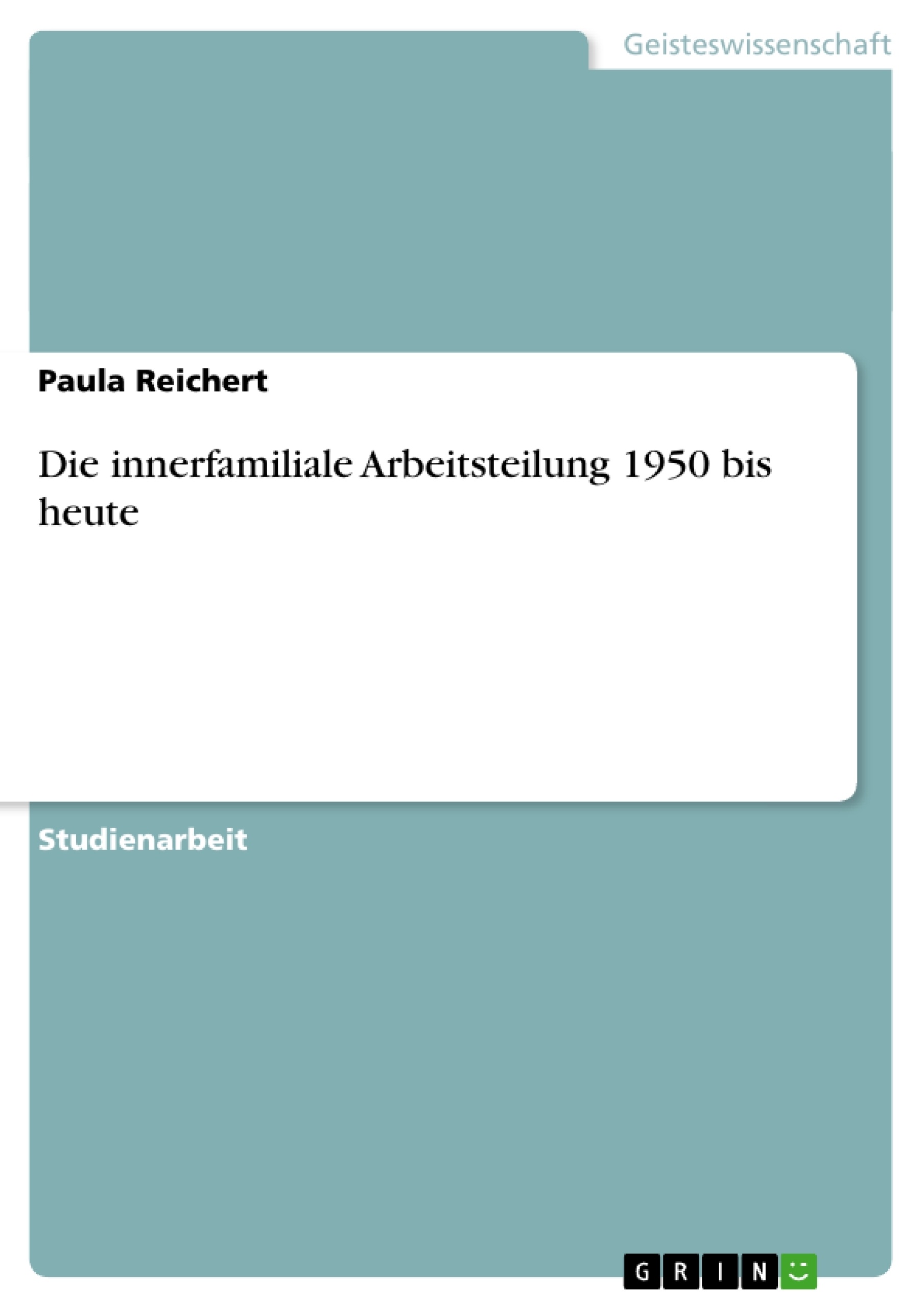In unseren Tagen ist es eine allgemein anerkannte Tatsache, dass Frauen emanzipiert sind. Sie
sind nicht mehr damit zufrieden einfach „nur“ für den Haushalt zuständig zu sein. Immer mehr
Frauen wollen erwerbstätig sein und tun dies auch. Aber hat sich deswegen auch ihre Beteiligung
und die ihrer Männer an der Hausarbeit verändert? Wenn man sich Statistiken über das zeitliche
Ausmaß der Hausarbeit anschaut, dann sieht man, dass Frauen durch ihren Beruf eine doppelte
Last tragen, denn sie verbringen noch fast immer soviel Zeit mit Hausarbeiten wie vorher. Auch
ihre Männer haben ihre Gewohnheit nicht aufgegeben sich von ihrer Frau bedienen zu lassen.
Aber es ist nicht nur die Schuld der Männer, dass Frauen heute eine Doppelbelastung tragen
müssen. Selbst Politiker erkennen immer mehr die Probleme von Familien, und dass die
traditionelle Arbeitsteilung, zwar eine effektive ist, aber nicht alle Beteiligten glücklich macht. In
dieser Hausarbeit möchte ich die Einstellung von Männern und Frauen zur innerfamilialen
Arbeitsteilung heute, und in den letzten 50 Jahren untersuchen. Für ein besseres Verständnis ist
es auch wichtig, die rechtliche Situation und die Situation in den Betrieben zu betrachten. Aber
auch die gesellschaftlichen Werte wirken sich auf verschiedene Bereiche im Leben von Partnern
aus. Im folgenden Kapitel möchte ich beschreiben, wie die Familie und die innerfamiliale
Arbeitsteilung von Männern und Frauen in den 50er bis 60er Jahren gesehen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Sind Frauen heute tatsächlich emanzipiert? (S. 4)
- Innerfamiliale Arbeitsteilung in den 50er bis 60er Jahren (S. 4-5)
- Wie uneheliche Lebensgemeinschaften aufgenommen wurden (S. 5)
- Die gesellschaftliche Situation (S. 5)
- Die traditionelle Arbeitsteilung (S. 5-6)
- Die Beteiligung der Männer an der Hausarbeit (S. 6-7)
- Die Beteiligung der Männer an der Familienarbeit (S. 7-8)
- Die Erwerbsarbeit (S. 8-9)
- Zusammenfassung der innerfamilialen Arbeitsteilung in den 50er bis 60er Jahren (S. 9-10)
- Die innerfamiliale Arbeitsteilung in den 70er bis 90er Jahren (S. 10)
- Das traditionelle Drei-Phasen-Schema für Frauen (S. 10-11)
- Mutterschaft und Vaterschaft (S. 11)
- Mutterschaft (S. 11)
- Vaterschaft (S. 12-13)
- Die Beteiligung an der Hausarbeit (S. 13)
- Die Beteiligung der Frauen an der Hausarbeit (S. 13-15)
- Die Beteiligung der Männer an der Hausarbeit (S. 15-16)
- Die Berufstätigkeit von Frauen und Männern (S. 16)
- Die Berufstätigkeit von Frauen (S. 16-18)
- Teilzeitarbeit (S. 18-19)
- Die Reservearmeetheorie (S. 19)
- Die Berufstätigkeit von Männern (S. 19-20)
- Strategien zur Konfliktreduktion (S. 21-22)
- Objektive Präventiv-Strategien (S. 22)
- Intersubjektive Präventiv-Strategien (S. 22)
- Subjektive Präventiv-Strategien (S. 22)
- Objektive Akut-Strategien (S. 22-23)
- Intersubjektive Akut Strategien (S. 23)
- Subjektive Akut-Strategien (S. 23)
- Die momentane Situation der innerfamilialen Arbeitsteilung (S. 23)
- Die rechtliche Situation (S. 23-24)
- Teilzeitarbeit (S. 24-25)
- Erziehungsurlaub (S. 25-26)
- Erziehungsgeld (S. 26)
- „Die erlernte Hilflosigkeit der Männer“ (S. 26-28)
- Das Ehegattensplitting (S. 28-29)
- Die Möglichkeiten für Paare Kinder und Beruf egalitär zu vereinbaren und die Vorteile und Nachteile, die dabei entstehen können (S. 29)
- Jobsharing (S. 29-30)
- Teilzeitarbeit (S. 30-31)
- Telearbeit und flexible Arbeitszeiten (S. 31)
- Der Hausmann und die neuen Väter (S. 31-32)
- Die Meinung der jungen Generation (S. 32-33)
- Kinderbetreuungsmöglichkeiten (S. 33-34)
- Die rechtliche Situation (S. 23-24)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der innerfamilialen Arbeitsteilung seit 1950 und untersucht, wie sich die Einstellungen von Männern und Frauen zu den Aufgaben im Haushalt und in der Kinderbetreuung im Laufe der Zeit verändert haben. Dabei werden die rechtliche Situation, die gesellschaftlichen Werte sowie die Situation in den Betrieben betrachtet.
- Entwicklung der innerfamilialen Arbeitsteilung seit 1950
- Veränderung der Geschlechterrollen und -bilder
- Bedeutung der Erwerbsarbeit für Männer und Frauen
- Herausforderungen und Chancen für eine egalitäre Rollenteilung in der Familie
- Einfluss von Recht und Gesellschaft auf die Familienstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem Blick auf die traditionellen Geschlechterrollen in den 1950er und 1960er Jahren, wobei die gesellschaftliche Stigmatisierung von unehelichen Partnerschaften und die dominierende Rolle des Mannes im Haushalt und Beruf hervorgehoben werden. Das zweite Kapitel analysiert die Veränderungen in den 1970er bis 1990er Jahren, die wachsende Berufstätigkeit von Frauen, die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Entwicklung neuer Familienmodelle. Der Fokus liegt hier auf den Strategien zur Konfliktreduktion in Familien. Der dritte Teil der Arbeit untersucht die gegenwärtige Situation der innerfamilialen Arbeitsteilung, analysiert rechtliche Rahmenbedingungen wie Teilzeitarbeit, Erziehungsurlaub und Erziehungsgeld sowie die Debatte um „die erlernte Hilflosigkeit der Männer“. Auch neue Modelle der Familienarbeit wie Jobsharing, Teilzeitarbeit und Telearbeit werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Innerfamiliale Arbeitsteilung, Geschlechterrollen, Emanzipation, Familienarbeit, Erwerbsarbeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, rechtliche Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Werte, traditionelle Arbeitsteilung, neue Familienmodelle, Jobsharing, Teilzeitarbeit, Telearbeit, Kinderbetreuung.
- Citar trabajo
- Paula Reichert (Autor), 2002, Die innerfamiliale Arbeitsteilung 1950 bis heute, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16455