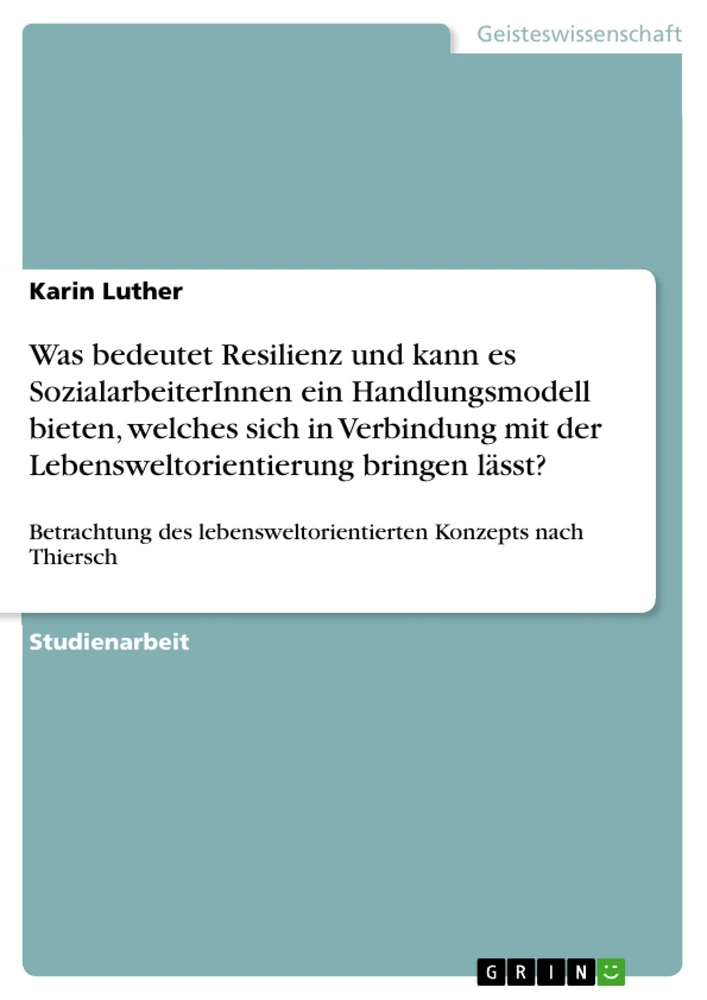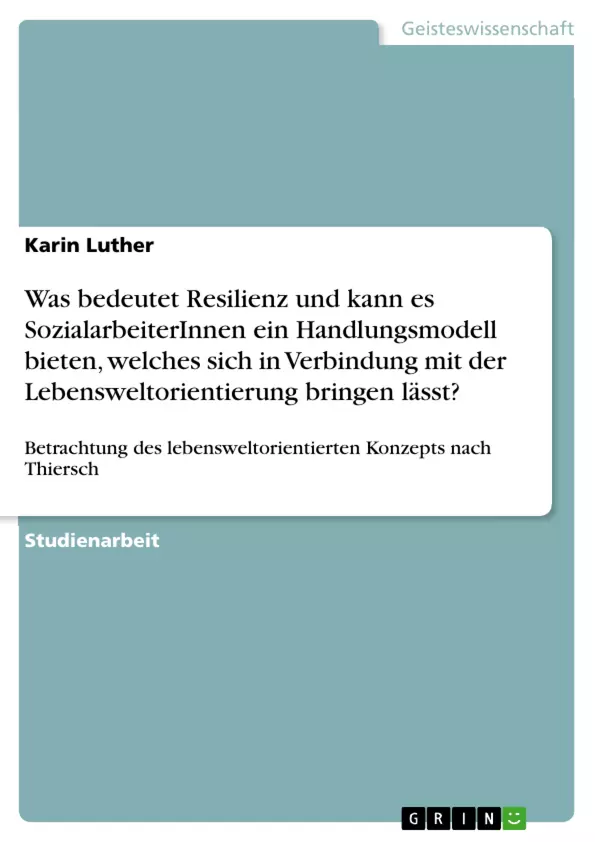In jeder Generation gab und gibt es Menschen, die von Krieg und seinen Folgen mit dem Tod, mit Vertreibung, Vergewaltigungen etc. konfrontiert wurden. Es gab Menschen, die den Horror eines Arbeits- oder Vernichtungslager überlebt haben. Heute kann man jeden Tag in den Medien von misshandelten Kindern lesen, diese werden körperlich gequält, sexuell ausgebeutet und/oder emotional vernachlässigt. Menschen werden Opfer von Naturkatastrophen, Unfällen, schweren Krankheiten und anderen belastenden Ereignissen, Familien brechen auseinander, es kommt zu Trennungen und Verlusten. Es gibt Kinder, die in Familien am Rande des Existenzminimums, in Familien mit Suchterkrankungen oder in Fremdunterbringungen aufwachsen.
Dies alles sind Bedingungen, welche den Start in das Leben oder das Weiterleben deutlich erschweren. Müssten nicht alle Menschen, die in solchen Bedingungen leben (müssen) schwerst traumatisiert und unfähig „gesund“, im Sinne eines erfüllenden Lebens, zu werden oder zu bleiben?
SozialarbeiterInnen werden immer wieder mit KlientInnen konfrontiert, welche in verschiedenen ungünstigen Lebensbedingungen aufwachsen. Was können sie als Ressource leisten? Was für Erklärungen, Handlungsmuster, Dimensionen gibt es, um Menschen in diesen lebensfeindlichen Bedingungen zu unterstützen und ihnen zur Seite zu stehen, diese nicht nur auszuhalten, sondern aktiv zu ändern oder sich damit zu arrangieren ohne Schaden zu nehmen?
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Problemaufriss
- 2 Biographisches zu Hans Thiersch
- 3 Entstehungsgeschichte des lebensweltorientierten Konzeptes
- 4 Abriss Resilienz
- 4.1 Ausgangspunkte der Resilienzforschung
- 4.2 Kohärenz und Selbstwirksamkeit
- 5 Die Bedeutung der Peer-Group nach Hans Thiersch
- 6 Stellung einer positiven Peer-Culture in der Resilienzforschung
- 7 Umsetzung in die Sozialarbeiterische Praxis
- 7.1 Präventionsprogramm „STEEP™“
- 7.2 Strukturmaximen lebensweltorientierter Sozialarbeit
- 7.3 Dimensionen lebensweltorientierter Sozialer Arbeit
- 7.3.1 Erfahrene Zeit
- 7.3.2 Raumdimensionen
- 7.3.3 Ressourcen und Spannungen (soziale Beziehungen)
- 7.3.4 Alltäglichkeiten
- 7.3.5 Hilfe zur Selbsthilfe
- 7.3.6 Gesellschaftliche Verhältnisse
- 8 Schlussfolgerungen
- 9 Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das lebensweltorientierte Konzept nach Hans Thiersch und seine Relevanz für die Soziale Arbeit, insbesondere im Kontext von Resilienz. Sie beleuchtet die biographischen Hintergründe Thierschs, die Entstehungsgeschichte seines Konzepts und dessen Anwendung in der Praxis. Der Fokus liegt auf der Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebensbedingungen und der Förderung ihrer Resilienz.
- Das lebensweltorientierte Konzept von Hans Thiersch
- Resilienz und ihre Bedeutung in der Sozialen Arbeit
- Die Rolle der Peer-Group
- Umsetzung des Konzepts in der sozialarbeiterischen Praxis
- Anwendung des Konzepts auf Kinder und Jugendliche
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext dar, indem sie auf die vielfältigen Herausforderungen und belastenden Lebensbedingungen hinweist, denen Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, ausgesetzt sind. Sie wirft die Frage auf, wie Soziale Arbeit Menschen in solchen Situationen unterstützen und ihre Widerstandsfähigkeit stärken kann, ohne dabei die Lebenswirklichkeit zu vernachlässigen. Die Einleitung motiviert die Beschäftigung mit dem lebensweltorientierten Ansatz und Resilienz.
1 Problemaufriss: Dieses Kapitel formuliert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Es beleuchtet das lebensweltorientierte Konzept nach Hans Thiersch und seine Möglichkeiten, Resilienz zu fördern. Es fragt nach der Bedeutung von Resilienz als Handlungsmodell für SozialarbeiterInnen und dessen Verbindung zur Lebensweltorientierung. Der Fokus liegt auf den Schlussfolgerungen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Sozialen Arbeit.
2 Biographisches zu Hans Thiersch: Dieses Kapitel präsentiert einen biographischen Abriss von Hans Thiersch, der seine bedeutende Rolle in der Sozialwissenschaft und seine Praxisorientierung hervorhebt. Es beschreibt seinen Werdegang, seine akademischen Positionen und seine zahlreichen Publikationen, die wesentlich zur Entwicklung und Verbreitung des lebensweltorientierten Konzepts beigetragen haben. Der Fokus liegt auf seiner Rolle als praxisorientierter Sozialreformer.
3 Entstehungsgeschichte des lebensweltorientierten Konzeptes: Das Kapitel beschreibt die Entstehung des lebensweltorientierten Konzepts, beginnend mit Thierschs Auseinandersetzung mit dem Alltag und seinen Überlegungen zur Jugendhilfe. Es analysiert den Kontext von Kritik an der Sozialpädagogik-Ausbildung und zeigt, wie Thierschs Konzept als Antwort auf diese Kritik entstand. Die Entwicklung von einer anfänglichen Kritik an struktureller Gewalt hin zu einem ressourcenorientierten Ansatz wird nachvollzogen.
4 Abriss Resilienz: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das Konzept der Resilienz. Es beleuchtet die Ausgangspunkte der Resilienzforschung und wichtige Faktoren wie Kohärenz und Selbstwirksamkeit, die zur Entwicklung von Resilienz beitragen. Der Abschnitt legt den Grundstein für das Verständnis von Resilienz als komplementäres Element zum lebensweltorientierten Ansatz.
5 Die Bedeutung der Peer-Group nach Hans Thiersch: Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung der Peer-Group im Kontext des lebensweltorientierten Ansatzes. Er untersucht die Rolle von gleichaltrigen Beziehungen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Bedeutung für die Resilienzentwicklung. Es wird die Bedeutung von positiven Peer-Beziehungen für die Bewältigung von Herausforderungen hervorgehoben.
6 Stellung einer positiven Peer-Culture in der Resilienzforschung: Dieses Kapitel untersucht die Einbettung positiver Peer-Culture in die Resilienzforschung. Es diskutiert die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den positiven Einfluss von unterstützenden Peer-Gruppen auf die psychosoziale Entwicklung und Widerstandsfähigkeit. Der Abschnitt vertieft die Thematik aus Kapitel 5, indem wissenschaftliche Fundamente präsentiert werden.
7 Umsetzung in die Sozialarbeiterische Praxis: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Umsetzung des lebensweltorientierten Konzepts in der Sozialen Arbeit. Es beschreibt konkrete Beispiele wie das Präventionsprogramm „STEEP™“, die Strukturmaximen lebensweltorientierter Sozialarbeit und die verschiedenen Dimensionen (Zeit, Raum, Ressourcen, Alltäglichkeiten etc.), die bei der Anwendung des Konzepts berücksichtigt werden müssen. Es wird gezeigt, wie das Konzept in der Praxis konkret umgesetzt werden kann.
Schlüsselwörter
Lebensweltorientierung, Hans Thiersch, Resilienz, Soziale Arbeit, Peer-Group, Prävention, Selbstwirksamkeit, Kohärenz, Alltagshandeln, Ressourcenorientierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Lebensweltorientiertes Konzept nach Hans Thiersch und Resilienz"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das lebensweltorientierte Konzept von Hans Thiersch und seine Bedeutung für die Soziale Arbeit, insbesondere im Hinblick auf die Förderung von Resilienz. Sie beleuchtet Thierschs Biografie, die Entstehungsgeschichte seines Konzepts, und dessen praktische Anwendung, insbesondere bei der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Peer-Group und der Umsetzung des Konzepts in der sozialarbeiterischen Praxis.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: das lebensweltorientierte Konzept von Hans Thiersch; Resilienz und ihre Bedeutung in der Sozialen Arbeit; die Rolle der Peer-Group; die praktische Umsetzung des Konzepts in der Sozialen Arbeit; und die Anwendung des Konzepts auf Kinder und Jugendliche. Es werden biografische Aspekte von Hans Thiersch, die Entstehungsgeschichte seines Konzepts sowie konkrete Beispiele für die praktische Umsetzung (z.B. das Präventionsprogramm „STEEP™“) erörtert.
Wer ist Hans Thiersch und welche Rolle spielt er?
Hans Thiersch war eine bedeutende Persönlichkeit in der Sozialwissenschaft und der Sozialen Arbeit. Seine Praxisorientierung und seine Beiträge zur Entwicklung des lebensweltorientierten Konzepts bilden die Grundlage dieser Arbeit. Die Arbeit beleuchtet seine Biografie, um seinen Einfluss auf die Entwicklung des Konzepts und seine Relevanz für die Soziale Arbeit zu verdeutlichen.
Was ist das lebensweltorientierte Konzept nach Hans Thiersch?
Das lebensweltorientierte Konzept von Hans Thiersch stellt einen Ansatz in der Sozialen Arbeit dar, der die Lebenswelt der betroffenen Menschen in den Mittelpunkt stellt. Es betont die Ressourcenorientierung und die Berücksichtigung der individuellen Erfahrungen und des sozialen Umfelds. Die Arbeit erläutert die Entstehung und die zentralen Aspekte dieses Konzepts.
Welche Rolle spielt Resilienz in dieser Arbeit?
Resilienz, die Fähigkeit, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen und daraus gestärkt hervorzugehen, ist ein zentrales Thema. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem lebensweltorientierten Konzept und der Förderung von Resilienz. Es werden wichtige Faktoren der Resilienzforschung, wie Kohärenz und Selbstwirksamkeit, beleuchtet.
Wie wird das Konzept in der Praxis umgesetzt?
Die Arbeit beschreibt die praktische Umsetzung des lebensweltorientierten Konzepts anhand konkreter Beispiele, darunter das Präventionsprogramm „STEEP™“. Sie erläutert die Strukturmaximen lebensweltorientierter Sozialarbeit und die verschiedenen Dimensionen (Zeit, Raum, Ressourcen, soziale Beziehungen etc.), die bei der Anwendung des Konzepts berücksichtigt werden müssen.
Welche Bedeutung hat die Peer-Group?
Die Peer-Group, also die Gruppe der Gleichaltrigen, spielt eine wichtige Rolle im lebensweltorientierten Ansatz. Die Arbeit untersucht den Einfluss positiver Peer-Beziehungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Beitrag zur Resilienzentwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Problemaufriss, Biographisches zu Hans Thiersch, Entstehungsgeschichte des lebensweltorientierten Konzepts, Abriss Resilienz, Bedeutung der Peer-Group nach Hans Thiersch, Stellung einer positiven Peer-Culture in der Resilienzforschung, Umsetzung in die Sozialarbeiterische Praxis, Schlussfolgerungen und Quellenangabe.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Sozialen Arbeit, Sozialarbeiter*innen in der Praxis, Wissenschaftler*innen im Bereich der Sozialen Arbeit und Resilienzforschung sowie alle, die sich für die Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen interessieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Lebensweltorientierung, Hans Thiersch, Resilienz, Soziale Arbeit, Peer-Group, Prävention, Selbstwirksamkeit, Kohärenz, Alltagshandeln, Ressourcenorientierung.
- Quote paper
- Karin Luther (Author), 2010, Was bedeutet Resilienz und kann es SozialarbeiterInnen ein Handlungsmodell bieten, welches sich in Verbindung mit der Lebensweltorientierung bringen lässt? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163057