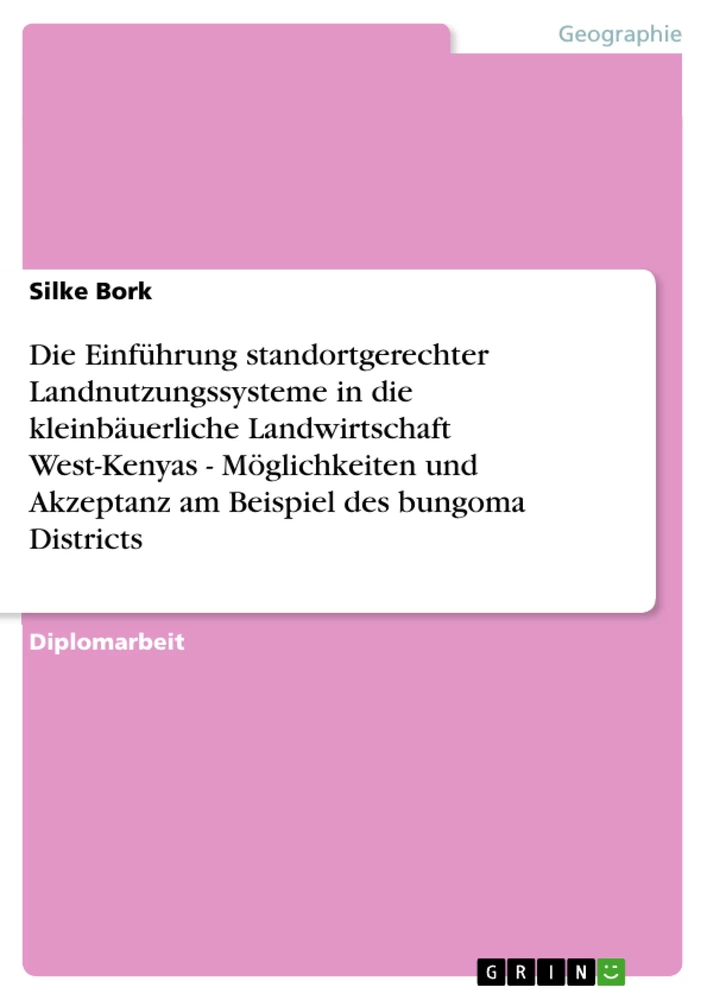Zusammenfassung
Die gegenwärtige Situation vieler Länder des tropischen Afrikas ist durch schwerwiegende Strukturdefizite gekennzeichnet. Große Bedeutung kommt dabei dem Problemkomplex einer unzureichenden Nahrungsmittelproduktion bei gleichzeitig kontinuierlichem Bevölkerungswachstum und zurückgehenden Landreserven zu. Die sich daraus ergebende Notwendigkeit der Erhöhung der Agrarproduktion ist demnach nur über eine Steigerung der Flächenerträge möglich. In Kenya wurde diesem Problem mit dem Import unangepaßter "high-external-input" -Techniken im Rahmen der Grünen Revolution in Verbindung mit aufwendigen baulichen Erosionsschutzmaßnahmen begegnet. Dies führte einerseits, vor allem in Gebieten mit hohem landwirtschaftlichem Potential, zu teilweise enormen Ertragssteigerungen, insbesondere bei Mais, der die Nahrungsgrundlage der Bevölkerung darstellt; andererseits konnte der flächenmäßigen Ausdehnung der Bodenerosion nur teilweise Einhalt geboten werden. Für den Großteil der ressourcenarmen Kleinbauern, die einen essentiellen Beitrag zur Nahrungsmittelproduktion des Landes liefern und sich die teuren externen Inputs nicht mehr leisten konnten, bedeutete dieses Entwicklungskonzept eine Marginalisierung. Der zusätzliche Verlust autochthonen Wissens über nachhaltige Methoden der Landbewirtschaftung infolge der "Modernisierung" der Landwirtschaft führte dazu, daß sich heute viele Kleinbetriebe in einem ökologischen Ungleichgewicht befinden.
Die zunehmende Kritik an diesem Konzept führte zur Entwicklung alternativer Anbaustrategien, die im Rahmen eines "low-external-input" -Ansatzes auf traditionellen Anbausystemen und autochthonem Wissen aufbauen. Dies bedeutet, daß auf der Grundlage möglichst geschlossener Nährstoff-, Energie- und Wasserkreisläufe und erhöhter biologischer Diversität Landbaumethoden praktiziert werden sollen, die sowohl ökologisch als auch sozioökonomisch den jeweiligen Standortbedingungen angepaßt sind und somit als "standortgerechte Landnutzungssysteme" bezeichnet werden können. Diese ermöglichen durch ausschließlich positive externe Effekte auf lokaler Ebene eine nachhaltige Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion bei gleichzeitiger Erhaltung der natürlichen Produktionsgrundlagen; auf globaler Ebene werden sie darüber hinaus der Forderung nach der Erhaltung genetischer Ressourcen und der Biodiversität gerecht.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Bungoma District als Beispiel einer landwirtschaftlichen "high potential area"
- 2.1. Untersuchungsgebiet
- 2.2. Naturräumliche Voraussetzungen
- 2.3. Beurteilung des Zustands der Bodenfruchtbarkeit im Untersuchungsgebiet
- 2.4. Landwirtschaft und agrarökologische Zonierung
- 3. Methodik der Datenerhebung
- 3.1. Einsatz partizipativer Erhebungsmethoden
- 3.2. Durchführung der vorliegenden Untersuchung
- 3.2.1. Erläuterung des Leitfadens
- 3.2.2. Kontaktaufnahme zu den Interviewpartnern
- 3.2.3. Charakteristik der geführten Interviews
- 3.3. Datenaufbereitung
- 4. Situation und Rahmenbedingungen der Kleinbauern von Siangwe
- 4.1. Familienstruktur
- 4.2. Schulbildung
- 4.3. Geldvermögen und Cash Flow
- 4.4. Produktionsgrundlagen der Betriebe
- 4.4.1. Güter
- 4.4.1.1. Faktor Boden
- 4.4.1.2. Landwirtschaftliche Geräte und Transportmittel
- 4.4.1.3. Nutztiere
- 4.4.2. Dienstleistungen und Arbeit
- 4.4.3. Rechte
- 4.5. Zusammenfassung
- 5. Problemzusammenhang Landwirtschaft - Bodenerosion - nachlassende Bodenfruchtbarkeit
- 5.1. Die Bodenerosion als besondere Problematik
- 5.2. Bodenerosion im Bungoma District
- 5.3. Die Rolle der Landwirtschaft: derzeit praktizierte Anbaumethoden und deren Konsequenzen
- 5.4. Problembewußtsein der befragten Bauern
- 6. Maßnahmen und Konzepte zur nachhaltigen Bodenkonservierung
- 6.1. Bodenkonservierung im Bungoma District
- 6.2. Das Konzept des standortgerechten Landbaus
- 6.2.1. Die Entwicklung standortgerechter Landbaumethoden in Ostafrika
- 6.2.2. Elemente des standortgerechten Landbaus
- 7. Externe Möglichkeiten zur Einführung standortgerechter Landbaumethoden im Bungoma District und deren zu erwartende Akzeptanz
- 7.1. Standortgerechter Landbau in der landwirtschaftlichen Beratung
- 7.2. Bedeutung der Beratungsdienste im Untersuchungsgebiet
- 7.3. Akzeptanz standortgerechter Landbaumethoden
- 7.3.1. Mögliche limitierende Faktoren der Akzeptanz
- 7.3.2. Zu erwartende Akzeptanz der befragten Bauern
- 8. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten und Akzeptanz der Einführung standortgerechter Landnutzungssysteme in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft des Bungoma Districts in West-Kenya. Sie befasst sich mit den Herausforderungen der Bodenerosion und der nachlassenden Bodenfruchtbarkeit in der Region, analysiert die bestehenden landwirtschaftlichen Praktiken und deren Folgen sowie das Problembewußtsein der Kleinbauern.
- Analyse der Situation der Kleinbauern im Bungoma District
- Untersuchung der Herausforderungen der Bodenerosion und nachlassenden Bodenfruchtbarkeit
- Bewertung der Akzeptanz standortgerechter Landnutzungssysteme
- Identifizierung von Implementierungshindernissen
- Bewertung der Rolle externer Faktoren, insbesondere der landwirtschaftlichen Beratung, für die Einführung standortgerechter Landnutzungssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert die Problematik der unzureichenden Nahrungsmittelproduktion in Ländern des tropischen Afrikas. Kapitel 2 beschreibt den Bungoma District, seine naturräumlichen Voraussetzungen und den aktuellen Zustand der Bodenfruchtbarkeit. Kapitel 3 erläutert die Methodik der Datenerhebung, die auf partizipativen Erhebungsmethoden basiert. In Kapitel 4 werden die Situation und Rahmenbedingungen der Kleinbauern von Siangwe, einschließlich ihrer Familienstruktur, Schulbildung, finanziellen Situation und Produktionsgrundlagen, dargestellt. Kapitel 5 beleuchtet den Problemzusammenhang zwischen Landwirtschaft, Bodenerosion und nachlassender Bodenfruchtbarkeit, analysiert die derzeit praktizierten Anbaumethoden und deren Folgen sowie das Problembewußtsein der befragten Bauern. Kapitel 6 befasst sich mit Maßnahmen und Konzepten zur nachhaltigen Bodenkonservierung, insbesondere mit dem Konzept des standortgerechten Landbaus. Kapitel 7 untersucht die externen Möglichkeiten zur Einführung standortgerechter Landbaumethoden im Bungoma District und deren zu erwartende Akzeptanz, mit besonderem Fokus auf die Rolle der landwirtschaftlichen Beratung. Die Schlußbetrachtung fasst die Ergebnisse der Diplomarbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Kleinbauern, West-Kenya, Bungoma District, standortgerechte Landnutzungssysteme, Bodenerosion, Bodenfruchtbarkeit, nachhaltige Landwirtschaft, landwirtschaftliche Beratung, Akzeptanz, Implementierungshindernisse, traditionelle Anbaumethoden, autochthones Wissen
Häufig gestellte Fragen
Was sind "standortgerechte Landnutzungssysteme"?
Es sind Anbaustrategien, die auf traditionellem Wissen basieren und ökologische sowie sozioökonomische Bedingungen vor Ort berücksichtigen, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
Warum scheiterte die "Grüne Revolution" bei vielen Kleinbauern in Kenya?
Die teuren externen Inputs (Dünger, Pestizide) führten zur Marginalisierung ressourcenarmer Bauern und zerstörten oft das ökologische Gleichgewicht.
Was ist das Hauptproblem im Bungoma District?
Trotz hohem landwirtschaftlichem Potenzial leidet die Region unter massiver Bodenerosion und nachlassender Bodenfruchtbarkeit.
Welche Rolle spielt die landwirtschaftliche Beratung?
Beratungsdienste sind entscheidend für die Einführung neuer Methoden, müssen aber autochthones Wissen integrieren, um von den Bauern akzeptiert zu werden.
Was sind limitierende Faktoren für die Akzeptanz neuer Methoden?
Fehlendes Geldvermögen (Cash Flow), Familienstrukturen und mangelnder Zugang zu angepassten landwirtschaftlichen Geräten können die Umsetzung behindern.
- Citar trabajo
- Silke Bork (Autor), 1997, Die Einführung standortgerechter Landnutzungssysteme in die kleinbäuerliche Landwirtschaft West-Kenyas - Möglichkeiten und Akzeptanz am Beispiel des bungoma Districts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162