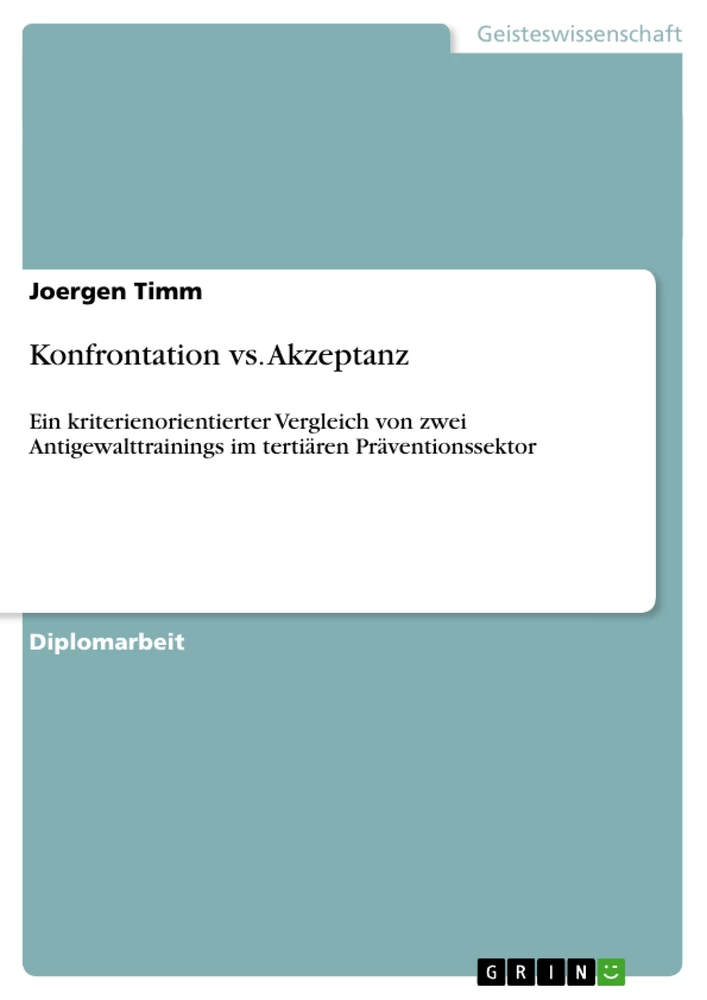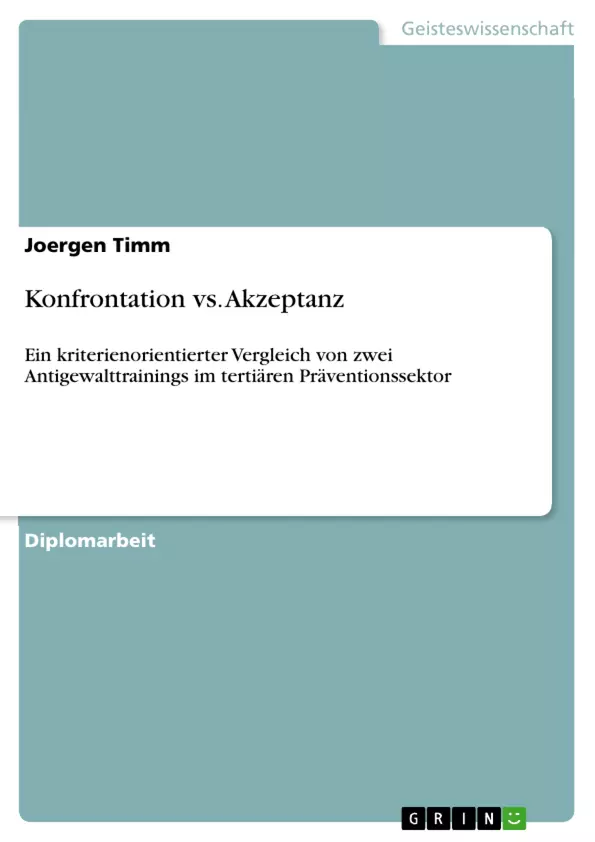Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem. Nicht erst der Überfall auf Dominik
Brunner im September 2009 am Bahnhof München-Solln hat die Diskussion
über die Behandlung von Gewalttätern wiederbelebt, aber seitdem wird deutlich
engagierter diskutiert, weil vor allem eine Person versucht hat, vergessene
Grenzen aufzuzeigen.
Diese Arbeit hat das Ziel, zwei Trainingsmaßnahmen zu vergleichen, die im
tertiären Präventionssektor angesiedelt sind. Die Teilnehmer dieser Trainings
sind bereits mehrfach straffällig geworden und müssen oder wollen diese
Chance nutzen, ihr Verhalten zu überdenken und zu ändern.
Die Idee zu diesem Vergleich entstand vor allem im zweiten Praktikum, das ich
bei einem Anbieter für pädagogische Weiterbildungen absolvierte, der eine
Ausbildung zum AAT-Trainer im Programm hatte und diese durch die konkurrierende
Ausbildung zum AKT-Trainer ersetzte. Die Diskussion für oder gegen die
alte Maßnahme und für die Entscheidung, den Ansatz des Violence-Prevention-
Networks zu übernehmen, förderte die Neugier, diese beiden so unterschiedlich
erscheinenden Varianten der Gewaltarbeit zu untersuchen und gegeneinander
zu stellen.
Diese Arbeit stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf die verwendeten
Methoden, da die Trainer diese individuell weiterentwickeln und anpassen,
sondern basiert auf den literarischen Veröffentlichungen der jeweiligen Institutionen.
Einen Überblick über die aktuelle Diskussion in der Öffentlichkeit und die sehr
eingeschränkte Sichtweise der Politik auf das Thema der Gewalt ermöglicht der
Abschnitt 1 im Teil A. Ebenso wird hier im Abschnitt 2 die Polizeiliche Kriminalstatistik
2009 in Bezug auf die Gewaltausübung von Kindern, Jugendlichen und
Heranwachsenden ausgewertet.
Die relevanten Theorien zur Gewaltherkunft und -entstehung werden im Teil B
erläutert.
Im Teil C werden dann die theoretischen Grundlagen für die Arbeit mit gewaltbereiten
Jugendlichen dargestellt, diese basieren auf bereits fundierten Therapien,
wie zum Beispiel der Gestalttherapie. Im weiteren Verlauf folgt eine differenzierte
Darstellung der zu vergleichenden Trainingsmaßnahmen. Dabei werden
unter anderem die Rahmenbedingungen, Konzepte und die verwendeten
Methoden erläutert.
Im Anschluss werden die Maßnahmen in fünf Kriterien gegenübergestellt und
verglichen.
Die eventuellen Gemeinsamkeiten werden im Teil D dargestellt und eine Weiterentwicklung
diskutiert.
Die Ergebnisse werden im Teil E dargestellt und erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil A
- 1. Die aktuelle Diskussion in der Öffentlichkeit und die (sozial-)politische Sichtweise auf die Jugendgewalt
- 2. Aktuelle Zahlen zur Jugendgewalt
- Teil B
- 1. Aggressions- und Gewalttheorien
- Teil C
- 1. Theoretische Grundlagen für Trainingsmaßnahmen im tertiären Präventionssektor
- 2. Die Trainingsmaßnahmen
- 2.1. Anti-Aggressions-Training – AAT
- 2.1.1. Institutionen
- 2.1.2. Die theoretische Grundlage
- 2.1.3. Das Konzept
- 2.1.4. Die Methoden
- 2.1.5. Qualitätsstandards
- 2.1.6. Evaluation
- 2.2. Anti-Gewalt- und Kompetenztraining - AKT
- 2.2.1. Institutionen
- 2.2.2. Die theoretische Grundlage
- 2.2.3. Das Konzept
- 2.2.4. Die Methoden
- 2.2.5. Qualitätsstandards
- 2.2.6. Evaluation
- 3. Vergleich der Trainingsmaßnahmen anhand der definierten Kriterien
- 3.1. Theorierahmen
- 3.2. Theorie der Interventionsstrategien
- 3.3. Durchführung
- 3.4. Qualitätssicherung/Qualifizierung
- 3.5. Evaluationsmenge/-qualität
- Teil D
- 1. Gemeinsame pädagogische Schnittmengen und Diskussion um die Verbreitung der Maßnahmen
- Teil E
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Die aktuelle Debatte in der Gesellschaft und die (sozial-)politische Sicht auf Jugendgewalt
- Theorien zur Entstehung und Herleitung von Aggression und Gewalt
- Theoretische Grundlagen für Trainingsmaßnahmen im tertiären Präventionssektor
- Konzepte und Methoden der beiden Trainingsmaßnahmen AAT und AKT
- Vergleich der beiden Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, Durchführung und Evaluation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert zwei Trainingsmaßnahmen im tertiären Präventionssektor, die sich auf die Reduktion von Gewalt bei bereits straffälligen Jugendlichen konzentrieren. Ziel ist es, die beiden Ansätze – das Anti-Aggressions-Training (AAT) und das Anti-Gewalt- und Kompetenztraining (AKT) – anhand verschiedener Kriterien zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszuarbeiten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Diskussion um Jugendgewalt und skizziert den Hintergrund der Arbeit. Sie stellt die beiden Trainingsmaßnahmen AAT und AKT vor und erläutert die Motivation für ihren Vergleich.
Teil A analysiert die öffentliche Diskussion um Jugendgewalt sowie die statistische Entwicklung von Gewaltdelikten durch Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.
Teil B beschäftigt sich mit relevanten Theorien zur Entstehung und Herleitung von Aggression und Gewalt.
Teil C präsentiert die theoretischen Grundlagen für Trainingsmaßnahmen im tertiären Präventionssektor. Die beiden Trainingsmaßnahmen AAT und AKT werden detailliert dargestellt, wobei ihre Konzepte, Methoden und Evaluationen im Vordergrund stehen.
Teil D analysiert gemeinsame pädagogische Schnittmengen und diskutiert die Verbreitung der beiden Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Jugendgewalt, tertiäre Prävention, Anti-Aggressions-Training (AAT), Anti-Gewalt- und Kompetenztraining (AKT), Gewaltprävention, Interventionsstrategien, Evaluation, Vergleich und Verbreitung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Diplomarbeit zur Gewaltprävention?
Ziel ist der Vergleich zweier tertiärer Präventionsmaßnahmen für straffällige Jugendliche: das Anti-Aggressions-Training (AAT) und das Anti-Gewalt- und Kompetenztraining (AKT).
Was versteht man unter tertiärer Prävention?
Tertiäre Prävention richtet sich an Personen, die bereits straffällig geworden sind, um Rückfälle zu verhindern und Verhaltensänderungen zu bewirken.
Auf welchen theoretischen Grundlagen basieren diese Trainings?
Sie greifen auf Aggressions- und Gewalttheorien sowie auf fundierte Therapieansätze wie die Gestalttherapie zurück.
Anhand welcher Kriterien werden AAT und AKT verglichen?
Der Vergleich erfolgt anhand des Theorierahmens, der Interventionsstrategien, der Durchführung, der Qualitätssicherung und der Evaluationsqualität.
Welche Rolle spielt die aktuelle Kriminalstatistik in der Arbeit?
Die Arbeit wertet die Polizeiliche Kriminalstatistik 2009 aus, um das Ausmaß der Gewalt bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden zu belegen.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Trainingsmethoden?
Ja, die Arbeit identifiziert pädagogische Schnittmengen und diskutiert die Weiterentwicklung und Verbreitung beider Ansätze in der Gewaltarbeit.
- Citar trabajo
- Joergen Timm (Autor), 2010, Konfrontation vs. Akzeptanz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162953