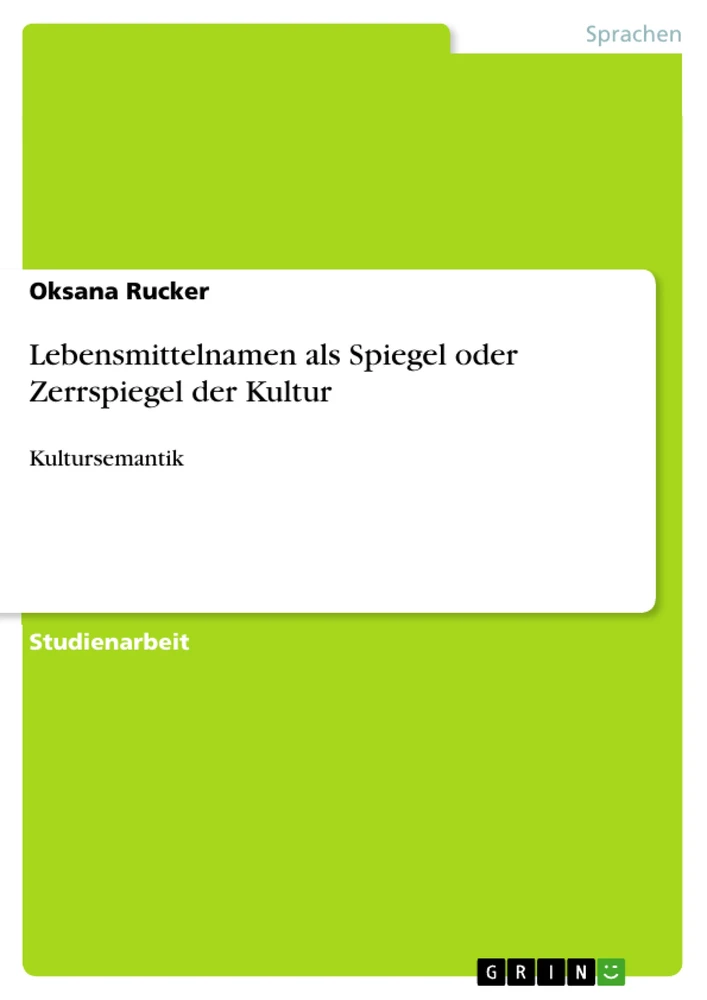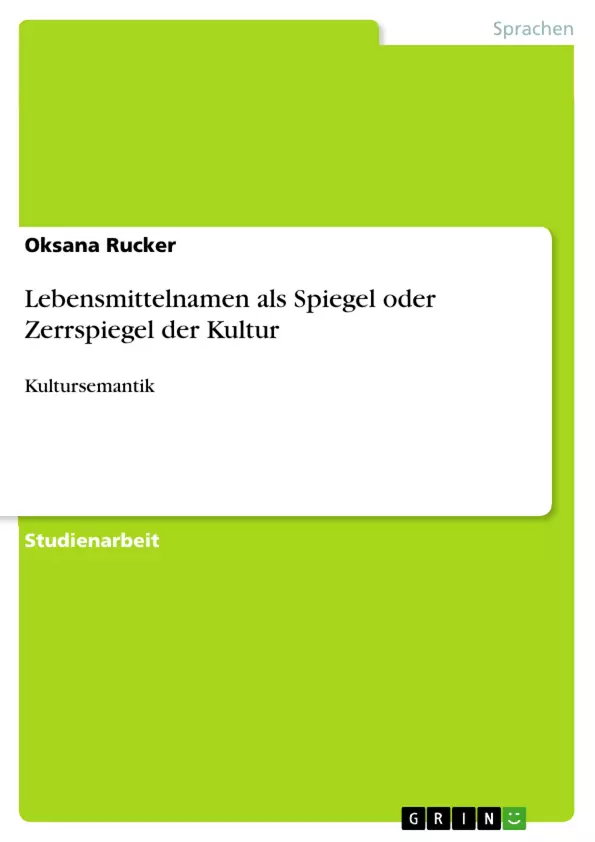Produktnamen sind Zeichen, die in einem bestimmten kulturellen Kontext bestehen und erschaffen werden. Im Sinne eines Herstellers soll ein Produktname ein Produkt verkaufen. Um möglichst viele Kunden von seinem Produkt zu überzeugen, wird ein Hersteller einen Produktnamen wählen, der ein für die Mehrheit verständliches Bild erstehen lassen kann, positive Assoziationen weckt, das Produkt gar mit prestigeträchtigen Inhalten aufwertet.
Eine wichtige Funktion des Produktnamens ist es nämlich, einen gemeinsamen Kommunikationsprozess zwischen dem Produzenten und den Konsumenten zu begründen. In Zeiten von globalisierten Märkten bedeutet das aber für die Produzenten, dass sie sich mit den kulturellen Werten und Befindlichkeiten der Zielkultur auseinandersetzen, also ihre Sprache lernen müssen. Welche Symbole oder Werte sind kulturübergreifend? Welche würden aber in einer anderen Kultur überhaupt nicht verstanden oder gar missverstanden werden? Welcher Wissensvorrat kann in der Zielkultur vorausgesetzt werden?
Nach Hofstede hat jedes Gesellschaftssystem sein eigenes kulturelles Erbe bestehend aus Werten, Ritualen, Helden und Symbolen. Aber was davon eignet sich dazu, wiederverwendet, aktualisiert zu werden? Was ist im kollektiven Gedächtnis positiv und was negativ verankert? Was ist dazu geeignet, ein „exklusives Gebrauchswertversprechen“ (Platen, 1997, S. 63) abzugeben?
Um diese Fragen zu beantworten, scheinen die Produktnamen als kulturelle Artefakte ein guter Ansatzpunkt zu sein, um Rückschlüsse auf die jeweilige Kultur ziehen zu können.
Renate Rathmayr hat nun in einer Studie die kulturelle Bedingtheit von Produktnamen untersucht. Dafür hat sie einen kontrastiven Zugang gewählt, denn Sachverhalte können erst als kulturspezifisch identifiziert werden, wenn es sie in einer anderen Kultur nicht gibt. Da eine Funktion der Produktnamen es ist, für ein Produkt zu werben, bezieht man sich geschickterweise auf positive Werte, die einer bestimmten Gruppe gemeinsam sind. Über die Produktnamen kann man also direkt oder indirekt auf diese Werte schließen. Darin besteht auch die Rolle der „Produktnamen als Spiegel oder Zerrspiegel der Kultur“ (Rathmayr, 2005).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung der Studie
- Motivierte Produktnamen
- Motivation durch den realen oder fiktiven Produzenten
- Motivation durch den realen oder fiktiven Produktionsort
- Motivation durch reale Ingredienzien
- Motivation durch reale oder fiktive Produktmerkmale
- Deutsch-Russische Unterschiede
- Nicht-motivierte Namen
- Entlehnungen
- Prestigenamen
- Namen aus den Bereichen Kunst und Kultur
- Namen mit Bezug zu Luxus, Lebensstil und Genuss
- Namen von historischen Persönlichkeiten
- National-patriotische Motive
- Fazit
- Konzeptuelle Kritik
- Inhaltliche Kritik und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studie von Rathmayr untersucht die kulturelle Bedingtheit von Lebensmittelnamen anhand eines kontrastiven Zugangs zwischen Russland und Österreich. Die zentrale Fragestellung lautet, wie sich kulturelle Werte und Befindlichkeiten in Produktnamen widerspiegeln und welche Rolle diese für die Kommunikation zwischen Produzenten und Konsumenten spielen.
- Analyse von Benennungsmustern für Lebensmittelnamen in Russland und Österreich
- Identifizierung von motivierten und nicht-motivierten Namen
- Bedeutung von kulturellen Assoziationen und Werten für die Namensgebung
- Untersuchung des Einflusses von Produktionsort, Ingredienzien und Produktmerkmalen auf die Namensgebung
- Vergleich der Benennungspraxis in beiden Sprachräumen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Produktnamen als kulturelle Artefakte dar und führt in die Fragestellung der Studie ein. Kapitel 2 beschreibt die Methodik der Studie, die auf einem Vergleich von Lebensmittelnamen in Russland und Österreich basiert. Kapitel 3 konzentriert sich auf motivierte Produktnamen, die durch den Produzenten, Produktionsort, Ingredienzien oder Produktmerkmale motiviert sind. Im Fokus stehen dabei auch die deutsch-russischen Unterschiede bei der Namensgebung. Kapitel 4 behandelt nicht-motivierte Namen, die z.B. auf Entlehnungen, Prestige oder historische Persönlichkeiten basieren.
Schlüsselwörter
Produktnamen, Kultursemantik, Kulturvergleich, Russland, Österreich, Lebensmittelnamen, Benennungsmuster, motivierte und nicht-motivierte Namen, Assoziationspotenzial, kulturelle Werte, Kommunikation, globalisierte Märkte.
Häufig gestellte Fragen
Wie spiegeln Lebensmittelnamen die Kultur wider?
Produktnamen nutzen Symbole, Werte und historische Bezüge einer Zielkultur, um positive Assoziationen zu wecken und eine Kommunikation zwischen Produzent und Konsument aufzubauen.
Was ist der Unterschied zwischen motivierten und nicht-motivierten Namen?
Motivierte Namen beziehen sich auf reale Merkmale wie Inhaltsstoffe oder den Herkunftsort, während nicht-motivierte Namen auf Prestige, Kunst oder Fantasiebegriffen basieren.
Welche kulturellen Unterschiede gibt es zwischen Russland und Österreich?
Die Studie untersucht, wie nationale Identität, historische Persönlichkeiten und lokale Traditionen die Namensgebung in beiden Ländern unterschiedlich prägen.
Warum sind Produktnamen für globale Märkte wichtig?
Produzenten müssen die „Sprache“ der Zielkultur lernen, um Missverständnisse zu vermeiden und den Wissensvorrat der Konsumenten optimal zu nutzen.
Was bedeutet „Produktname als Zerrspiegel“?
Es beschreibt, dass Namen nicht immer die Realität abbilden, sondern oft idealisierte oder klischeehafte Vorstellungen einer Kultur für Werbezwecke nutzen.
- Citar trabajo
- Oksana Rucker (Autor), 2008, Lebensmittelnamen als Spiegel oder Zerrspiegel der Kultur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162527