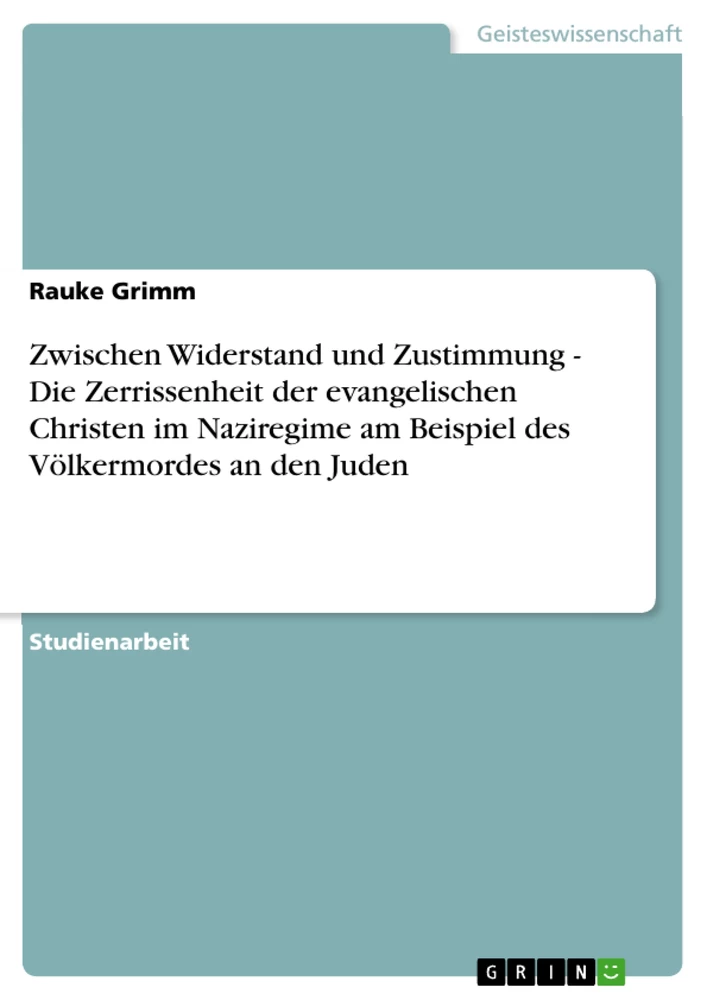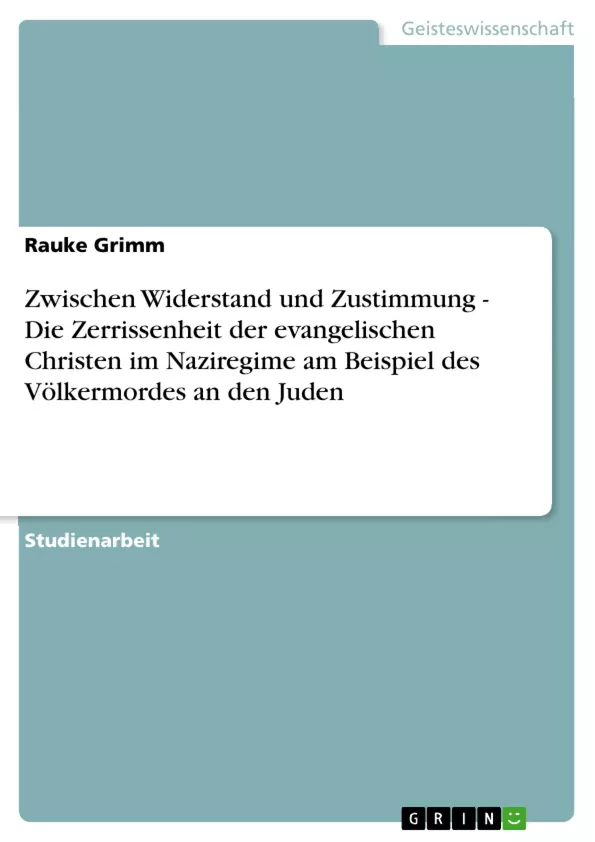Die Verbrechen des Nazi-Regimes markieren einen grausamen Höhepunkt in der deutschen Geschichte. Viele waren daran beteiligt - auch und nicht gerade selten evangelische Christen. Andererseits hat der Protestantismus auch Persönlichkeiten hervorgebracht, die sich ungeachtet der Risiken, die für ihr eigenes Leben bestanden, für die Verfolgten einsetzten, sie versteckten oder ihnen die Ausreise ermöglichten. Die Besatzer gingen gleich nach dem Krieg davon aus, daß die Deutsche Evangelische Kirche (DEK) als ganzes zum deutschen Widerstand zu zählen sei. Dabei variierten die Auffassungen zwischen Zustimmung, radikaler Ablehnung und Schweigen. Die unterschiedlichen Rollen der DEK während der Nazi-Schreckensherrschaft bestimmt auch heute noch das Verhalten der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) zur Politik. Sie versucht durch die Veröffentlichung von Stellungnahmen z.B. zur Asyl- oder Sozialpolitik aus den Versäumnissen und Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Also scheint es Versäumnisse und Fehler gegeben zu haben. Um das Ausmaß der Extreme zwischen 1933 und 1945 in der evangelischen Kirche zu untersuchen, habe ich zwei Institutionen und eine Person für diese Arbeit ausgewählt. Ihr Verhalten gegenüber dem Völkermord an den Juden ist hierfür relevant.
Im ersten Teil steht die nationalkirchliche Bewegung ,,Deutsche Christen" im Mittelpunkt. Interessiert hat mich hier die Frage, ob die Deutschen Christen ,,nur" zu den Verbrechen an den Juden geschwiegen oder aber sie aktiv unterstützt haben. Der zweite Teil der Arbeit befaßt sich mit der Bekennenden Kirche (BK). Hier ist die Frage, ob die BK Widerstand gegen die Judenverfolgung geleistet oder aber sich einzig um sich selbst gekümmert hat, Ausgangspunkt der Untersuchung. Im Wesen des Protestantismus liegt es, daß in den Institutionen unterschiedliche Strömungen zu finden sind, wenn auch ein Konsens herrscht über gemeinsame Ziele und Aufgaben. Dies werde ich in der Untersuchung berücksichtigen. Im dritten Teil widme ich mich der Person Dietrich Bonhoeffers. Der Berliner Privatdozent für evangelische Theologie war zwar Mitglied der Bekennenden Kirche, hat sich aber schon früh mit für seine Zeit ungewöhnlichen Auffassungen zu den Themen Rassenideologie der Nazis und Judenverfolgung hervorgetan und von der BK isoliert. Auch sein Schritt in die Konspiration, in der er als bekennender Pazifist auch Gewalt zur Stürzung Hitlers befürwortete, hebt sich von der allgemeinen Auffassung der BK ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Deutschen Christen
- Die Anfänge
- Die Godesberger Erklärung 1939 und die Folgen
- Die Bekennende Kirche
- Auseinandersetzungen um den Arierparagraphen
- Hilfe für verfolgte Juden
- Dietrich Bonhoeffer
- „Die Kirche vor der Judenfrage“
- Bonhoeffers Weg in die Konspiration
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das ambivalente Verhalten evangelischer Christen im Naziregime gegenüber dem Völkermord an den Juden. Sie analysiert die Reaktionen verschiedener Gruppen innerhalb der evangelischen Kirche, um das Ausmaß der Zustimmung, des Widerstands und des Schweigens zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die "Deutschen Christen", die Bekennende Kirche und die Person Dietrich Bonhoeffers als exemplarische Fälle.
- Das Spektrum der Reaktionen evangelischer Christen auf den Nationalsozialismus und die Judenverfolgung
- Die Rolle der "Deutschen Christen" und ihre Haltung zum Antisemitismus
- Der Widerstand der Bekennenden Kirche und ihre Unterstützung verfolgter Juden
- Dietrich Bonhoeffers kritischer Standpunkt und sein Weg in den Widerstand
- Die Auswirkungen des Konflikts innerhalb der evangelischen Kirche auf die heutige EKD
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Hintergrund der Arbeit und stellt die Forschungsfrage nach dem ambivalenten Verhalten evangelischer Christen im Nationalsozialismus dar. Sie skizziert die drei zentralen Untersuchungsschwerpunkte: die "Deutschen Christen", die Bekennende Kirche und Dietrich Bonhoeffer. Die Einleitung betont die unterschiedlichen Reaktionen innerhalb der evangelischen Kirche und deren Relevanz für die heutige EKD.
Die Deutschen Christen: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und Ideologie der "Deutschen Christen". Es beleuchtet deren nationalsozialistische Ausrichtung, den zunehmenden Antisemitismus in ihren Schriften und ihren aktiven Beitrag zur Diskriminierung und Verfolgung jüdischer Christen. Die Einführung des Arierparagraphen in der Kirche wird als ein entscheidender Schritt in Richtung der Ausgrenzung und Verfolgung von Juden dargestellt. Das Kapitel zeigt, dass die „Deutschen Christen“ nicht nur passiv zum Holocaust schwiegen, sondern aktiv an der Judenverfolgung beteiligt waren.
Schlüsselwörter
Evangelische Kirche, Naziregime, Deutsche Christen, Bekennende Kirche, Dietrich Bonhoeffer, Antisemitismus, Widerstand, Judenverfolgung, Arierparagraph, Nationalsozialismus.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Evangelische Christen im Nationalsozialismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das ambivalente Verhalten evangelischer Christen im Nationalsozialismus gegenüber dem Völkermord an den Juden. Sie analysiert die Reaktionen verschiedener Gruppen innerhalb der evangelischen Kirche, um das Ausmaß der Zustimmung, des Widerstands und des Schweigens zu beleuchten.
Welche Gruppen werden im Einzelnen betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei zentrale Gruppen: die "Deutschen Christen", die Bekennende Kirche und die Person Dietrich Bonhoeffers als exemplarische Fälle. Diese repräsentieren ein breites Spektrum an Reaktionen auf den Nationalsozialismus und die Judenverfolgung.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Die Arbeit beleuchtet das Spektrum der Reaktionen evangelischer Christen auf den Nationalsozialismus und die Judenverfolgung, die Rolle der "Deutschen Christen" und ihre Haltung zum Antisemitismus, den Widerstand der Bekennenden Kirche und ihre Unterstützung verfolgter Juden, Dietrich Bonhoeffers kritischen Standpunkt und seinen Weg in den Widerstand sowie die Auswirkungen des Konflikts innerhalb der evangelischen Kirche auf die heutige Evangelische Kirche Deutschlands (EKD).
Wie wird die Rolle der "Deutschen Christen" dargestellt?
Das Kapitel über die "Deutschen Christen" analysiert deren Entstehung und Ideologie, ihre nationalsozialistische Ausrichtung, den zunehmenden Antisemitismus und ihren aktiven Beitrag zur Diskriminierung und Verfolgung jüdischer Christen. Die Einführung des Arierparagraphen wird als entscheidender Schritt in Richtung Ausgrenzung und Verfolgung dargestellt. Es wird deutlich, dass die „Deutschen Christen“ nicht nur passiv zum Holocaust schwiegen, sondern aktiv an der Judenverfolgung beteiligt waren.
Welche Rolle spielte die Bekennende Kirche?
Die Arbeit untersucht den Widerstand der Bekennenden Kirche und deren Bemühungen zur Unterstützung verfolgter Juden. Dies steht im Gegensatz zum Verhalten der "Deutschen Christen" und zeigt ein Beispiel für aktiven Widerstand innerhalb der evangelischen Kirche.
Wie wird Dietrich Bonhoeffer in die Analyse eingebunden?
Dietrich Bonhoeffer wird als exemplarische Figur behandelt, die den kritischen Standpunkt und den Weg in den Widerstand gegen das NS-Regime verkörpert. Seine Schriften und Handlungen werden analysiert, um sein Engagement gegen den Antisemitismus und die Judenverfolgung zu beleuchten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit beleuchtet die Ambivalenz des Verhaltens evangelischer Christen im Nationalsozialismus und zeigt die Bandbreite zwischen aktivem Widerstand, passivem Schweigen und aktiver Beteiligung an der Judenverfolgung auf. Die Auswirkungen dieses Konflikts auf die heutige EKD werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Evangelische Kirche, Naziregime, Deutsche Christen, Bekennende Kirche, Dietrich Bonhoeffer, Antisemitismus, Widerstand, Judenverfolgung, Arierparagraph, Nationalsozialismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Deutschen Christen, der Bekennenden Kirche, Dietrich Bonhoeffer und eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für alle bestimmt, die sich für die Geschichte der Evangelischen Kirche im Nationalsozialismus, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und die Rolle der Kirche im Holocaust interessieren. Sie eignet sich besonders für akademische Zwecke und die Analyse von Themen im Kontext des Nationalsozialismus.
- Arbeit zitieren
- Rauke Grimm (Autor:in), 1997, Zwischen Widerstand und Zustimmung - Die Zerrissenheit der evangelischen Christen im Naziregime am Beispiel des Völkermordes an den Juden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1624