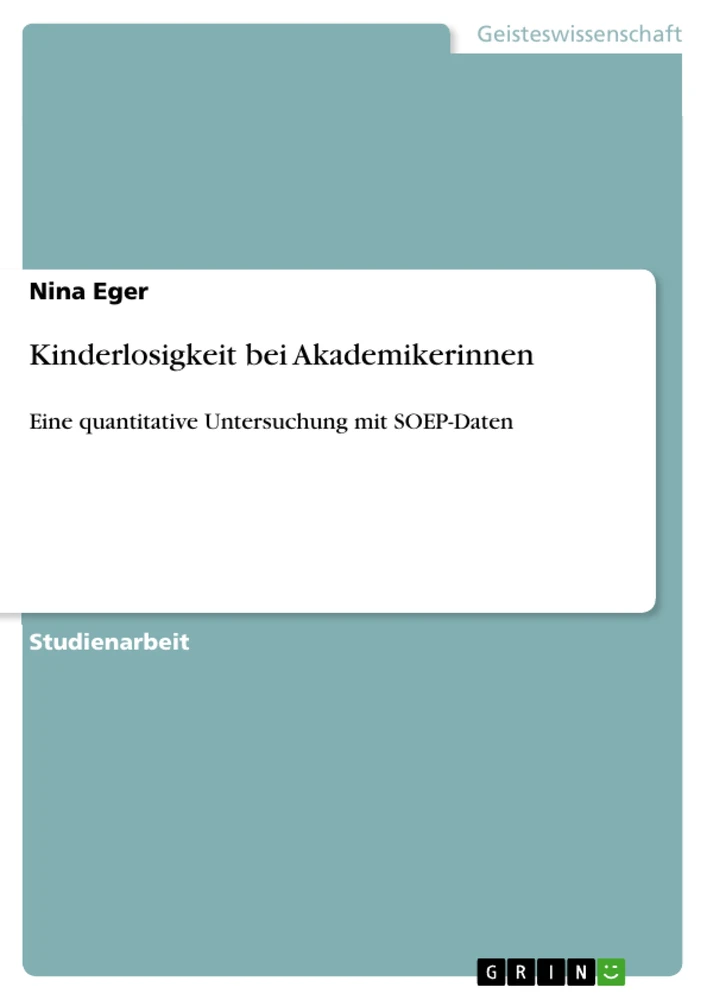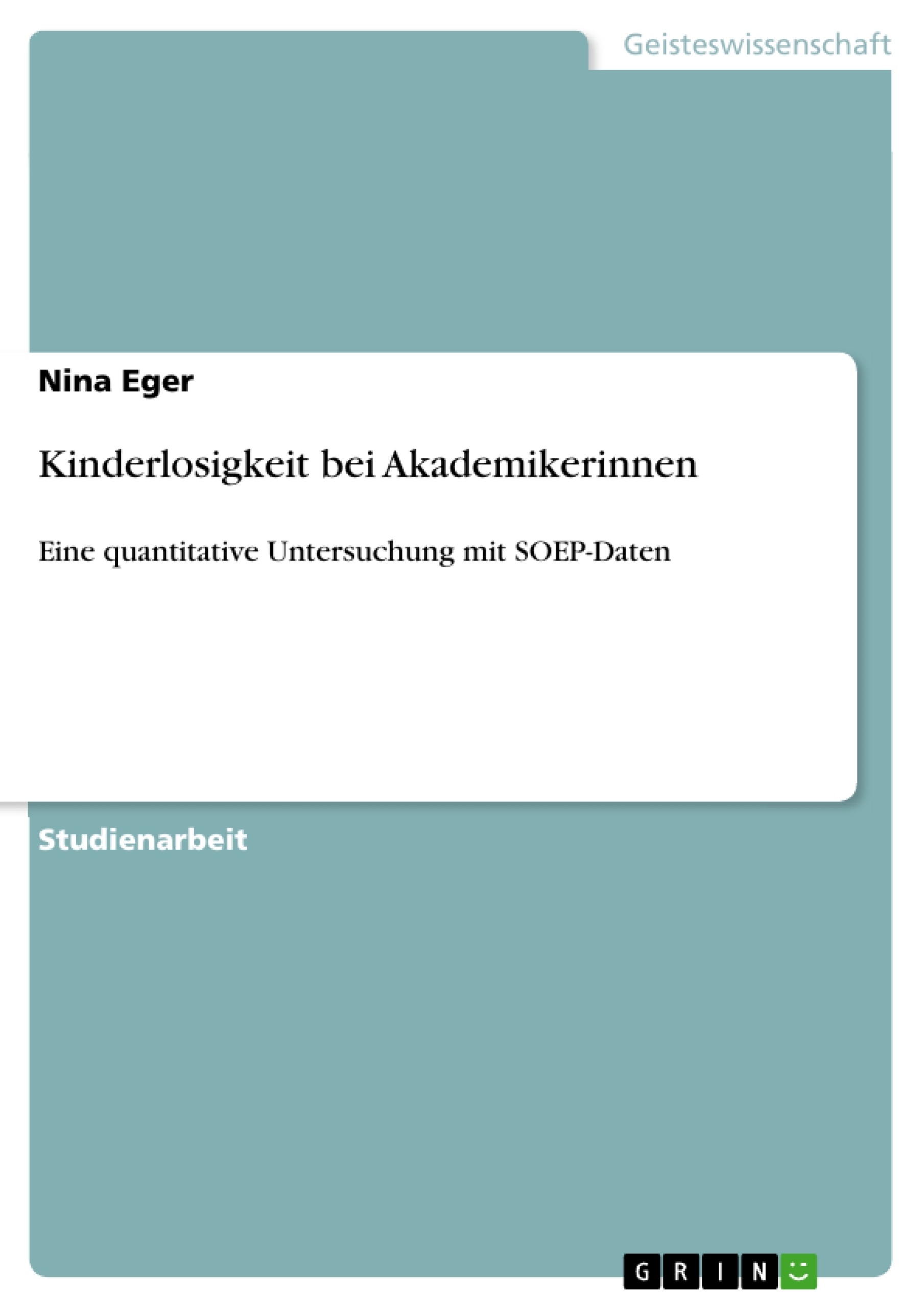Zur Erklärung der Kinderlosigkeit hoch gebildeter Frauen gibt es verschiedene Ansätze. Der Fokus dieser Arbeit soll auf zwei teilweise konkurrierenden Ansät-zen aus der Familienökonomie liegen. Der Ansatz des Humankapitaleffekts geht davon aus, dass die Entscheidung für bzw. gegen Kinder einer rationalen Kosten-Nutzen-Abwägung folgt. In der Regel weisen Frauen mit hoher Bildung und da-mit einhergehend hoch zu erwartendem Erwerbseinkommen, hohe Kosten in Be-zug auf die Mutterschaft auf. Dies wird damit begründet, dass oft noch eine ge-schlechtsspezifische Arbeitsteilung vorliege und im Falle der Entscheidung für ein Kind, Frauen entweder aus dem Beruf ausstiegen oder eine Doppelbelastung in Kauf nähmen. Die Entscheidung für Kinder bei Frauen mit hohem Bildungsniveau würde deshalb, bei angenommener geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, negativ ausfallen.
Im Gegensatz zur Theorie des Humankapitaleffekts geht die des Institutioneneffekts davon aus, dass sich die Familiengründung, bedingt durch die längeren Aus-bildungszeiten insbesondere bei den Hochgebildeten, nach hinten verschiebe. Die hoch gebildeten Frauen blieben demnach nicht dauerhaft kinderlos, sondern würden ihre Familiengründungsphase nur zeitlich nach hinten verschieben.
Die Frage, die sich stellt und der in dieser Arbeit nachgegangen wird, ist, ob sich eher empirische Belege für das Zutreffen des Humankapitaleffekts oder aber des Institutioneneffekts hinsichtlich der Kinderlosigkeit von Akademikerinnen fest-stellen lassen. Es geht also darum, ob bei den hoch gebildeten Frauen eher eine dauerhafte Kinderlosigkeit oder eine Verschiebung der Familiengründungsphase nachweisbar ist. Um dieser Frage nachzugehen, werden kurz die Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung, im Familienleitbild, in der Rolle der Frau, des Kinderwunsches und in Bezug auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dargestellt. Im Anschluss daran werden die beiden konkurrierenden familienöko-nomischen Erklärungsansätze zur Kinderlosigkeit mit den bestehenden kritischen Einwänden erläutert. In dem sich anschließenden empirischen Teil wird zunächst auf den gewählten Datensatz des Sozio-ökonomischen Panels eingegangen. Im Anschluss daran wird die Operationalisierung der verwendeten Variablen erläu-tert. Daran schließt sich die Charakterisierung des Datensatzes sowie die Auswertung an. Im Fazit wird mit einem Resümee auf die Fragestellung geantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesellschaftliche Veränderungen
- Bevölkerungsentwicklung
- Familienleitbild und Rolle der Frau
- Kinderwunsch
- Rahmenbedingungen
- Erklärungsansätze der Kinderlosigkeit
- Humankapitaleffekt
- Institutioneneffekt
- Kritische Einwände
- Zusammenfassung und Hypothesengenerierung
- Empirische Untersuchung
- Wahl des Datensatzes
- Operationalisierung
- Akademikerinnen
- Dauerhafte Kinderlosigkeit
- Erstgebäralter
- Familienstand
- Erwerbsstatus
- Charakterisierung des Datensatzes
- Gesamtsample
- Westdeutsches Sample
- Ostdeutsches Sample
- Analyse
- Methode
- Auswertung
- Gesamtsample
- Humankapitaleffekt
- Institutioneneffekt
- Westdeutsches Sample
- Humankapitaleffekt
- Institutioneneffekt
- Ostdeutsches Sample
- Humankapitaleffekt
- Institutioneneffekt
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen der Kinderlosigkeit von Akademikerinnen zu untersuchen. Sie befasst sich mit zwei konkurrierenden Erklärungsansätzen aus der Familienökonomie: dem Humankapitaleffekt und dem Institutioneneffekt. Die Arbeit analysiert, ob sich empirische Belege für das Zutreffen eines der beiden Effekte finden lassen und ob die Kinderlosigkeit von Akademikerinnen eher eine dauerhafte Entscheidung oder eine zeitliche Verschiebung der Familiengründungsphase darstellt.
- Gesellschaftliche Veränderungen in Bezug auf Bevölkerungsentwicklung, Familienleitbild, Rolle der Frau, Kinderwunsch und Rahmenbedingungen
- Der Humankapitaleffekt als Erklärungsansatz für Kinderlosigkeit
- Der Institutioneneffekt als Erklärungsansatz für Kinderlosigkeit
- Empirische Untersuchung der Kinderlosigkeit von Akademikerinnen mithilfe des Sozio-ökonomischen Panels
- Analyse der Daten und Interpretation der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den aktuellen Stand der Debatte um die sinkende Geburtenrate und die steigende Kinderlosigkeit in Deutschland dar. Sie führt in die Thematik der Kinderlosigkeit von Akademikerinnen ein und erläutert die beiden Erklärungsansätze, die in der Arbeit untersucht werden.
Das zweite Kapitel beleuchtet die wesentlichen gesellschaftlichen Veränderungen in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung, das Familienleitbild und die Rolle der Frau, den Kinderwunsch sowie auf die Rahmenbedingungen. Dieses Kapitel liefert den Kontext für die Analyse der Kinderlosigkeit von Akademikerinnen.
Das dritte Kapitel diskutiert die beiden konkurrierenden Erklärungsansätze aus der Familienökonomie, den Humankapitaleffekt und den Institutioneneffekt. Es werden die Argumente und kritischen Einwände zu diesen Ansätzen erläutert.
Das vierte Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung. Es werden der gewählte Datensatz, die Operationalisierung der Variablen, die Charakterisierung des Datensatzes sowie die Analyse und Auswertung der Daten vorgestellt.
Schlüsselwörter
Kinderlosigkeit, Akademikerinnen, Humankapitaleffekt, Institutioneneffekt, Familienökonomie, Sozio-ökonomisches Panel, Bevölkerungsentwicklung, Familienleitbild, Rolle der Frau, Kinderwunsch, Rahmenbedingungen, empirische Untersuchung, Analyse, Auswertung
Häufig gestellte Fragen
Was besagt der Humankapitaleffekt bei Akademikerinnen?
Er geht davon aus, dass hochgebildete Frauen aufgrund hoher Opportunitätskosten (entgangenes Einkommen) häufiger kinderlos bleiben.
Was versteht man unter dem Institutioneneffekt?
Dieser besagt, dass sich die Familiengründung bei Akademikerinnen aufgrund langer Ausbildungszeiten lediglich zeitlich nach hinten verschiebt.
Bleiben Akademikerinnen dauerhaft kinderlos oder verschieben sie nur?
Die Arbeit untersucht empirisch, ob Akademikerinnen tatsächlich kinderlos bleiben oder ob es sich primär um einen Aufschub der Familiengründung handelt.
Welche Rolle spielt das Sozio-ökonomische Panel (SOEP) in dieser Studie?
Das SOEP dient als Datengrundlage für die empirische Analyse der Geburtenbiographien von Akademikerinnen in Deutschland.
Gibt es Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland?
Ja, die Untersuchung analysiert getrennte Samples für West- und Ostdeutschland, um regionale Unterschiede in der Kinderlosigkeit aufzuzeigen.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Nina Eger (Author), 2009, Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160253