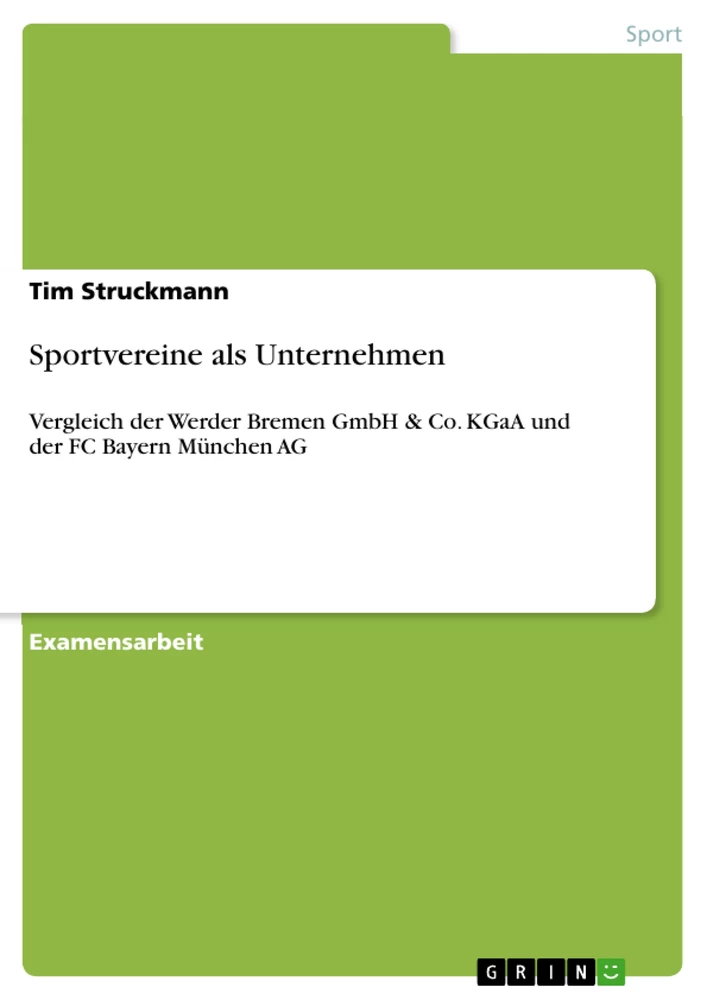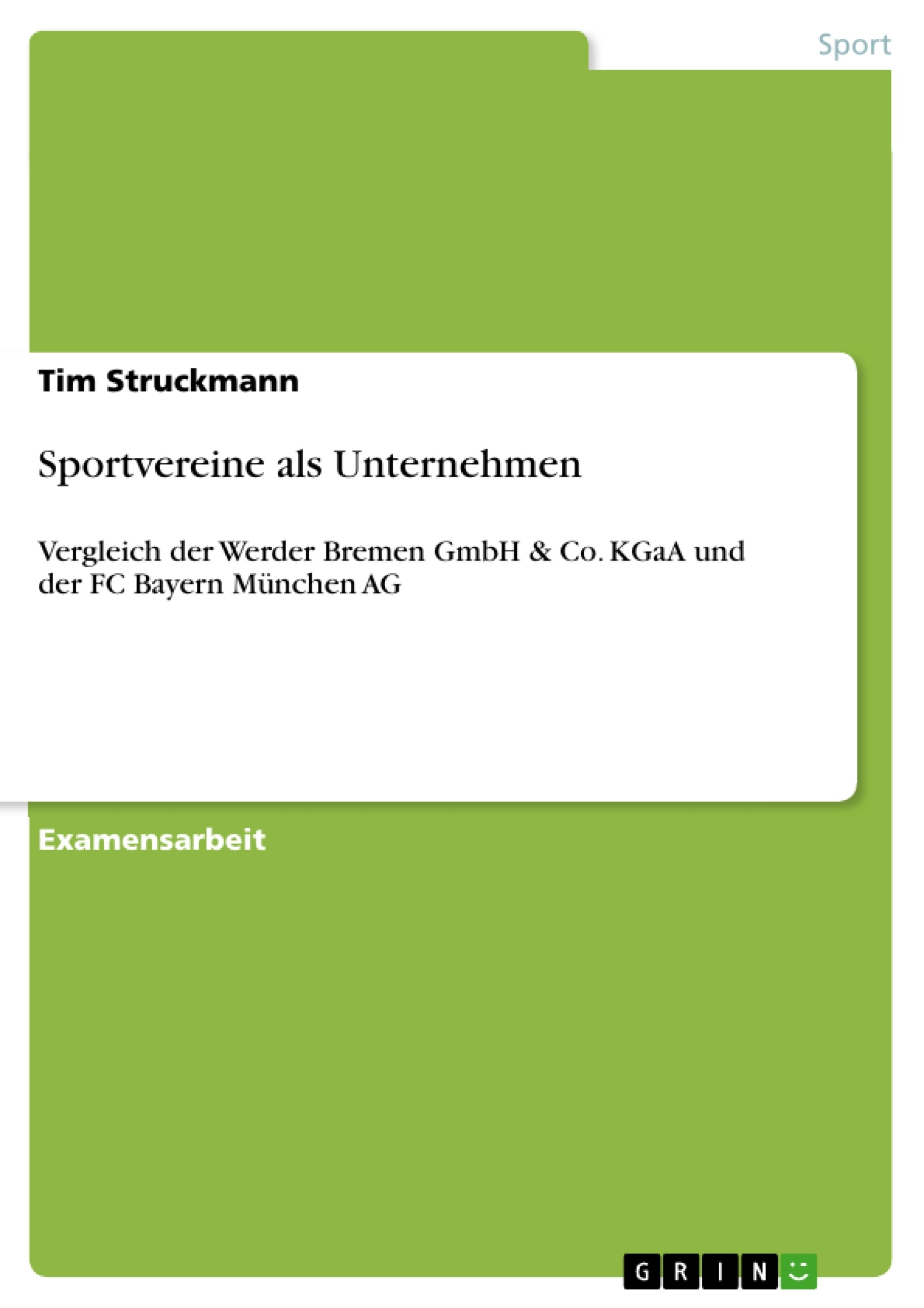Die Kommerzialisierung des Profi-Fußballs in Deutschland
Spätestens seit der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland weiß jeder deutsche Bürger, welch einen Stellenwert der Fußball in unserer Gesellschaft einnimmt. Woche für Woche strömen hunderttausende, leidenschaftliche Sympathisanten und Fans in die Fußballtempel in der Republik, Millionen fiebern dem anstehenden Bundesliga-Spieltag vor den Fernsehschirmen entgegen.
Ob im Fantrikot mit Stadionwurst und Bier im Plastikbecher in der Hand oder im eleganten Anzug mit Champagnerglas und eurasischem Fingerfood: der Fußball ist keineswegs mehr eine reine Sportveranstaltung, sondern zu einem glamourösen, gesellschaftlichen Großereignis mutiert. Da fachsimpelt der Lagerist mit dem renommierten Rechtsanwalt auf der Tribüne über den Fehlpass des Lieblingsspielers und der bekannte Herzchirurg fällt dem einfachen Arbeiter beim Tor seiner Mannschaft um den Hals. In der Loge bewirtet der lokale Großunternehmer die für ihn nützlichen Geschäftspartner, um zwischen Abseitsstellungen und Freistößen schon einmal über kommende Wirtschaftsprojekte zu philosophieren und Geschäfte anzubahnen. Der Fußball verbindet… Er überbrückt Differenzen zwischen Menschen aus verschiedensten sozialen Schichten und fördert das Miteinander innerhalb der Gesellschaft. Doch rückt der sportliche Aspekt und Reiz nach und nach weiter in die Ferne.
Der moderne Fußball ist ein Spagat zwischen Fans und Weltfirmen, zwischen emotionalen Hoch- und Tiefpunkten und Kommerz, zwischen Wettskandalen, Spielertransfers in Millionenhöhe, internationalen Wettbewerben und einer Zukunft nach der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.
Auf den nachfolgenden Seiten werde ich deshalb zunächst auf die grundlegenden Strukturänderungen eingehen, die die Kommerzialisierung des Profifußballs innerhalb Deutschlands ermöglicht und vorangetrieben haben, die Begrifflichkeiten Verein und wirtschaftliche Unternehmung definieren und voneinander abgrenzen, bevor ich mich später mit zwei erfolgreichen Kapitalgesellschaften der ersten Fußball-Bundesliga beschäftigen werde: der FC Bayern München AG sowie der Werder Bremen GmbH & Co. KGaA. Anhand dieser grundverschieden strukturierten und geführten Clubs werde ich die Rechtsformen der GmbH & Co. KGaA sowie die der Aktiengesellschaft (AG) erläutern, kurz auf die Struktur innerhalb der jeweiligen Kapitalgesellschaft eingehen und abschließend die beiden Rechtsformen mit ihren Vor- und Nachteilen im Hinblick auf Sportvereine vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Kommerzialisierung des Profi-Fußballs in Deutschland
- Rechtliche Rahmenausgestaltung des DFB
- Satzungsänderung des DFB – Eine Reformierung des Profifußballs
- Die „,50+1 Regel\" des DFB
- Eingetragener Verein oder wirtschaftliche Unternehmung
- Der eingetragene Verein (e.V.)
- Der Begriff,Unternehmung‘
- Zwei Clubs - Unterschiedliche Gesellschaftsformen
- Werder Bremen GmbH & Co. KGaA
- Vereinsprofil & sportliche Erfolge
- Die GmbH & Co. KGaA - Theorie & Praxis
- FC Bayern München AG
- Vereinsprofil & sportliche Erfolge
- Die Aktiengesellschaft – Theorie & Praxis
- Werder Bremen GmbH & Co. KGaA
- Der Vergleich der KGaA und der AG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Kommerzialisierung des Profi-Fußballs in Deutschland am Beispiel der Vereine Werder Bremen und FC Bayern München. Im Fokus steht der Wandel von Sportvereinen zu Unternehmen und die damit einhergehende Ausgliederung der Lizenzspielerabteilungen in rechtlich selbstständige Kapitalgesellschaften. Die Arbeit untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen, die durch den DFB geschaffen wurden, und beleuchtet die unterschiedlichen Gesellschaftsformen der beiden Vereine: die GmbH & Co. KGaA (Werder Bremen) und die Aktiengesellschaft (FC Bayern München).
- Entwicklung der Kommerzialisierung im Profi-Fußball
- Rechtliche Rahmenbedingungen des DFB
- Vergleich der Gesellschaftsformen GmbH & Co. KGaA und Aktiengesellschaft
- Analyse der Vereinsstrukturen von Werder Bremen und FC Bayern München
- Vorteile und Nachteile der jeweiligen Gesellschaftsformen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Kommerzialisierung im deutschen Profi-Fußball. Das zweite Kapitel widmet sich den rechtlichen Rahmenbedingungen des DFB, insbesondere der Satzungsänderung und der „,50+1 Regel\". Das dritte Kapitel definiert den Begriff „Unternehmung“ und unterscheidet ihn vom eingetragenen Verein. Im vierten Kapitel werden die beiden Vereine Werder Bremen und FC Bayern München vorgestellt, wobei die jeweiligen Gesellschaftsformen und deren theoretische und praktische Umsetzung im Detail erläutert werden. Das fünfte Kapitel schließlich vergleicht die gewählten Gesellschaftsformen KGaA und AG und beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Modelle.
Schlüsselwörter
Kommerzialisierung, Profi-Fußball, Sportvereine, Unternehmen, DFB, Satzungsänderung, 50+1 Regel, eingetragener Verein, Unternehmung, GmbH & Co. KGaA, Aktiengesellschaft, Werder Bremen, FC Bayern München, Vergleich, Gesellschaftsformen.
- Arbeit zitieren
- Tim Struckmann (Autor:in), 2010, Sportvereine als Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159562