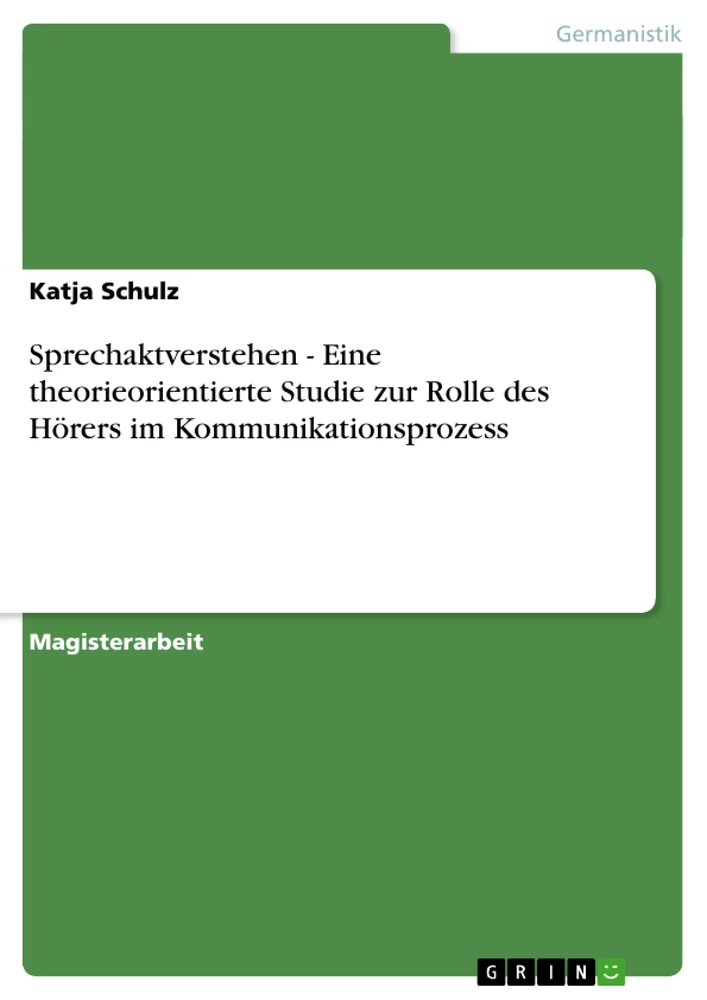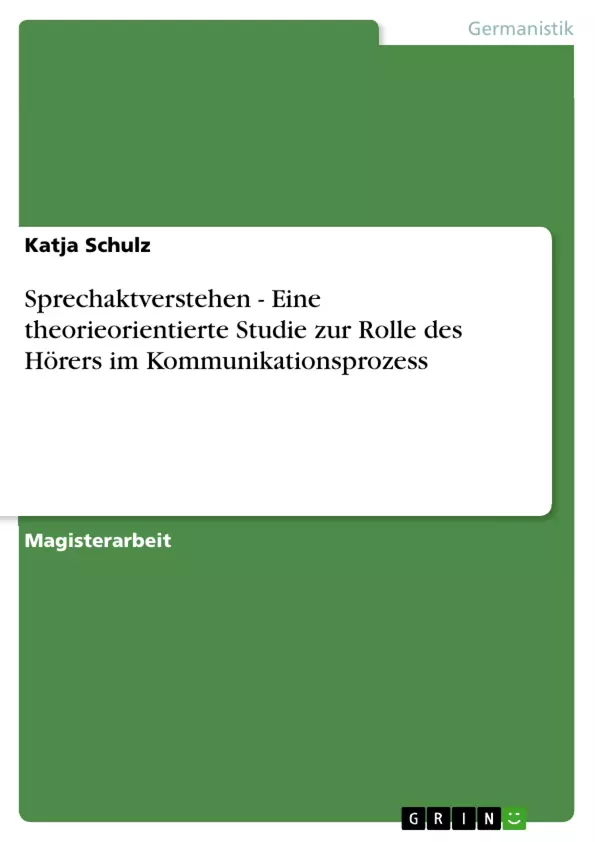Der Sprecher hat die Absicht, beim Hörer eine bestimmte Reaktion zu bewirken. Dazu stehen ihm verschiedene sprachliche Möglichkeiten zur Verfügung, aus denen er entsprechend der gegebenen Umstände eine auswählt. Um dem Hörer ein Erkennen der Absicht zu ermöglichen, versieht er die sprachliche Form mit einer bestimmten Funktion. Es gibt also mehrere Aspekte, die vom Sprecher mit einer Äußerung übermittelt und vom Hörer empfangen werden. In der vorliegenden Arbeit wird daher untersucht, welche Teilakte des Verstehens ein Hörer vollzieht und wie diese ablaufen. Darüber hinaus werden die Bedingungen und Voraussetzungen, die den Verstehensprozess konstituieren, darstellt und untersucht, inwieweit diese Faktoren auf das Verständnis einwirken. Da Kommunikationspartner nicht einfach fixe Daten austauschen, sondern sprachliche Handlungen vollziehen, wird der Verstehensprozess als ein Verstehen von Sprechakten untersucht. Ziel ist es, einen Ansatz für eine interdisziplinäre theoretische Modellierung des Verstehens zu entwickeln, das ausgehend vom Handlungscharakter sprachlicher Äußerungen die Ergebnisse verschiedener Wissenschaftsdisziplinen zum Prozess des Verstehens berücksichtigt. Es geht somit um den Anspruch, der Sprechakttheorie Überlegungen zu einer Hörerverstehenstheorie an die Seite zu stellen, um den gesamten Kommunikationsakt möglichst vollständig abbilden zu können.
Teil I der Arbeit behandelt den Prozess des Sprechaktverstehens. Für die Untersuchung grundlegend erfolgt zunächst eine Darstellung der Sprechakttheorie (Austin, Searle). In Analogie zu den Teilakten werden Verstehensakte entwickelt. Für die Untersuchung des Verstehen des Gesagten (Lokution) habe ich mich auf Forschungsergebnisse aus den Bereichen der Psycholinguistik und Neuropsychologie gestützt. Die Theorie der konversationellen Implikaturen (Grice) dient als Grundlage der Untersuchung des Verstehen des Gemeinten (Illokution, Perlokution). Der 2. Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den wesentlichen Faktoren des Verstehensprozesses und behandelt u. a. folgende Fragen:
Wie gibt der Sprecher über Kontextualisierungsverfahren dem Hörer Hinweise, welches Wissen dieser aktivieren muss, um die Äußerung angemessen zu verstehen? Welches (Hintergrund-)Wissen ist im Akt des Verstehens relevant? Wie ist dieses Wissen strukturiert (Frame-Theorie)? Welchen Einfluss hat diese Struktur auf das Verstehen? Wie werden in einer konkreten Situation, diese Wissensstrukturen im Verstehensprozess aktiviert?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 „Weißt du, was ich meine?“
- 1.2 Methodisches Vorgehen
- Teil I Verstehensprozess
- 2 Grundlegende Begriffe
- 2.1 Was heißt Verstehen?
- 2.2 Was ist der Sinn sprachlicher Ausdrücke?
- 3 Sprechakttheorie nach Austin und Searle
- 3.1 Ausgangspunkt der Sprechakttheorie: Performative und Konstative
- 3.2 Teilakte eines Sprechaktes nach Austin und Searle
- 3.2.1 Lokutionärer Sprechakt
- 3.2.2 Illokutionärer Sprechakt
- 3.2.3 Perlokutionärer Sprechakt
- 3.3 Sprechaktregeln
- 3.4 Signalisierung von Illokutionen
- 3.5 Indirekte Sprechakte
- 3.6 Zusammenfassung und Kritik
- 4 Verstehens-Teilakte in Analogie zu den Teilakten eines Sprechaktes
- 4.1 Lokutionärer Verstehensakt
- 4.2 Illokutionärer Verstehensakt
- 4.3 Perlokutionärer Verstehensakt
- 4.4 Bottom-up oder Top-down
- 5 Verstehen der Lokution: Das Gesagte
- 5.1 Sprachwahrnehmung (das Phon)
- 5.2 Syntaktische Rezeption (das Phem)
- 5.3 Verstehen der Proposition (das Rhem)
- 6 Verstehen der Illokution und Perlokution: Das Gemeinte
- 6.1 Sagen und Meinen
- 6.2 Sprecherbedeutung und Sprechaktbedeutung
- 6.3 Kooperationsprinzip und Konversationsmaximen
- 6.4 Implikaturen
- 6.4.1 Implikaturtypen
- 6.4.2 Eigenschaften konversationeller Implikaturen
- 6.5 Umdeutungsverfahren
- 6.5.1 Konversationelle Implikaturen
- 6.5.2 Arten der Nicht-Beachtung von Konversationsmaximen
- 6.5.3 Ablauf des Umdeutungsverfahrens
- 6.6 Verstehen des Gemeinten
- 6.7 Kritik der Griceschen Implikaturtheorie
- 7 Zusammenfassung Teil I
- Teil II Voraussetzungen und Einflussfaktoren des Verstehensprozesses
- 8 Kontextualisierung
- 8.1 Der Begriff Kontext
- 8.2 Konzept der Kontextualisierung
- 8.2.1 Kontextualisierungsverfahren
- 8.2.2 Kontextualisierungshinweise
- 8.3 Einfluss der Kontextualisierung auf das Verstehen
- 9 Verstehensrelevantes Wissen
- 9.1 „Verstehensraum“
- 9.2 Ebenen verstehensrelevanten Wissens
- 9.3 Typen verstehensrelevanten Wissens
- 9.4 Modus des verstehensrelevanten Wissens
- 9.5 Einfluss des Wissens auf den Verstehensprozess
- 10 Wissensrepräsentation: Frame-Theorie
- 10.1 Grundidee
- 10.2 Forschungsansätze
- 10.2.1 Ursprung des Frame-Konzepts: Bartletts Schema-Begriff
- 10.2.2 Frames in der „Künstlichen Intelligenz-Forschung“
- 10.2.3 Frames in der Linguistik
- 10.2.4 Frames und Schemata
- 10.3 Frames: Strukturierung von Hintergrundwissen
- 10.3.1 Netzwerkstruktur von Frames
- 10.3.2 Leerstellen, Standardwerte und konkrete Füllwerte
- 10.3.3 Generierung von Frames
- 10.3.4 Variabilität von Frames
- 10.4 Frames im Verstehensprozess
- 11 Inferenzen
- 11.1 Der Begriff „Inferenz“
- 11.2 Arten von Inferenzen
- 11.3 Inferenztheorien
- 11.4 Inferenzen im Verstehensprozess
- 12 Zusammenfassung Teil II
- 13 Schlussbetrachtung: Grenzen und Möglichkeiten des Verstehens
- Die Bedeutung des Verstehens in der sprachlichen Kommunikation
- Die Sprechakttheorie als theoretisches Fundament für die Analyse des Verstehensprozesses
- Die Teilakte des Verstehens in Analogie zu den Teilakten des Sprechaktes
- Der Einfluss von Kontextualisierung und verstehensrelevantem Wissen auf den Verstehensprozess
- Die Rolle von Inferenzen und der Frame-Theorie im Verstehensprozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit zielt darauf ab, den Verstehensprozess in der Kommunikation aus einer theorieorientierten Perspektive zu beleuchten. Im Mittelpunkt steht dabei die Rolle des Hörers und die Prozesse, die er im Akt des Verstehens durchläuft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema „Sprechaktverstehen“ und stellt die Relevanz des Verstehensprozesses in der alltäglichen Kommunikation heraus.
Teil I beschäftigt sich mit dem Verstehensprozess selbst. Es werden grundlegende Begriffe wie „Verstehen“ und „Sinn sprachlicher Ausdrücke“ definiert und die Sprechakttheorie nach Austin und Searle als theoretisches Fundament eingeführt. Die einzelnen Teilakte eines Sprechaktes werden vorgestellt und in Analogie zu den Teilakten des Verstehens gesetzt.
Weiterhin werden die Bereiche „Verstehen der Lokution“ und „Verstehen der Illokution und Perlokution“ genauer beleuchtet, wobei die Konzepte der Sprachwahrnehmung, der syntaktischen Rezeption und der Proposition sowie der Sprecherbedeutung und Sprechaktbedeutung im Fokus stehen. Das Kooperationsprinzip und die Konversationsmaximen nach Grice werden erörtert, und die Rolle von Implikaturen und Umdeutungsverfahren im Verstehensprozess wird untersucht.
Teil II widmet sich den Voraussetzungen und Einflussfaktoren des Verstehensprozesses. Dabei werden die Bedeutung von Kontextualisierung und verstehensrelevantem Wissen sowie die Rolle der Wissensrepräsentation und der Inferenzbildung behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Sprechaktverstehen, der Rolle des Hörers im Kommunikationsprozess, der Sprechakttheorie, der Teilakte des Verstehens, der Kontextualisierung, dem verstehensrelevanten Wissen, der Frame-Theorie und den Inferenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der Sprechakttheorie?
Die Sprechakttheorie (nach Austin und Searle) betrachtet sprachliche Äußerungen als Handlungen. Man unterscheidet dabei Lokution (Sagen), Illokution (Absicht) und Perlokution (Wirkung).
Welche Rolle spielt der Hörer im Kommunikationsprozess?
Der Hörer vollzieht aktive Verstehens-Teilakte. Er muss nicht nur die Wörter erkennen, sondern auch die Absicht des Sprechers und den Kontext interpretieren, um die Äußerung korrekt zu verstehen.
Was sind konversationelle Implikaturen nach Grice?
Implikaturen sind Bedeutungsanteile, die ein Sprecher andeutet, ohne sie explizit auszusprechen. Der Hörer erschließt diese durch das Kooperationsprinzip und Konversationsmaximen.
Was besagt die Frame-Theorie in der Linguistik?
Frames sind Wissensstrukturen (Schemata), die typische Situationen oder Objekte repräsentieren. Sie helfen dem Hörer, Informationen einzuordnen und Lücken im Gesagten durch Hintergrundwissen zu füllen.
Was versteht man unter Kontextualisierungshinweisen?
Das sind Hinweise (wie Intonation, Mimik oder Wortwahl), mit denen der Sprecher dem Hörer signalisiert, welcher Kontext oder welches Wissen zur Interpretation der Nachricht nötig ist.
Wie unterscheiden sich Lokution, Illokution und Perlokution beim Verstehen?
Der Hörer muss erst die sprachliche Form verstehen (Lokution), dann die kommunikative Absicht erkennen (Illokution) und schließlich die beabsichtigte Reaktion verarbeiten (Perlokution).
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Kauffrau Katja Schulz (Autor:in), 2010, Sprechaktverstehen - Eine theorieorientierte Studie zur Rolle des Hörers im Kommunikationsprozess, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159215