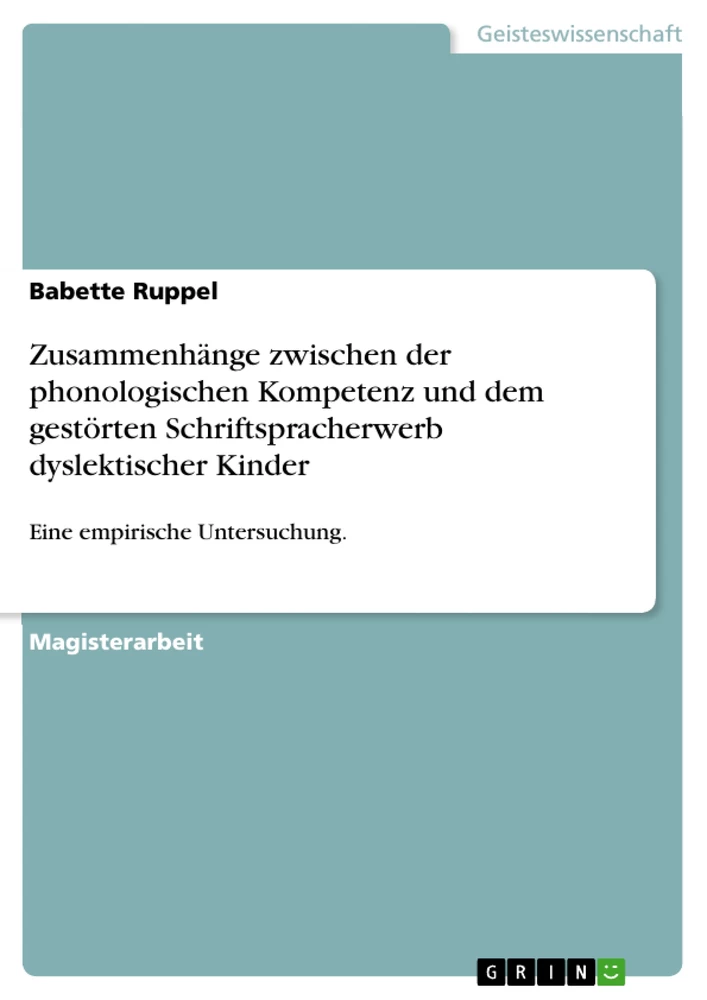1. Kapitel: Erläuterung der Relevanz der Dyslexieforschung sowie Berührungspunkte mit Sprachentwicklungsstörungen. Darstellung der aktuellen Forschungslage und des angenommenen gemeinsamen Kerndefizit der phonologischen Verarbeitungskompetenz. Hinweis zu problematischen Methoden im Forschungsdiskurs. Formulierung der Forschungshypothese.
Kapitel 2: Prinzipien der deutschen Phonetik und Phonologie. Da Dyslexien trotz einiger Überschneidungen in unterschiedlichen Sprachen verschiedene Störungsschwerpunkte haben können,
wird bei der Beschreibung des phonologisch-phonematischen Erwerbs zwischen internationalen und nationalen Befunden unterschieden.
Kapitel 3: Erläuterung des Konstrukts der "Phonologischen Bewusstheit". Neben Befunden zum ungestörten Erwerbsverlauf werden die meistgenutzten Testaufgaben zur Erfassung der PB vorgestellt und kritisch diskutiert.
Kapitel 4: Modelle und Prinzipien, die den ungestörten Lese- und Schriftspracherwerb zu erklären versuchen. Max Colthearts Modelle zum Worterwerb erfahren wegen ihrer stabilen Ergebnisse besondere Betrachtung.
Kapitel 5: Fokussierung auf die beiden relevanten Störungskomplexe SES und Dyslexie (Sprachmaterial vergleichend englisch/deutsch). Aus dem großen Bereich der SES wird die phonologisch begründete Aussprachestörung als spezifische SES ausgewählt und wegen ihrer unterschiedlichen Ausprägungen in Subtypen klassifiziert.
Kapitel 6: Klassifikation von Dyslexien. Vorstellung der fuer die Arbeit relevanten beiden Dyslexietypen und deren Verursacherkonzepte.
Kapitel 7: Methodik der empirischen Studie, an der über 70 Berliner Grundschüler teilnahmen. Die Studie dient der Hypothesenprüfung, dass isoliert rechtschreibgestörte Kinder größere Defizite in der phonologischen Verarbeitung aufweisen werden, als isoliert lesegestörte Kinder und Kontrollkinder.
Das Vorgehen wird erklärt und die Ergebnisse werden berichtet.
Kapitel 8: Interpretation und Diskussion der Ergebnisse im aktuellen Forschungskontext.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der Phonetik und der Phonologie
- 2.1 Phonetik der deutschen Sprache
- 2.1.1 Vokale
- 2.1.2 Konsonanten
- 2.2 Phonologie der deutschen Sprache
- 2.3 Befunde zum Erwerb der phonologisch-phonematischen Kompetenz
- 2.4 Befunde zum Erwerb der phonologisch-phonematischen Kompetenz im Deutschen
- 2.1 Phonetik der deutschen Sprache
- 3. Phonologische Bewusstheit
- 3.1 Entwicklung der Phonologischen Bewusstheit
- 3.1.1 Wortphonologie: Segmentierung von Wörtern und Silben
- 3.1.2 Reime
- 3.1.3 Phonemdifferenzierung und -identifikation, Phonemmanipulation
- 3.1.4 Silbenfolgen wiederholen
- 3.2 Einordnung des Konstrukts „Phonologische Bewusstheit“ in den Kontext der Phonologischen Kompetenz
- 3.1 Entwicklung der Phonologischen Bewusstheit
- 4. Modellvorstellungen zum ungestörten Lese- und Schriftspracherwerb
- 4.1 Das Drei-Stufen-Modell nach Uta Frith (1985)
- 4.2 Das Vier-Phasen-Modell nach Linnea Ehri (1998)
- 4.3 Modelle zur Worterkennung
- 4.3.1 Das Zwei-Routen-Kaskadenmodell nach Max Coltheart et al. (2003)
- 4.3.2 Kritische Betrachtung des Zwei-Routen-Kaskadenmodells
- 4.3.3 Adaption des Zwei-Routen-Kaskadenmodells fürs Deutsche
- 5. Phonologisch begründete Aussprachestörungen
- 5.1 Psycholinguistisches Klassifikationsmodell nach Barbara Dodd (1995)
- 5.1.1 Artikulationsstörung
- 5.1.2 Phonologische Verzögerung
- 5.1.3 Konsequente Phonologische Störung
- 5.1.4 Inkonsequente Phonologische Störung
- 5.2 Aussprachestörungen bei deutschsprachigen Kindern
- 5.3 Sprachentwicklungsstörungen und Dyslexie
- 5.1 Psycholinguistisches Klassifikationsmodell nach Barbara Dodd (1995)
- 6. Dyslexie
- 6.1 Ätiologische Konzepte
- 6.1.1 Phonologisches Verarbeitungsdefizit
- 6.1.2 Auditiv-temporales Verarbeitungsdefizit
- 6.1.3 Genetische Befunde
- 6.1.4 Erkenntnisse aus der Neurobiologie
- 6.2 Differenzierung
- 6.2.1 Oberflächendyslexie, Phonologische Dyslexie
- 6.2.2 Doppeldefizit-Hypothese
- 6.1 Ätiologische Konzepte
- 7. Methode
- 7.1 Fragestellung
- 7.2 Design
- 7.3 Probanden
- 7.3.1 Ein- und Ausschlusskriterien
- 7.4 Erhebungsinstrumente
- 7.5 Durchführung
- 7.6 Ergebnisse
- 8. Evaluation und Diskussion der Ergebnisse
- 8.1 Was bedeuten die Ergebnisse für den Zusammenhang von SES und Dyslexie?
- 8.2 Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug auf die Ausgangsfragen
- 9. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen phonologischer Kompetenz und gestörtem Schriftspracherwerb bei dyslektischen Kindern. Ziel ist es, empirische Erkenntnisse zu diesem Thema zu liefern und bestehende Theorien zu überprüfen.
- Phonologische Kompetenz und ihre Entwicklung
- Modelle des Lese- und Schriftspracherwerbs
- Ätiologie der Dyslexie
- Phonologische Bewusstheit als Kerndefizit der Dyslexie
- Empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen phonologischer Kompetenz und Dyslexie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) bzw. Entwicklungsdyslexie ein und nennt die hohe Prävalenz dieser Störung. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten dyslektischer Kinder beim Erlernen des Alphabets, Reimen und dem Umgang mit Lauten. Die Einleitung verweist auf die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit und deren Defizite als möglichen Kern der Dyslexie, unter Bezugnahme auf internationale Forschungsliteratur, die ein phonologisches Kerndefizit postuliert.
2. Grundlagen der Phonetik und der Phonologie: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, indem es die Phonetik und Phonologie der deutschen Sprache erklärt. Es beschreibt Vokale und Konsonanten und beleuchtet den Erwerb der phonologisch-phonematischen Kompetenz im Deutschen, um das Verständnis für die späteren Kapitel zu schaffen. Das Kapitel dient als Basis für die Analyse phonologischer Defizite im Zusammenhang mit Dyslexie.
3. Phonologische Bewusstheit: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der phonologischen Bewusstheit und ihrer Entwicklung. Es analysiert verschiedene Aspekte der phonologischen Bewusstheit, wie die Segmentierung von Wörtern und Silben, das Verständnis von Reimen, die Phonemdifferenzierung und -manipulation sowie das Wiederholen von Silbenfolgen. Der Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und phonologischer Kompetenz wird erklärt, was für die Interpretation der Ergebnisse der empirischen Studie von essentieller Bedeutung ist.
4. Modellvorstellungen zum ungestörten Lese- und Schriftspracherwerb: Hier werden verschiedene Modelle des Lese- und Schriftspracherwerbs vorgestellt, unter anderem das Drei-Stufen-Modell von Uta Frith und das Vier-Phasen-Modell von Linnea Ehri. Das Kapitel analysiert detailliert das Zwei-Routen-Kaskadenmodell zur Worterkennung und dessen Adaption für die deutsche Sprache. Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen, um den gestörten Schriftspracherwerb bei Dyslexie im Vergleich zum ungestörten Erwerb zu verstehen.
5. Phonologisch begründete Aussprachestörungen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene phonologisch begründete Aussprachestörungen bei Kindern, unter Bezugnahme auf das psycholinguistische Klassifikationsmodell von Barbara Dodd. Es differenziert zwischen Artikulationsstörungen, phonologischen Verzögerungen und konsequenten/inkonsequenten phonologischen Störungen. Der Zusammenhang zwischen Aussprachestörungen und Dyslexie wird beleuchtet und bildet die Brücke zur Diskussion der Ätiologie der Dyslexie im nächsten Kapitel.
6. Dyslexie: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit dem Thema Dyslexie. Es beleuchtet verschiedene ätiologische Konzepte, wie das phonologische Verarbeitungsdefizit, das auditiv-temporale Verarbeitungsdefizit und genetische Faktoren. Neurobiologische Erkenntnisse werden ebenfalls diskutiert. Das Kapitel differenziert zwischen verschiedenen Arten von Dyslexie, wie der Oberflächendyslexie und der phonologischen Dyslexie, und führt die Doppeldefizit-Hypothese ein. Dieser umfassende Überblick über die Dyslexieforschung bildet die Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse der empirischen Studie.
7. Methode: Das Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Fragestellung, das Studiendesign, die Auswahl der Probanden (inklusive Ein- und Ausschlusskriterien), die verwendeten Erhebungsinstrumente und die Durchführung der Studie. Eine detaillierte Beschreibung der Methodik ist unerlässlich, um die Validität und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu beurteilen.
Schlüsselwörter
Dyslexie, Lese-Rechtschreibschwäche, phonologische Kompetenz, phonologische Bewusstheit, Schriftspracherwerb, Phonetik, Phonologie, empirische Untersuchung, phonologisches Verarbeitungsdefizit, auditiv-temporales Verarbeitungsdefizit, Modellvorstellungen, Sprachentwicklungsstörung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Phonologische Kompetenz und gestörter Schriftspracherwerb
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen phonologischer Kompetenz und gestörtem Schriftspracherwerb bei Kindern mit Dyslexie. Sie liefert empirische Erkenntnisse und überprüft bestehende Theorien zu diesem Thema.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die phonologische Kompetenz und ihre Entwicklung, Modelle des Lese- und Schriftspracherwerbs, die Ätiologie der Dyslexie, die phonologische Bewusstheit als Kerndefizit der Dyslexie und eine empirische Untersuchung zum Zusammenhang zwischen phonologischer Kompetenz und Dyslexie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Grundlagen der Phonetik und Phonologie, Phonologische Bewusstheit, Modellvorstellungen zum ungestörten Lese- und Schriftspracherwerb, Phonologisch begründete Aussprachestörungen, Dyslexie, Methode, Evaluation und Diskussion der Ergebnisse sowie Ausblick.
Was sind die zentralen Inhalte der einzelnen Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein. Kapitel 2 (Grundlagen) erklärt Phonetik und Phonologie. Kapitel 3 (Phonologische Bewusstheit) beschreibt das Konzept und seine Entwicklung. Kapitel 4 (Modelle) stellt verschiedene Modelle des Lese- und Schriftspracherwerbs vor. Kapitel 5 (Aussprachestörungen) untersucht phonologisch begründete Aussprachestörungen. Kapitel 6 (Dyslexie) befasst sich umfassend mit Dyslexie und ihren Ursachen. Kapitel 7 (Methode) beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Kapitel 8 (Evaluation) evaluiert und diskutiert die Ergebnisse. Kapitel 9 (Ausblick) gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschung.
Welche Modelle des Lese- und Schriftspracherwerbs werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert das Drei-Stufen-Modell nach Uta Frith, das Vier-Phasen-Modell nach Linnea Ehri und detailliert das Zwei-Routen-Kaskadenmodell zur Worterkennung inklusive seiner Adaption für die deutsche Sprache.
Welche Arten von Dyslexie werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen Oberflächendyslexie und phonologischer Dyslexie und führt die Doppeldefizit-Hypothese ein.
Welche ätiologischen Konzepte der Dyslexie werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das phonologische Verarbeitungsdefizit, das auditiv-temporale Verarbeitungsdefizit, genetische Befunde und Erkenntnisse aus der Neurobiologie als ätiologische Konzepte der Dyslexie.
Wie ist die Methodik der empirischen Untersuchung aufgebaut?
Kapitel 7 beschreibt detailliert die Fragestellung, das Studiendesign, die Probandenauswahl (inkl. Ein- und Ausschlusskriterien), die Erhebungsinstrumente und die Durchführung der Studie.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dyslexie, Lese-Rechtschreibschwäche, phonologische Kompetenz, phonologische Bewusstheit, Schriftspracherwerb, Phonetik, Phonologie, empirische Untersuchung, phonologisches Verarbeitungsdefizit, auditiv-temporales Verarbeitungsdefizit, Modellvorstellungen und Sprachentwicklungsstörung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Dyslexie, Schriftspracherwerb und phonologischer Kompetenz befassen, sowie für Lehrkräfte und Logopäden, die mit Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten arbeiten.
- Citar trabajo
- Babette Ruppel (Autor), 2008, Zusammenhänge zwischen der phonologischen Kompetenz und dem gestörten Schriftspracherwerb dyslektischer Kinder, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158335