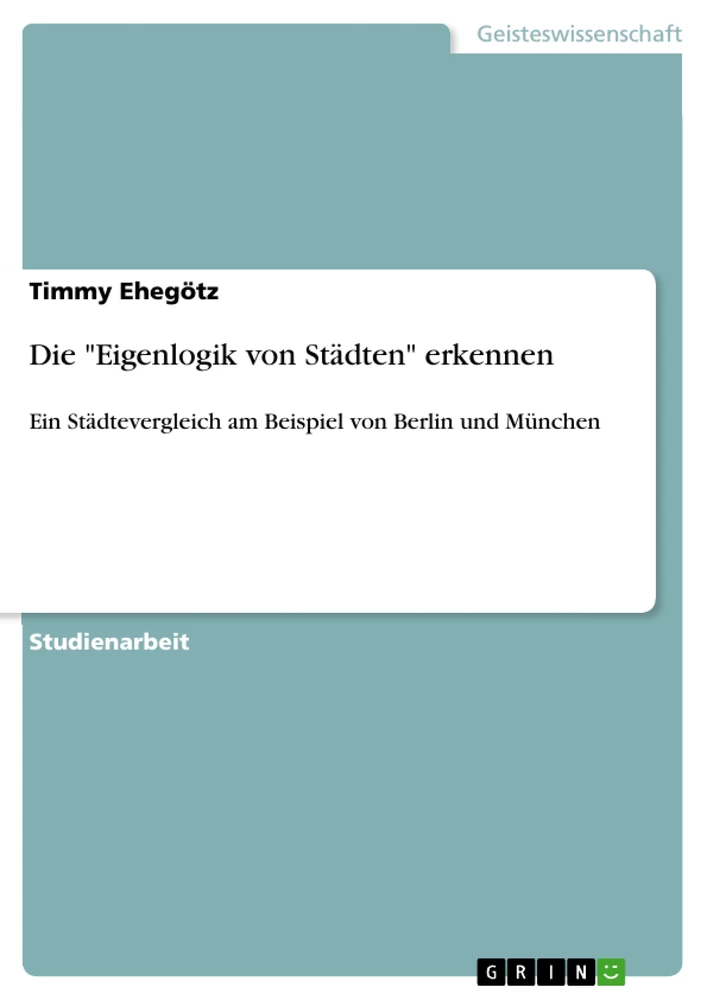Unter der Rubrik „Leben“ titelte die Süddeutsche Zeitung am 16.3.2007: „Weg aus New York. Aber wohin? München ist zu bussibussi. Hamburg zu kühl, Köln zu schwul“.
Das ZEITmagazin Leben fragte sich: „Wo wird was gegoogelt?“ und druckte die Ergebnisse der einzelnen Städte als Deutschlandkarte ab. Der Plan zeigt, dass z. B. die Einwohner Osnabrücks im Internet am meisten nach Liebe, Freiheit und Sex suchten. Die Erfurter nach Drogen und die Münchner nach Karriere, Profit, Sport und Freude.
Die Redaktion gab für diese Untersuchung 64 Begriffe vor und auch wenn diese Studie nicht wirklich repräsentativ erscheint, so kann man die Liste von Städtevergleichen mit ihren Bewohnern ohne weiteres fortführen. Diese beiden Beispiele zeigen bereits die (öffentliche) Brisanz dieses Themas auf. Es geht um die Besonderheit einer Stadt, um ihr „unique selling proposition“.
Die Eigenlogik von Städten ist ein noch relativ junger und neuer Forschungsansatz aus der Stadtforschung. Es ist der Versuch sich von den bisherigen traditionellen Forschungsmethoden zu lösen, die Orte oftmals nur mit der Analyse von Gesellschaft verbinden oder allein Sozialforschung in Städten betreiben. In den Anfängen wurde oftmals der Kontrast zwischen Stadt und Land untersucht und seit Mitte der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts lag die Aufmerksamkeit in der Stadtforschung überwiegend auf kleinräumigen Vergesellschaftungsprozessen – z. B. Milieus oder besondere Ortsteile innerhalb einer Stadt. Obwohl die Differenz im weltweiten Wettbewerb immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird die globale Angleichung erst seit Mitte der 1990er Jahre viel umfassender erforscht. Die Idee der Eigenlogik der Städte ist es, soziale Phänomene als eigenständiges, die Stadt als Ganzes sehendes Gebilde zu verstehen und zu erklären und damit die Orte selbst zu analysieren – und sich damit von den anderen Methoden zu lösen. Für die vorliegende Hausarbeit werden zwei zentrale Fragen hinsichtlich des neues Ansatzes überprüft: Was sind die wesentlichen Aussagen des Forschungsansatzes und wie kann Eigenlogik empirisch ermittelt werden?
Das zentrale methodische Instrument des neuen Forschungsansatzes, der Städtevergleich, wird in der vorliegenden Hausarbeit verwendet und zwischen Berlin und München angewandt. Dies erfolgt unter Bezugnahme des bereits durchgeführten Konnex von Martina Löw in ihrem Buch „Soziologie der Städte“ (2008).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziologische Begriffsdefinition von Stadt
- Theorie zur Eigenlogik von Städten in der Stadtforschung
- Einblicke in das Eigenlogikkonzept
- Die Differenzen zwischen Städten erkennen
- Städtevergleich
- Berlin
- München
- Konnex Berlin und München
- Literaturverzeichnis
- Internetquellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Eidesstattliche Versicherung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Forschungsansatz der „Eigenlogik von Städten“ in der Stadtforschung. Sie analysiert die zentralen Aussagen dieses Ansatzes und untersucht, wie die Eigenlogik einer Stadt empirisch ermittelt werden kann.
- Definition und Abgrenzung des Eigenlogikkonzepts von traditionellen Ansätzen in der Stadtforschung
- Untersuchung der Herausforderungen, die mit der empirischen Erfassung von Eigenlogik verbunden sind
- Städtevergleich zwischen Berlin und München als Beispiel für die Anwendung des Eigenlogikkonzepts
- Analyse der Besonderheiten von Berlin und München im Hinblick auf ihre Eigenlogik
- Interpretation der Ergebnisse und Diskussion der Relevanz des Eigenlogikkonzepts für die Stadtforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Eigenlogik von Städten ein und stellt die Relevanz des Forschungsansatzes heraus. Anschließend wird der Begriff „Stadt“ aus soziologischer Sicht definiert und verschiedene Definitionen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven vorgestellt.
Im dritten Kapitel wird das Eigenlogikkonzept ausführlich erläutert. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung dieses Ansatzes von traditionellen Ansätzen in der Stadtforschung und der Diskussion der spezifischen Herausforderungen, die mit der empirischen Erfassung der Eigenlogik verbunden sind.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Städtevergleich zwischen Berlin und München. Dieser Vergleich dient dazu, die Anwendung des Eigenlogikkonzepts in der Praxis zu demonstrieren und die Besonderheiten der beiden Städte im Hinblick auf ihre Eigenlogik zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Eigenlogik, Stadtforschung, Städtevergleich, Berlin, München, Soziologie, Urbanität, Identität, Globalisierung, Lokale Strukturen, Gesellschaft, Kultur, Stadtentwicklung
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Eigenlogik von Städten"?
Es ist ein Forschungsansatz der Stadtforschung, der Städte als eigenständige Gebilde mit spezifischen sozialen Phänomenen und Besonderheiten ("Unique Selling Proposition") betrachtet.
Wie unterscheidet sich dieser Ansatz von traditioneller Stadtforschung?
Während traditionelle Ansätze oft nur Sozialforschung in Städten betreiben oder Milieus untersuchen, versucht die Eigenlogik, die Stadt als Ganzes und ihre spezifischen Differenzen zu anderen Orten zu erklären.
Welche Städte werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit wendet den Städtevergleich zwischen Berlin und München an, um die jeweilige Eigenlogik empirisch zu verdeutlichen.
Warum suchen Menschen in verschiedenen Städten nach unterschiedlichen Begriffen?
Städte haben unterschiedliche kulturelle und soziale Schwerpunkte; so suchen Münchner laut Studien eher nach Karriere und Profit, während Osnabrücker nach Liebe und Freiheit suchen.
Wer prägte den Begriff in der Soziologie der Städte?
Die Arbeit bezieht sich maßgeblich auf Martina Löw und ihr Werk „Soziologie der Städte“ (2008).
- Citation du texte
- Timmy Ehegötz (Auteur), 2010, Die "Eigenlogik von Städten" erkennen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157977