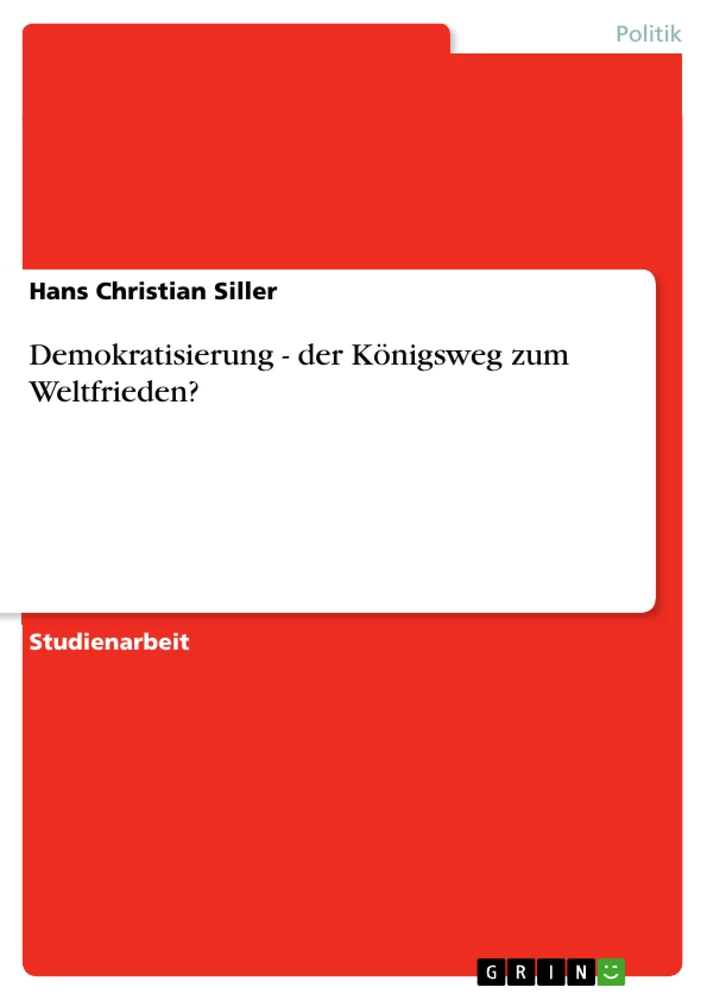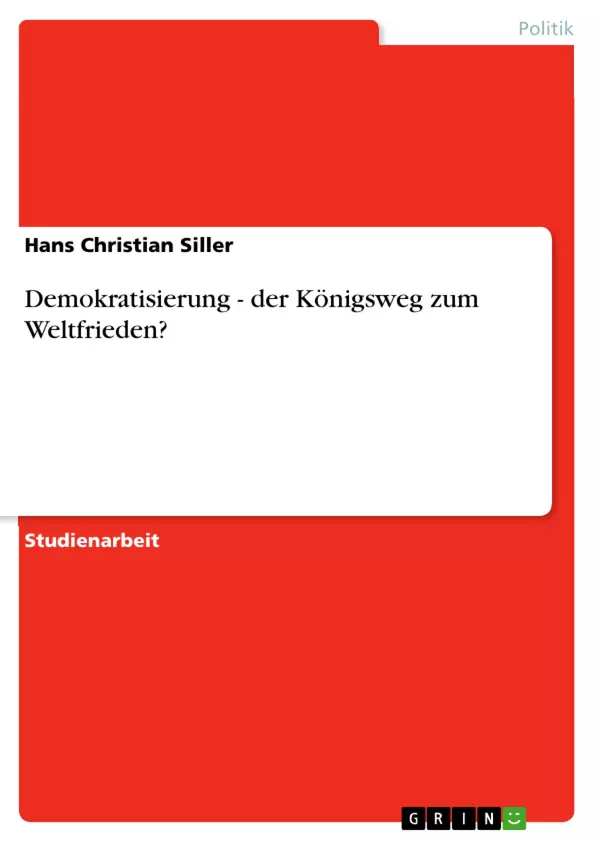Die These, daß Demokratien keine Kriege gegeneinander führen scheint auf den ersten Blick einleuchtend und unumstritten zu sein. Spätestens seit US-Präsident Woodrow Wilsons 14-Punkten hatte die Vision einer demokratischen und daher friedlichen Welt ihren festen Platz in der Riege der politischen Philosophien eingenommen. Mittlerweile gehört sie sogar zum Standardprogramm der politischen Populärrethorik: In den Wahlkampfreden während der Präsidentschaftskampagnen sowohl von George Bush als auch von Bill Clinton tauchte der Begriff der "international zone of 'democratic peace'" regelmäßig auf . Clinton hat die Demokratisierung regelmäßig als 'third pillar' seiner Außenpolitik bezeichnet und festgestellt: “Democracies don't attack each other.“ “Democratic Peace Theory [...] has become a lodestar that guides America's post-Cold War foreign policy.”
Überraschend daran ist, wie schnell diese These den Weg von der Wissenschaft in die politische Praxis gefunden zu haben scheint. Zwar ist die Idee der friedlichen Demokratie nicht sonderlich neu, jedoch verdichteten sich seit den 70er Jahren empirische Hinweise auf eine tatsächliche Existenz des demokratischen Friedens.
In der vorliegenden Arbeit sollen die verschiedenen theoretischen Erklärungsversuche des demokratischen Friedens auf ihre Stichhaltigkeit untersucht werden. Hierbei soll gezeigt werden, daß sowohl die Empirie als auch die Theorien des demokratischen Friedens mit vielen Unstimmigkeiten behaftet sind. Nur im Lichte der Schwachstellen läßt sich beurteilen, wo der demokratische Frieden zwischen den Eingangszitaten anzusiedeln ist, d.h. zwischen dem sicheren und politisch unmittelbar realisierbaren Weltfriedensrezept oder der Adaption politisch opportuner, aber wissenschaftlich zweifelhafter Thesen, die auf der frommen Hoffnung in das gutwillige Verhalten der Gegner basieren.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DER EMPIRISCHE BEFUND
- THEORETISCHE ERKLÄRUNGSANSÄTZE
- Kant und seine Vorläufer
- Kants Erben
- Demokratische Mitbestimmung als Kriegshemmnis
- Demokratische Kultur und Normen als Kriegshemmnis
- Demokratische Institutionen als Kriegshemmnis
- Realisten vs. Idealisten
- Demokratischer Krieg?
- Verdeckte Kriege: 'covert actions'
- Zur Externalisierung von Normen
- Der Demokratische Frieden als selbsterfüllende Prophezeiung?
- Alternative Erklärungsversuche
- Zur empirische Datengrundlage und ihrer Aussagekraft
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die These, dass Demokratien keine Kriege gegeneinander führen. Dabei werden sowohl empirische Befunde als auch theoretische Erklärungsansätze für den sogenannten "demokratischen Frieden" analysiert. Ziel ist es, die Stichhaltigkeit der These zu überprüfen und die Grenzen sowie Schwachstellen der Theorie aufzuzeigen.
- Empirische Evidenz für den "demokratischen Frieden"
- Theoretische Erklärungsansätze für den "demokratischen Frieden"
- Kritik an der These des "demokratischen Friedens"
- Relevanz der Theorie für die internationale Politik
- Grenzen und Schwachstellen der "Demokratischen Frieden"-Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die These des "demokratischen Friedens" vor und beleuchtet die historische Entwicklung und Relevanz dieser Theorie.
- Der empirische Befund: Dieses Kapitel präsentiert die empirischen Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Regierungsform und Kriegsverhalten von Staaten. Dabei wird die Frage untersucht, ob Demokratien tatsächlich weniger kriegsanfällig sind als Nichtdemokratien.
- Theoretische Erklärungsansätze: Hier werden verschiedene theoretische Ansätze diskutiert, die den "demokratischen Frieden" erklären wollen. Dies umfasst die Überlegungen von Kant und seinen Vorläufern sowie die Kritik von Realisten an der Theorie.
Schlüsselwörter
Demokratie, Krieg, internationaler Frieden, Demokratischer Frieden, Friedensforschung, Realismus, Liberalismus, empirische Forschung, politische Theorie, Außenpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie des „Demokratischen Friedens“?
Die Kernthese lautet, dass Demokratien fast nie Kriege gegeneinander führen.
Welchen Einfluss hatte Immanuel Kant auf diese Theorie?
Kant legte mit seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ die philosophische Basis, indem er argumentierte, dass republikanische Verfassungen kriegshemmend wirken.
Warum führen Demokratien weniger Kriege gegeneinander?
Erklärungsansätze sind demokratische Kontrollmechanismen (Institutionen), eine friedliche Konfliktkultur (Normen) und wirtschaftliche Interdependenz.
Was kritisieren Realisten an der Theorie?
Realisten argumentieren, dass Machtinteressen und Sicherheitsdilemmata wichtiger sind als die Regierungsform und dass der „demokratische Friede“ statistischer Zufall sein könnte.
Gibt es Ausnahmen vom demokratischen Frieden?
Die Arbeit diskutiert sogenannte „verdeckte Kriege“ (covert actions) und die Frage, ob Demokratien gegenüber Nicht-Demokratien genauso kriegerisch sind.
- Citar trabajo
- M.A. Hans Christian Siller (Autor), 1999, Demokratisierung - der Königsweg zum Weltfrieden?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1578