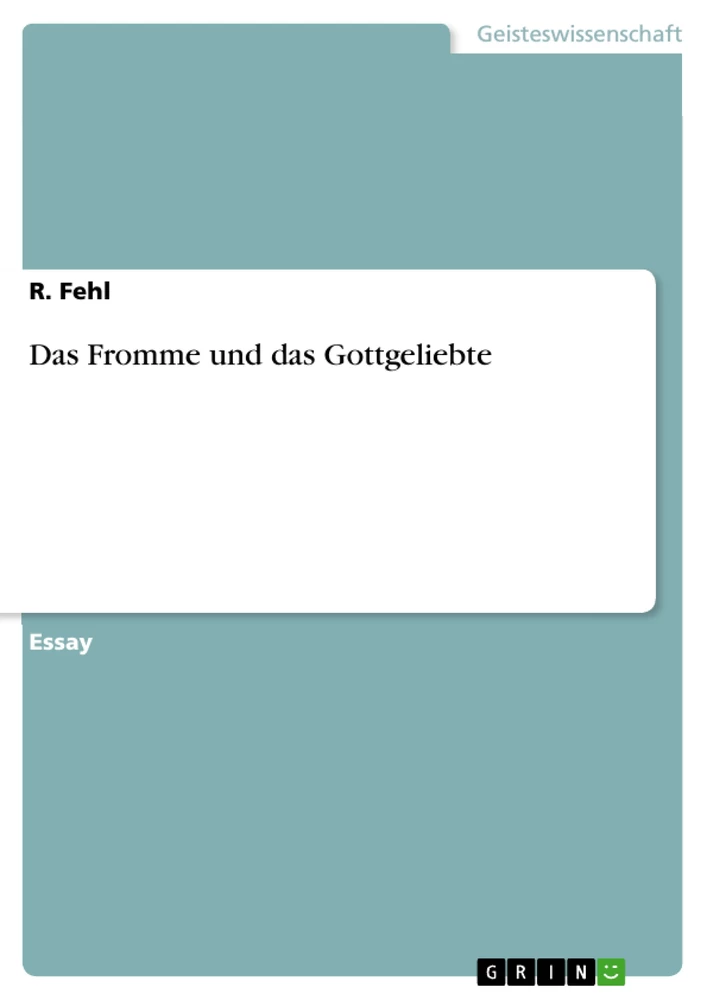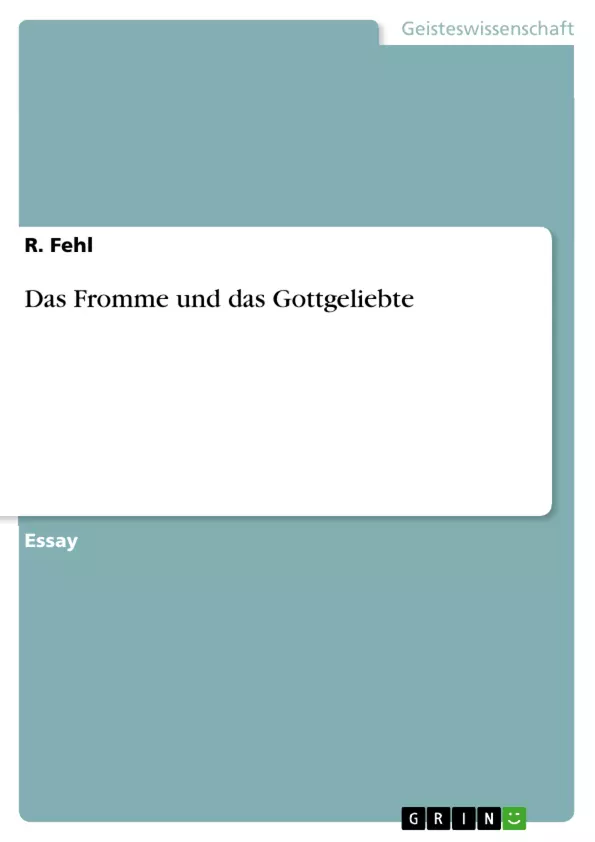In diesem Essay soll eine Dialogstelle aus Platons Euthyphron näher untersucht werden, die in Hinblick auf ihren argumentativen Gehalt als zentral gelten kann. In [6e/7a] gibt Euthyphron (anstelle weiterer Beispiele) den ersten Versuch einer allgemeinen Definition des Frommen: „Es ist also das, was den Göttern lieb ist, fromm, was ihnen aber nicht lieb ist, unfromm.“ In einem ersten Schritt zeigt Sokrates bereits eine Schwachstelle der Definition auf, die jedoch durch die kleine Ergänzung schnell wieder repariert werden kann, dass mit „den Göttern“ alle Götter gemeint sind. In dem zu untersuchenden Textausschnitt versucht Sokrates nun zu zeigen, dass auch Euthyphrons nachgebesserte Definition einer kritischen Prüfung nicht standzuhalten vermag.
Im Folgenden soll zunächst einmal ein erster Überblick über jSokrates’ gesamtes Argument gegeben werden. Anschließend werde ich kurz auf die in der Forschung viel diskutierte Substitutionsproblematik in Sokrates’ Argument eingehen. Das Hauptaugenmerk hingegen soll auf der Konklusion und einer angemessenen Interpretation derselben liegen. In einem zweiten
Schritt werde ich der Frage nachgehen, ob sich nicht im Text weitere Argumentationsstrategien oder Begründungszusammenhänge finden lassen, die Sokrates gegen Euthyphrons Definition stark macht und die es erlauben würden, auf die kontroverse Substitutionsschlussregel
zu verzichten. Abschließend werde ich die Ergebnisse meiner Untersuchung kurz resümieren.
Inhaltsverzeichnis
- Sokrates' Gesamtes Argument
- Die Substitutionsproblematik
- Konklusion und Interpretation
- Weitere Argumentationsstrategien
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert eine zentrale Dialogstelle [9d-11b] aus Platons Euthyphron, die sich mit der Definition des Frommen auseinandersetzt. Die Zielsetzung besteht darin, Sokrates' Argumentation zu rekonstruieren, die umstrittene Substitutionsproblematik zu beleuchten und alternative Interpretationsmöglichkeiten zu prüfen.
- Rekonstruktion von Sokrates' Argumentation gegen Euthyphrons Definition des Frommen.
- Analyse der Substitutionsproblematik in Sokrates' Argumentation.
- Interpretation der Konklusion und Prüfung alternativer Argumentationsstrategien.
- Untersuchung der verschiedenen Definitionsbegriffe bei Sokrates und Euthyphron.
- Analyse des Begriffs des Wissens im Kontext der Definition des Frommen.
Zusammenfassung der Kapitel
Sokrates' Gesamtes Argument: Der Essay beginnt mit einer Übersicht über Sokrates' Argumentation gegen Euthyphrons Definition des Frommen als "das, was den Göttern lieb ist". Es wird gezeigt, wie Sokrates durch eine Reihe von Prämissen einen Widerspruch in Euthyphrons Definition aufdeckt, der die Unhaltbarkeit dieser Definition belegen soll. Die Argumentation beinhaltet die Einführung der Begriffe "gottgeliebt" und "fromm" und deren Beziehung zueinander. Der Fokus liegt auf der systematischen Darstellung der Argumentationslinie, um den logischen Aufbau von Sokrates' Kritik zu verdeutlichen.
Die Substitutionsproblematik: Dieser Abschnitt befasst sich mit der viel diskutierten Problematik der Substitution in Sokrates' Argumentation. Die Analyse konzentriert sich auf die Prämissen (P5) und (P6), die erst nach der Konklusion eingeführt werden und einen logischen Widerspruch erzeugen, indem sie scheinbar den Austausch der Ausdrücke „Gottgeliebtes“ und „Frommes“ erlauben. Die Diskussion beleuchtet die Unsicherheit bezüglich der Legitimität dieses Austausches in Weil-Sätzen und die damit verbundenen methodischen Fragen der Argumentation.
Konklusion und Interpretation: Hier wird die Konklusion von Sokrates' Argumentation ("Das Fromme und das Gottgeliebte sind nicht dasselbe") eingehend untersucht. Der Essay hinterfragt, was genau mit der Unterscheidung zwischen "Frommem" und "Gottgeliebtem" gemeint ist und welche Konsequenzen sich daraus für Euthyphrons Definition ergeben. Es wird diskutiert, ob Sokrates' Argumentation als Widerlegung von Euthyphrons Definition ausreichend ist und alternative Interpretationen der Konklusion in Betracht gezogen.
Weitere Argumentationsstrategien: Dieser Abschnitt untersucht, ob Sokrates' Argumentation auf die umstrittene Substitutionsschlusregel angewiesen ist, oder ob alternative Argumentationsstrategien möglich wären, um Euthyphrons Definition anzugreifen. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, ob die Prämissen (P1) und (P2) allein ausreichen, um einen begründeten Einwand gegen Euthyphrons Definition zu formulieren, und ob Sokrates auf diese Weise den Fokus auf den inhaltlichen Defekt der Definition lenken könnte.
Schlüsselwörter
Platon, Euthyphron, Fromm, Gottgeliebt, Definition, Sokrates, Argumentation, Substitution, Widerspruch, Wissen, Idee, Form, Wesen.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: "Analyse einer Dialogstelle aus Platons Euthyphron"
Was ist der Gegenstand des Essays?
Der Essay analysiert eine spezifische Textstelle (9d-11b) aus Platons Euthyphron, in der Sokrates Euthyphrons Definition des Frommen ("das, was den Göttern lieb ist") hinterfragt und kritisiert. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion von Sokrates' Argumentation, der Untersuchung der umstrittenen Substitutionsproblematik und der Prüfung alternativer Interpretationsmöglichkeiten.
Welche Themen werden im Essay behandelt?
Der Essay behandelt folgende Kernthemen: Rekonstruktion von Sokrates' Argumentationslinie gegen Euthyphrons Definition; detaillierte Analyse der Substitutionsproblematik innerhalb der Argumentation (insbesondere die Prämissen P5 und P6); Interpretation der Schlussfolgerung und Prüfung alternativer Argumentationsstrategien; Untersuchung der unterschiedlichen Definitionsansätze von Sokrates und Euthyphron; und die Rolle des Wissens im Kontext der Definition des Frommen.
Wie ist der Essay strukturiert?
Der Essay gliedert sich in verschiedene Kapitel: "Sokrates' Gesamtes Argument" bietet eine Übersicht über die gesamte Argumentationslinie. "Die Substitutionsproblematik" analysiert die umstrittene Substitution von "Gottgeliebtes" und "Frommes". "Konklusion und Interpretation" untersucht die Schlussfolgerung von Sokrates' Argumentation und alternative Interpretationen. "Weitere Argumentationsstrategien" erörtert die Frage nach der Notwendigkeit der Substitution und alternativen Argumentationsmöglichkeiten. Zusätzlich enthält der Essay ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist die zentrale These des Essays?
Die zentrale These ist die eingehende Analyse und kritische Auseinandersetzung mit Sokrates' Argumentation gegen Euthyphrons Definition des Frommen. Dabei wird besonders die Substitutionsproblematik beleuchtet und die Frage diskutiert, ob Sokrates' Argumentation eine ausreichende Widerlegung von Euthyphrons Definition darstellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Essays relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Platon, Euthyphron, Fromm, Gottgeliebt, Definition, Sokrates, Argumentation, Substitution, Widerspruch, Wissen, Idee, Form, Wesen.
Welche methodischen Fragen werden im Essay aufgeworfen?
Der Essay wirft methodische Fragen zur Legitimität der Substitution in Weil-Sätzen auf und untersucht die damit verbundenen logischen Konsequenzen für Sokrates' Argumentation. Es wird hinterfragt, ob alternative Argumentationsstrategien ohne die umstrittene Substitution möglich wären, um Euthyphrons Definition zu kritisieren.
Welche Schlussfolgerung zieht der Essay?
Der Essay zieht keine explizite Schlussfolgerung im Sinne einer endgültigen Bewertung von Sokrates' Argumentation, sondern bietet eine differenzierte Analyse der Argumentationsstruktur, der Problematik der Substitution und möglicher alternativer Interpretationen. Der Leser wird angeregt, sich selbst ein Urteil über die Stärke und die Schwächen von Sokrates' Argumentation zu bilden.
- Citar trabajo
- R. Fehl (Autor), 2009, Das Fromme und das Gottgeliebte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157441