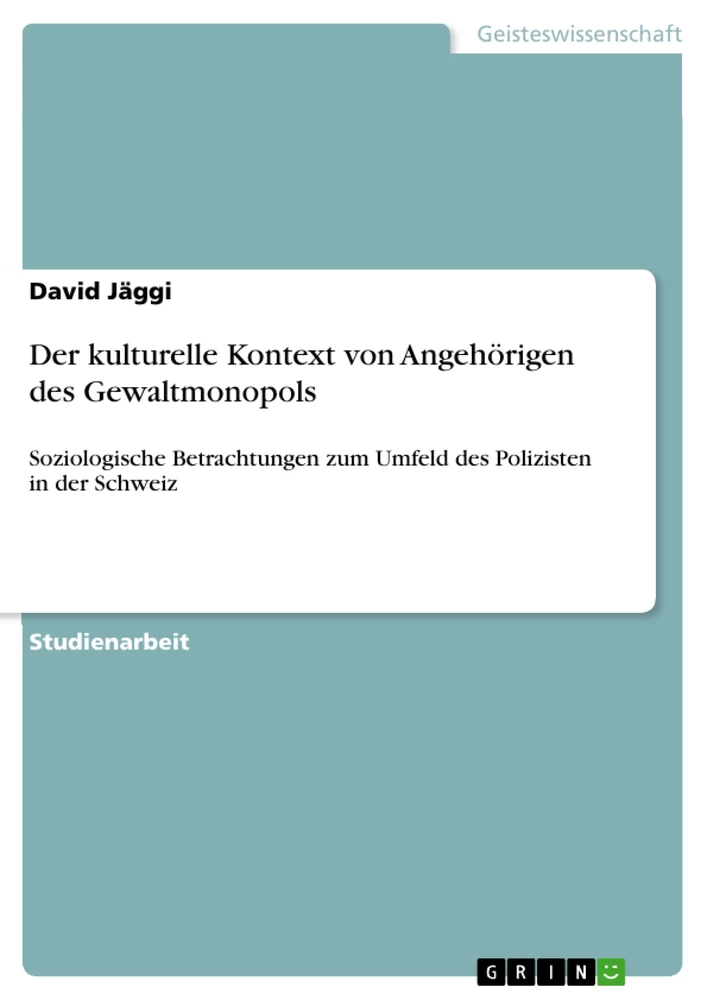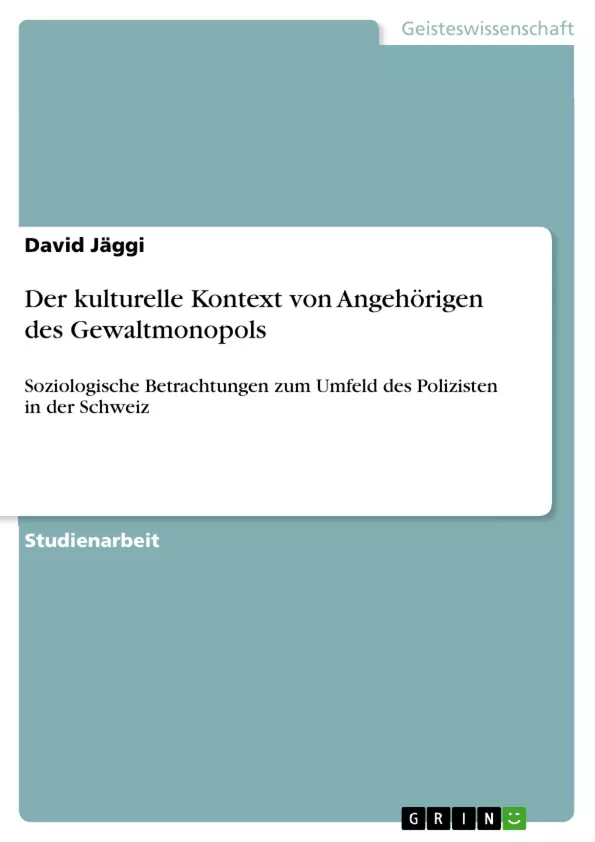Durch die vorliegende Arbeit soll ein nachvollziehbares Bild des Polizisten und seiner Kultur, in der er lebt, entstehen. Obwohl bereits beim Auswahlverfahren für angehende
Polizisten gewisse Anforderungen an die zukünftigen Amtsträger gestellt
werden, so ist die Heterogenität in der Berufsgruppe dennoch sehr gross. Bei der Polizei handelt es sich um eine Organisation die aus handlungstheoretischer Sicht nicht eine Kultur besitzt, sondern in deren Alltag verschiedene Kulturmodelle miteinander konkurrieren.
So viele Polizisten wie es gibt, so viele kulturelle Prägungen sind vorhanden. Diese verschiedenen Prägungen werden bei der Polizei in einen gemeinsamen kulturellen Kern überführt, welcher von Organisation zu Organisation oder Dienststelle verschieden stark ausgeprägt sein kann. Rafael Behr prägte dafür den Begriff „Cop
Culture“. Von den Polizisten selber wird oft der Begriff „Korpsgeist“ verwendet, um einen Teil von Kultur im eigenen Polizeikorps zu beschreiben. Die vorliegende Arbeit
erhebt nicht den Anspruch, die „Cop Culture“ weiter zu erläutern. Ebenso wenig wird der Korpsgeist deskribiert. Vielmehr soll ein kurzer Überblick über einige Bereiche im Leben des Polizisten gegeben werden, welche für die Kultur, in der er lebt, massgeblich sind. Schliesslich soll am Ende der Arbeit auch die Frage gestreift werden, wie das Evangelium im Umfeld der Polizei neue Relevanz erhält. Dies immer unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse aus den nachfolgend beschriebenen Erhebungen.
Inhaltsverzeichnis
- ZIEL DER VORLIEGENDEN ARBEIT
- FORSCHUNG IM KULTURELLEN KONTEXT DES GEWALTMONO- POLS
- Wie arbeitet die Sozialforschung?
- Methodologische Anmerkungen
- Quantitative Erhebungen
- Qualitative Erhebungen
- Das Forschungsfeld
- Der Polizist vom Lande
- Der Polizist in der Stadt
- Stadtpolizei Kloten im Speziellen
- DAS SOZIALE UMFELD
- Herkunft
- Familie und Freundschaften
- Freizeitaktivitäten
- Polizeivereine/Polizeifreundschaften
- Umgang mit Alkohol
- Einkaufsverhalten
- Umgang mit dem Internet
- Bildung
- Weiterbildung
- PRINTMEDIEN
- Vielleser
- Wenigleser
- Bewertung
- Ausgewählte Literatur
- AUDIO/VIDEO MEDIEN
- Fernsehen während der Dienstzeit
- Fernsehen zu Hause
- Musik
- SPIRITUALITÄT
- Denomination
- Die Höhere Macht
- Kirchenbesuch
- Stellung des Gebets
- Stellung der Bibel
- Spiritualität im Allgemeinen
- Bewertung
- Einfluss von Christen/Wahrnehmung von Christen
- RESÜMEE
- Der Durchschnittspolizist
- Erreichbarkeit mit dem Evangelium
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, einen Einblick in die Kultur des Polizisten und seine Lebenswelt zu geben. Sie beleuchtet die Heterogenität innerhalb der Polizei, die sich aus verschiedenen kulturellen Prägungen ergibt. Die Arbeit analysiert die „Cop Culture" und den „Korpsgeist", ohne jedoch eine detaillierte Beschreibung dieser Konzepte anzustreben. Stattdessen fokussiert sie sich auf bestimmte Bereiche des Lebens eines Polizisten, die Einfluss auf seine Kultur haben.
- Die Sozialforschung im Kontext des Gewaltmonopols
- Das soziale Umfeld des Polizisten, einschliesslich Herkunft, Familie, Freizeitaktivitäten und Bildung
- Die Bedeutung von Print- und Audio/Video-Medien im Leben des Polizisten
- Spiritualität und Religion im Leben des Polizisten
- Die Erreichbarkeit des Polizisten mit dem Evangelium
Zusammenfassung der Kapitel
- Ziel der vorliegenden Arbeit: Dieses Kapitel erläutert die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, ein nachvollziehbares Bild des Polizisten und seiner Kultur zu zeichnen. Es wird auf die Heterogenität innerhalb der Polizeigruppe sowie die Existenz verschiedener Kulturmodelle im Alltag hingewiesen.
- Forschung im kulturellen Kontext des Gewaltmonopols: Dieses Kapitel beleuchtet die methodischen Ansätze der Sozialforschung im Kontext des Gewaltmonopols. Es werden quantitative und qualitative Erhebungsmethoden sowie das Forschungsfeld näher erläutert.
- Das soziale Umfeld: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Aspekte des sozialen Umfelds eines Polizisten, einschliesslich Herkunft, Familie, Freizeitaktivitäten, Bildung und Weiterbildung. Es wird die Vielfältigkeit der Erfahrungen und Lebenswege innerhalb der Polizeigruppe herausgestellt.
- Printmedien: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Printmedien im Leben des Polizisten. Es wird die Lesebereitschaft sowie die Bewertung ausgewählter Literatur, wie z. B. „Siddharta" und „Gespräche mit Gott", beleuchtet.
- Audio/Video Medien: Dieses Kapitel behandelt die Rezeption von Audio/Video Medien, insbesondere Fernsehen und Musik, im Leben des Polizisten. Es wird der Einfluss dieser Medien auf die Wahrnehmung der Welt und auf das Lebensgefühl analysiert.
- Spiritualität: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Thema Spiritualität im Leben des Polizisten. Es werden die Denomination, die Wahrnehmung der „Höheren Macht", der Kirchenbesuch, die Stellung des Gebets und der Bibel sowie die allgemeine Spiritualität des Polizisten analysiert.
- Resümee: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet das Profil des Durchschnittspolizisten sowie seine Erreichbarkeit mit dem Evangelium. Es wird die Notwendigkeit von aktivem Zuhören, den Einsatz von Radio und einer „Polizeibibel" sowie die Bedeutung missionalen Denkens im Umgang mit Polizisten betont.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt den kulturellen Kontext von Angehörigen des Gewaltmonopols, insbesondere der Polizei in der Schweiz. Sie beleuchtet die „Cop Culture", die „Korpsgeist"-Entwicklung, das soziale Umfeld, den Einfluss von Medien auf den Polizisten sowie die Spiritualität und Religion im Leben eines Polizisten. Die Arbeit untersucht die Erreichbarkeit des Polizisten mit dem Evangelium und die Notwendigkeit eines missionalen Denkens in diesem Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Cop Culture“?
Der von Rafael Behr geprägte Begriff beschreibt den gemeinsamen kulturellen Kern und die informellen Normen innerhalb der Polizei.
Was bedeutet „Korpsgeist“ bei der Polizei?
Polizisten nutzen diesen Begriff oft selbst, um den inneren Zusammenhalt und die Loyalität innerhalb ihres Korps zu beschreiben.
Wie unterscheidet sich der Polizist vom Land von dem in der Stadt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Einsatzfelder und zeigt auf, wie das Umfeld (z.B. Stadtpolizei Kloten) die kulturelle Prägung beeinflusst.
Welche Rolle spielt Spiritualität im Leben von Polizisten?
Es werden Aspekte wie Denomination, die Wahrnehmung einer „höheren Macht“ sowie die Stellung von Gebet und Bibel im Polizeialltag analysiert.
Wie kann die Kirche Polizisten besser erreichen?
Das Resümee schlägt aktives Zuhören, missionale Denkweisen und spezielle Hilfsmittel wie eine „Polizeibibel“ vor.
- Citar trabajo
- David Jäggi (Autor), 2010, Der kulturelle Kontext von Angehörigen des Gewaltmonopols, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157216