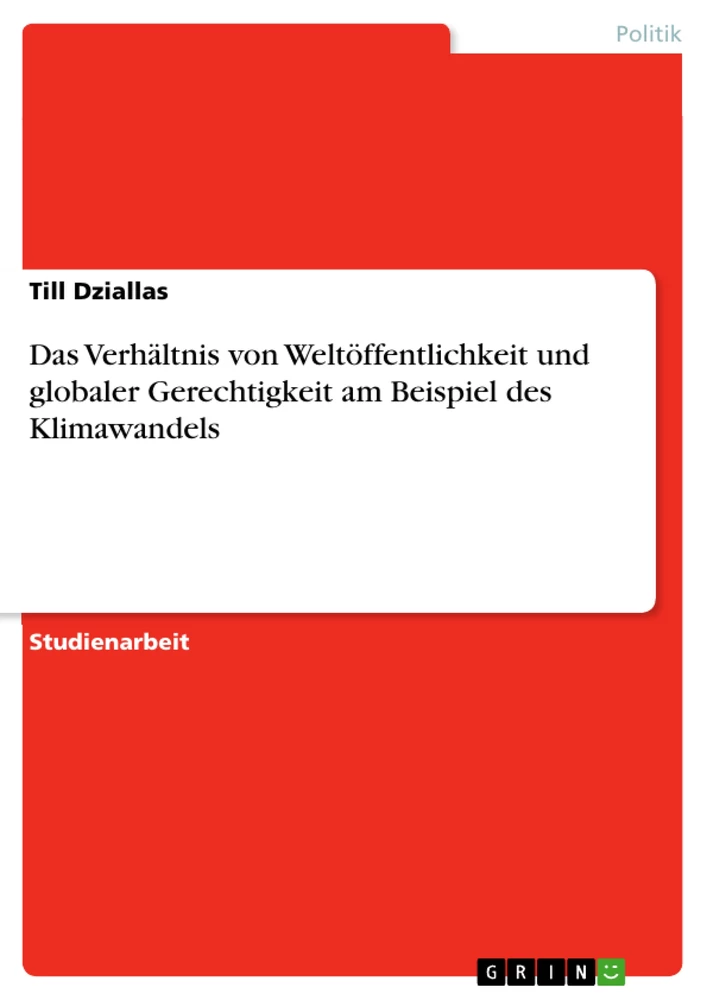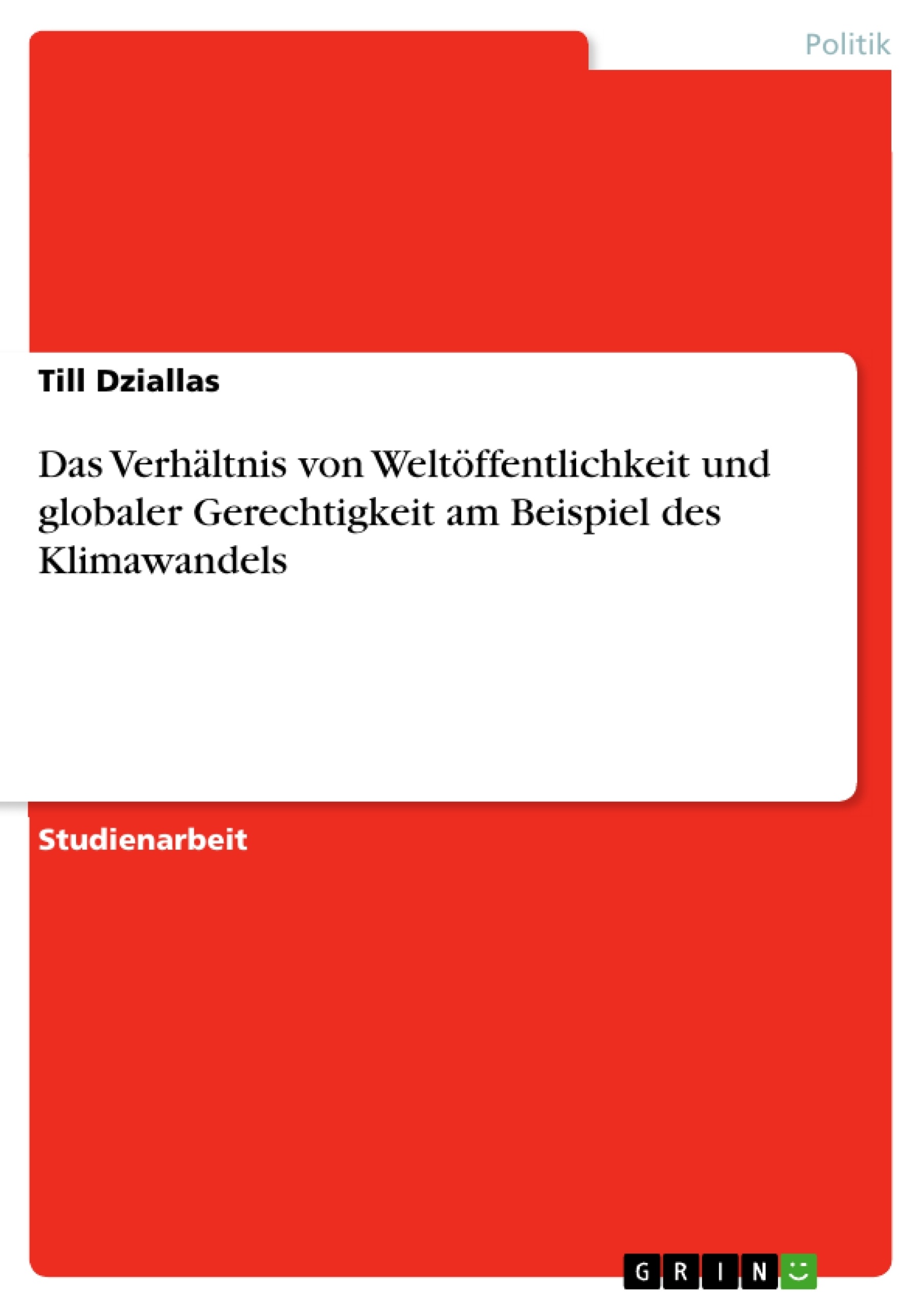In der heute unumkehrbar globalisierten Welt wird die Frage nach einer globalen Gerechtigkeit, die nicht vor Staatsgrenzen halt macht, immer dringender.
Eine neue Brisanz hat diese Frage durch den Klimawandel und seinen Folgen erfahren.
Am Beispiel der globalen Erwärmung, die nach heutigen wissenschaftlichen Kenntnissen zu einem entscheidenden Anteil menschengemacht ist, zeigt sich, wie ein Naturereignis Probleme aufwirft, die mit menschlicher Verantwortung auf globaler Ebene zusammenhängen.
So sind Ursachen und Folgen des Klimawandels jeweils auf höchst ungleiche Weise über den Planeten verteilt. Dadurch wird deutlich, wie menschliche Handlungen auf der einen Seite der Erde lebensbedrohliche Folgen für die Bewohner auf der anderen Seite der Erde haben können.
Durch die mediale Aufmerksamkeit, die dem Klimawandel in den letzten Jahren zuteil wurde, ist dieses Problem immer mehr in das öffentliche Bewusstsein gerückt.
Inwieweit eine Weltöffentlichkeit, vielleicht sogar eine kosmopolitische Weltöffentlichkeit besteht, die allen Menschen die gleiche Achtung erweist, und welche Bedeutung Öffentlichkeit für globale Gerechtigkeit hat, soll am Beispiel des Klimawandels gezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Das Verhältnis von Weltöffentlichkeit und globaler Gerechtigkeit am Beispiel des Klimawandels
- 1. Konzeptionen globaler Gerechtigkeit
- 1.1. Immanuel Kant und das Weltbürgerrecht
- 1.2. John Rawls: Von der Theorie der Gerechtigkeit zum Recht der Völker
- 1.3. Charles R. Beitz – Kosmopolitischer Liberalismus
- 1.4. Felix Ekardt: Gerechtigkeit durch Nachhaltigkeit
- 2. Anthropogener Klimawandel und das Verhältnis zwischen Hauptverantwortlichen und Leidtragenden
- 2.1. Der Klimawandel und die menschliche Verantwortung
- 2.1. Die Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern
- 2.2. Welche Klimapolitik?
- 3. Eine kosmopolitische Weltöffentlichkeit?
- 3.1. Barrieren zur Entstehung einer kosmopolitischen Weltöffentlichkeit
- 3.1.1. Bequemlichkeit, Angst und Egozentrik
- 3.1.2. Demokratie als Voraussetzung: Habermas´ Begriff von Öffentlichkeit
- 3.1.3. Demokratische und materielle Defizite
- 3.2. Chancen für die kosmopolitische Weltöffentlichkeit
- 3.2.1. Die „Weltrisikogesellschaft“
- 3.2.2. Globale Öffentlichkeit als kulturübergreifendes Bewusstsein
- 3.1. Barrieren zur Entstehung einer kosmopolitischen Weltöffentlichkeit
- C) Inwieweit trägt die weltweite Wahrnehmung der Krise zu einer gerechteren Klimapolitik bei?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Weltöffentlichkeit und globaler Gerechtigkeit anhand des Beispiels des Klimawandels. Sie beleuchtet verschiedene Konzeptionen globaler Gerechtigkeit, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, und analysiert die Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels auf die Verteilung von Verantwortung und Folgen. Weiterhin wird die Rolle der Weltöffentlichkeit für eine gerechtere Klimapolitik beleuchtet, wobei die Herausforderungen und Chancen einer kosmopolitischen Weltöffentlichkeit im Vordergrund stehen.
- Konzeptionen globaler Gerechtigkeit im Wandel
- Verantwortung und Folgen des Klimawandels
- Die Rolle der Weltöffentlichkeit für globale Gerechtigkeit
- Herausforderungen und Chancen einer kosmopolitischen Weltöffentlichkeit
- Gerechtigkeitskonflikte im Zusammenhang mit dem Klimawandel
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die aktuelle Relevanz der Frage nach globaler Gerechtigkeit im Kontext der Globalisierung und des Klimawandels heraus und führt in die Thematik ein.
- Konzeptionen globaler Gerechtigkeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung verschiedener Konzeptionen globaler Gerechtigkeit, ausgehend von Immanuel Kants Weltbürgerrecht, über John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit und Charles R. Beitz' kosmopolitischem Liberalismus bis hin zu Felix Ekardts Prinzip universaler Nachhaltigkeit.
- Anthropogener Klimawandel und das Verhältnis zwischen Hauptverantwortlichen und Leidtragenden: Dieses Kapitel analysiert die menschlichen Ursachen und Folgen des Klimawandels sowie die ungleiche Verteilung von Verantwortung und Auswirkungen auf die Weltbevölkerung. Dabei wird die Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern hervorgehoben.
- Eine kosmopolitische Weltöffentlichkeit?: Das Kapitel untersucht, inwieweit die weltweite öffentliche Wahrnehmung des Klimawandels zu einer gerechteren Klimapolitik beitragen kann. Die Herausforderungen und Chancen einer kosmopolitischen Weltöffentlichkeit werden im Kontext von Jürgen Habermas' Definition von Öffentlichkeit und Ulrich Becks Begriff der „Weltrisikogesellschaft“ beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der globalen Gerechtigkeit, dem Klimawandel, der Weltöffentlichkeit, der kosmopolitischen Weltöffentlichkeit, dem Weltbürgerrecht, dem anthropogenen Klimawandel, dem Verhältnis von Hauptverantwortlichen und Leidtragenden, der „Weltrisikogesellschaft“ und der Rolle der Öffentlichkeit für eine gerechtere Klimapolitik. Die Arbeit stützt sich auf wichtige Beiträge von Immanuel Kant, John Rawls, Charles R. Beitz, Felix Ekardt, Jürgen Habermas und Ulrich Beck, um die relevanten Aspekte des Themas zu beleuchten.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Weltöffentlichkeit beim Klimawandel?
Die Weltöffentlichkeit rückt die ungleiche Verteilung von Ursachen und Folgen des Klimawandels in das Bewusstsein und fordert globale Gerechtigkeit ein.
Was versteht Ulrich Beck unter der „Weltrisikogesellschaft“?
Es beschreibt den Zustand, in dem globale Gefahren wie der Klimawandel nationale Grenzen überschreiten und eine weltweite Schicksalsgemeinschaft schaffen.
Welche Gerechtigkeitskonzepte werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit analysiert Ansätze von Immanuel Kant (Weltbürgerrecht), John Rawls, Charles Beitz und Felix Ekardt (Nachhaltigkeit).
Warum ist der Klimawandel ein Problem der globalen Ethik?
Weil Handlungen in Industrieländern lebensbedrohliche Folgen für Bewohner in Entwicklungsländern haben, was die Frage nach menschlicher Verantwortung aufwirft.
Was sind Barrieren für eine kosmopolitische Weltöffentlichkeit?
Zu den Hindernissen zählen laut Arbeit Bequemlichkeit, Egozentrik, Ängste sowie demokratische und materielle Defizite.
- 1. Konzeptionen globaler Gerechtigkeit
- Quote paper
- Till Dziallas (Author), 2008, Das Verhältnis von Weltöffentlichkeit und globaler Gerechtigkeit am Beispiel des Klimawandels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156976