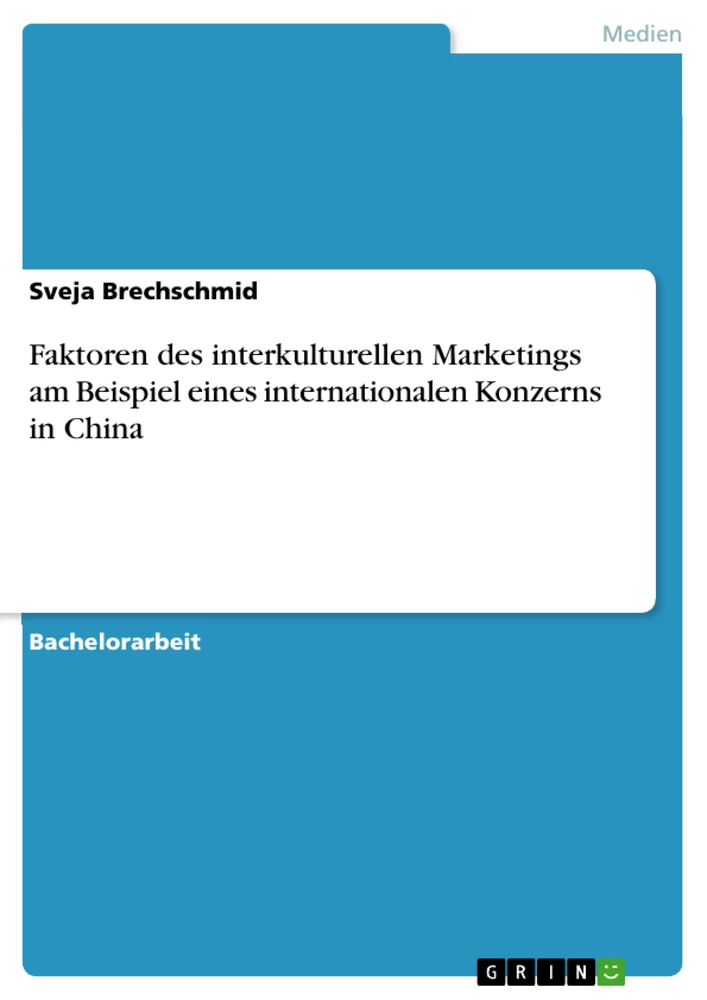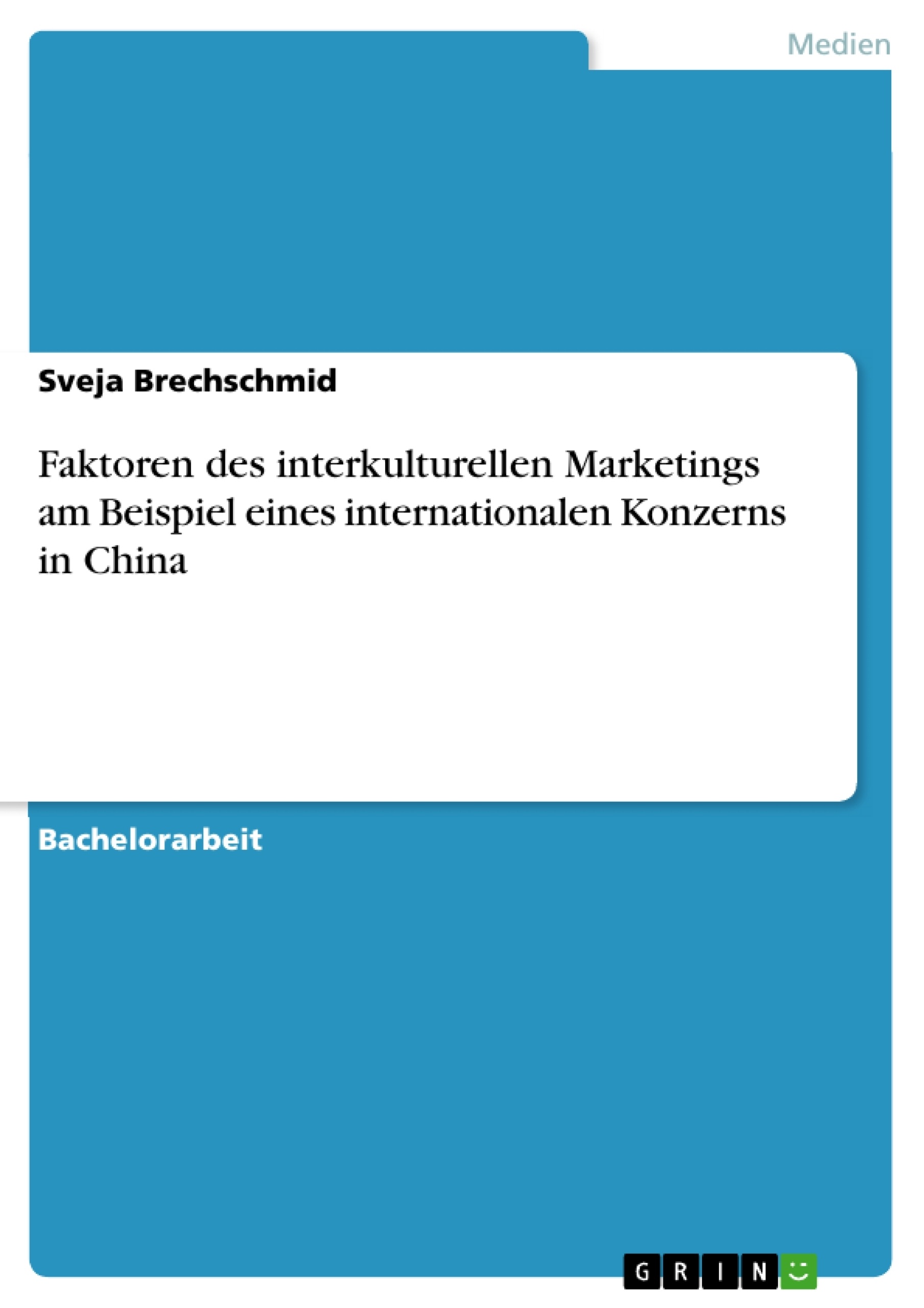Im Zuge der wachsenden internationalen Verflechtung von Wirtschaftsprozessen hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine verstärke Internationalisierung der Unternehmenstätigkeit vollzogen. Aufgrund gesättigter Inlandsmärkte und steigender internationaler Konkurrenz weiten immer mehr Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit auf andere Länder aus. Infolge dieser Entwicklung hat besonders die Rolle des Marketing an Bedeutung gewonnen. Die Erschließung neuer Märkte erfordert die Anpassung der bisherigen Marketingaktivitäten und stellt die Unternehmen vor neue Herausforderungen. International operierende Unternehmen werden vor die Wahl gestellt, entweder eine weltweite standardisierte Marketingpolitik zu verfolgen oder die Marketingaktivitäten auf die unterschiedlichen Gegebenheiten und Besonderheiten der jeweiligen Zielmärkte auszurichten.
In der Praxis hat sich daher eine Mischform zwischen Anpassung und Vereinheitlichung etabliert, dessen Grundprinzip sich mit der Maxime „So viel Standardisierung wie möglich, so viel Differenzierung wie nötig“ beschreiben lässt. Die Wahl des Grades von Standardisierung bzw. Differenzierung hängt von verschiedenen Determinanten ab, wobei der Berücksichtigung kultureller Rahmenbedingungen eine besondere Bedeutung zukommt. Auch wenn die zunehmende Globalisierung von Märkten auf eine parallele Homogenisierung der Bedürfnisse hinweist, ist das Konsumverhalten der Verbraucher keineswegs gleich. Vielmehr wird der Verbraucher durch eine Vielzahl kultureller Faktoren beeinflusst, was sich in seinen Kaufentscheidungen widerspiegelt.
Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass der Erfolg einer Marketingstrategie in China insbesondere durch die Berücksichtigung kultureller Einflussfaktoren und die entsprechende Modifikation der Marketinginstrumente determiniert wird. Ziel dieser Arbeit ist es daher zunächst, die kulturellen Besonderheiten der chinesischen Kultur zu untersuchen und aufzuzeigen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wird die Frage behandelt, welche Veränderungen und Anpassungen im Rahmen der Elemente des Marketing-Mix erforderlich sind, um dem besonderen Stellenwert der chinesischen Kultur Rechnung zu tragen. Anhand eines praktischen Beispiels (Ikea in China) soll schließlich verdeutlicht werden, dass selbst Unternehmen, die in der Regel nicht vom Konzept der Standardisierung abrücken, entsprechende Anpassungen vornehmen müssen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ausgangslage und Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Gang der Untersuchung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Der Kulturbegriff
- 2.2 Internationales Marketing vs. Interkulturelles Marketing
- 2.3 Ausgewählte Kulturstudien
- 2.3.1 Das Kulturmodell nach Hall/ Hall
- 2.3.2 Das Kulturmodell nach Hofstede
- 2.4 Kulturvergleich Deutschland und China nach Hofstede
- 2.4.1 Machtdistanz
- 2.4.2 Individualismus vs. Kollektivismus
- 2.4.3 Maskulinität vs. Femininität
- 2.4.4 Unsicherheitsvermeidung
- 2.4.5 Kurzzeit- vs. Langzeitorienierung
- 3. Interkulturelles Marketing in China
- 3.1 Die kulturelle Identität Chinas und ihre Besonderheiten
- 3.1.1 Konfuzianismus
- 3.1.2 Guanxi
- 3.1.3 Mianzi
- 3.2 Kulturelle Einflüsse auf den Marketing-Mix in China
- 3.2.1 Produktpolitik
- 3.2.2 Preispolitik
- 3.2.3 Distributionspolitik
- 3.2.4 Kommunikationspolitik
- 4. Fallbeispiel: IKEA in China
- 4.1 Wichtige Grundlagen zum IKEA Konzern
- 4.2 Expansion ins Reich der Mitte
- 4.3 Kulturbedingte Anpassung des IKEA Marketing-Mixes
- 4.3.1 Produktpolitik
- 4.3.2 Preispolitik
- 4.3.3 Distributionspolitik
- 4.3.4 Kommunikationspolitik
- 5. Emprirische Untersuchung
- 5.1 Festlegung der Untersuchungsziele und Methode der Befragung
- 5.2 Auswahl der Experten
- 5.3 Kritische Analyse der Untersuchungsergebnisse
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Faktoren des interkulturellen Marketings am Beispiel eines internationalen Konzerns in Asien. Sie befasst sich mit der Frage, wie kulturelle Besonderheiten und Werte die Gestaltung des Marketing-Mixes beeinflussen.
- Kulturelle Identität Chinas und ihre Auswirkungen auf das Marketing
- Analyse des Kulturmodells nach Hofstede im Vergleich von Deutschland und China
- Kulturelle Einflussfaktoren auf den Marketing-Mix in China
- Anwendung des interkulturellen Marketings am Fallbeispiel IKEA in China
- Empirische Untersuchung der Relevanz kultureller Aspekte im Marketing-Mix
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Ausgangslage und die Problemstellung der Arbeit dar. Sie definiert die Zielsetzung und skizziert den Gang der Untersuchung.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es werden verschiedene Kulturmodelle vorgestellt, darunter das Modell von Hall/Hall und das Modell von Hofstede. Der Kulturvergleich zwischen Deutschland und China nach Hofstede wird anhand der Dimensionen Machtdistanz, Individualismus vs. Kollektivismus, Maskulinität vs. Femininität, Unsicherheitsvermeidung und Kurzzeit- vs. Langzeitorienierung analysiert.
- Kapitel 3: In diesem Kapitel werden die Besonderheiten der kulturellen Identität Chinas im Kontext des interkulturellen Marketings betrachtet. Es werden zentrale Konzepte wie Konfuzianismus, Guanxi und Mianzi erläutert und ihre Relevanz für die Gestaltung des Marketing-Mixes in China beleuchtet.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel analysiert das Fallbeispiel IKEA in China. Es werden die wichtigsten Grundlagen des IKEA Konzerns vorgestellt und die Expansion des Unternehmens ins Reich der Mitte beleuchtet. Der Fokus liegt auf der kulturellen Anpassung des Marketing-Mixes von IKEA in China.
- Kapitel 5: Das Kapitel befasst sich mit der empirischen Untersuchung. Es werden die Untersuchungsziele und die Methode der Befragung festgelegt. Die Auswahl der Experten und die kritische Analyse der Untersuchungsergebnisse werden dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den folgenden Schlüsselwörtern: Interkulturelles Marketing, China, Kultur, Hofstede, Konfuzianismus, Guanxi, Mianzi, Marketing-Mix, Fallbeispiel, IKEA, Empirische Untersuchung.
- Arbeit zitieren
- Sveja Brechschmid (Autor:in), 2008, Faktoren des interkulturellen Marketings am Beispiel eines internationalen Konzerns in China, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156859