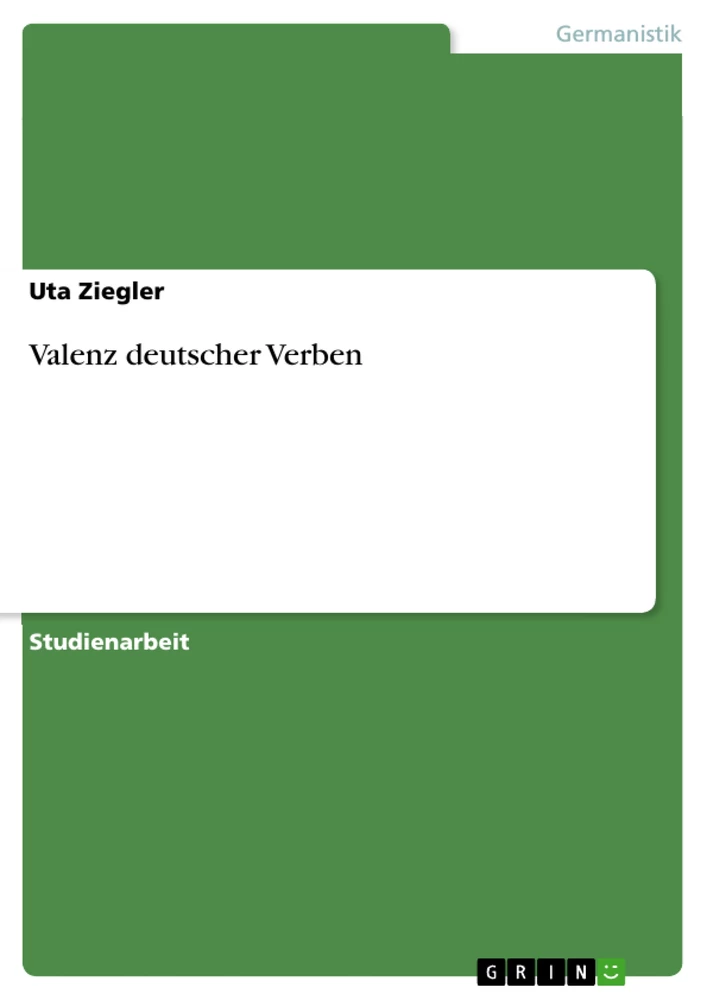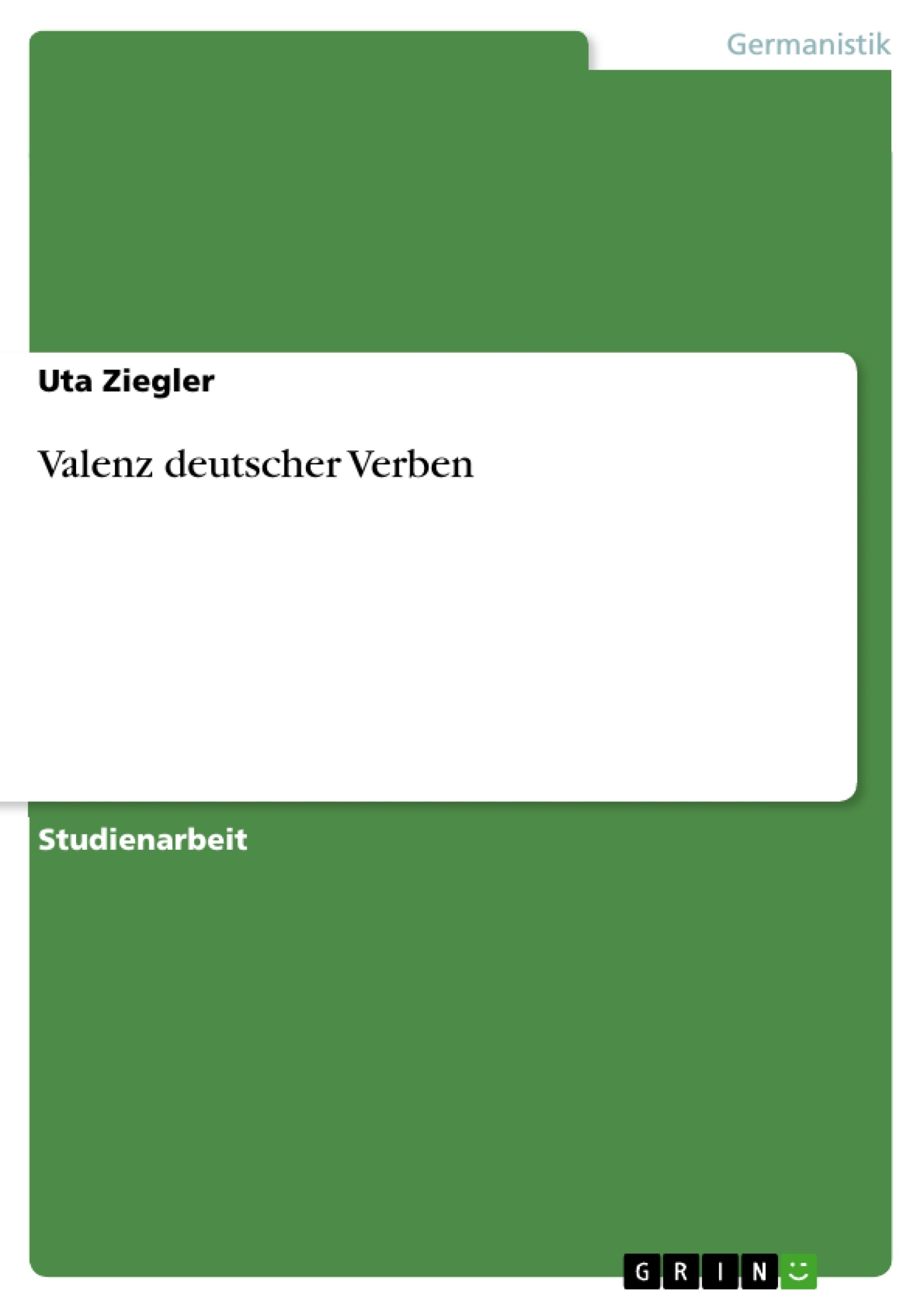Seit dem Ende der 50er Jahre wurde die Valenztheorie durch die bahnbrechenden Arbeiten des französischen Linguisten Lucien Tesnière in der germanistischen Linguistik bekannt. Ausgehend von der Beobachtung, daß lexikalische Einheiten die Eigenschaft besitzen, Leerstellen für eine bestimmte Art und Anzahl von Aktanten zu eröffnen, hat sich in der Nachfolge Tesnières eine umfangreiche Forschung entwickelt. Im Unterschied zur traditionellen Grammatik gibt die Valenzgrammatik das traditionelle Subjekt-Prädikat- Schema auf und zentriert die Satzstruktur auf das Verb. Die Tatsache, daß die Valenz zuerst am Verb beobachtet wurde, möchte ich aufgreifen und die Valenz oder Wertigkeit als Eigenschaft von Verben in der folgenden Hausarbeit thematisieren. Ich beschränke mich dabei in meinen Ausführungen auf die deutschen Vollverben. Vom Verb ausgehend wurde der Valenzbegriff auch auf andere Wortarten angewandt, insbesondere auf Adjektive und Substantive. Doch darauf möchte ich in dieser Hausarbeit nicht eingehen.
Neben der Anzahl der Ergänzungen, wurde später auch die Art der Ergänzungen und der Grad der Notwendigkeit dieser Ergänzungen von der Valenzforschung näher untersucht. Damit wurden Kategorien geschaffen, um die Valenz eines Verbs näher zu bestimmen. Ausgehend von Ursprung und Definition des Valenzbegriffes möchte ich die Verbvalenz anhand dieser Kategorien detailliert darstellen. Es soll gezeigt werden, daß für die Definition des Valenzbegriffes die Frage nach den unterschiedlichen Ebenen der Sprache von entscheidender Bedeutung ist. Die wichtigen theoretischen Überlegungen sollen dabei anhand von Beispielen verdeutlicht werden. Darüber hinaus möchte ich Einblicke in den Stand der Forschungsdiskussion geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Valenzbegriff
- 2.1 Ursprung und Definition
- 2.2 Valenzbegriff bei Tesnière
- 3. Ebenen der Valenz
- 4. Anzahl der Ergänzungen
- 4.1 Einteilung bei Eisenberg
- 4.2 Einteilung bei Helbig/Buscha
- 5. Arten von Ergänzungen
- 6. Grad der Notwendigkeit von Ergänzungen
- 6.1 Obligatorische und fakultative Ergänzungen/Aktanten
- 6.1.1 Weglaẞprobe / Eliminierungstest
- 6.2 Alternative Valenz mit Bedeutungsunterschied
- 6.3 Freie Angaben
- 6.3.1 Trennung von Ergänzungen und Angaben
- 6.1 Obligatorische und fakultative Ergänzungen/Aktanten
- 7. Bedeutung der Satzglieder für die Valenz
- 8. Schlussbetrachtungen
- 9. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Valenzbegriff deutscher Vollverben, ausgehend von dessen Ursprung und Definition. Sie beleuchtet verschiedene Kategorien zur Bestimmung der Verbvalenz, wie die Anzahl, Art und Notwendigkeit von Ergänzungen. Dabei werden unterschiedliche theoretische Ansätze und Forschungsperspektiven betrachtet, um die Komplexität des Themas aufzuzeigen.
- Ursprung und Entwicklung des Valenzbegriffes
- Unterschiede in der Klassifizierung und Einteilung der Valenz
- Arten und Notwendigkeit von Ergänzungen
- Bedeutung der Satzglieder für die Valenz
- Probleme und Grenzen der Valenzforschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Valenztheorie ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Valenz deutscher Vollverben. Sie erläutert die Entwicklung der Valenzforschung seit Tesnière und hebt die Bedeutung der verschiedenen Ebenen der Sprache für die Definition des Valenzbegriffes hervor. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die wichtigsten Grundlagen der Valenztheorie darzustellen und dabei einige Probleme und Grenzen der Forschung aufzuzeigen. Die Beschränkung auf grundlegende Besonderheiten einzelner Ansätze wird begründet.
2. Der Valenzbegriff: Dieses Kapitel untersucht den Ursprung des Begriffs "Valenz", zunächst aus der Chemie entlehnt, und seine Übertragung auf die Linguistik. Es beleuchtet die Definition der Valenz in der Sprachwissenschaft und deren Anwendung auf Verben und andere Prädikatsausdrücke. Der Beitrag von Lucien Tesnière und seine Abhängigkeitsgrammatik werden als grundlegend für die Valenzgrammatik hervorgehoben. Die unterschiedlichen Definitionen und Interpretationen des Valenzbegriffes werden durch Verweise auf verschiedene Linguisten verdeutlicht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Valenz deutscher Vollverben
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Valenzbegriff deutscher Vollverben. Sie untersucht den Ursprung und die Definition des Begriffs, verschiedene Kategorien zur Bestimmung der Verbvalenz (Anzahl, Art und Notwendigkeit von Ergänzungen) und betrachtet unterschiedliche theoretische Ansätze und Forschungsperspektiven.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Ursprung und Entwicklung des Valenzbegriffes, Unterschiede in der Klassifizierung und Einteilung der Valenz, Arten und Notwendigkeit von Ergänzungen, Bedeutung der Satzglieder für die Valenz und Probleme und Grenzen der Valenzforschung. Sie beinhaltet eine detaillierte Betrachtung der Ansätze von Tesnière, Eisenberg und Helbig/Buscha.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der Valenzbegriff (inkl. Ursprung und Definition, Tesnières Beitrag), Ebenen der Valenz, Anzahl der Ergänzungen (Eisenberg und Helbig/Buscha), Arten von Ergänzungen, Grad der Notwendigkeit von Ergänzungen (obligatorisch/fakultativ, Weglaßprobe, freie Angaben), Bedeutung der Satzglieder für die Valenz, Schlussbetrachtungen und Literaturverzeichnis.
Wie wird der Valenzbegriff definiert und eingeführt?
Die Hausarbeit untersucht den Ursprung des Valenzbegriffs, der ursprünglich aus der Chemie stammt, und seine Übertragung auf die Linguistik. Sie beleuchtet verschiedene Definitionen und Interpretationen des Begriffs, wobei der Beitrag von Lucien Tesnière und seiner Abhängigkeitsgrammatik als grundlegend hervorgehoben wird. Die Arbeit verdeutlicht unterschiedliche Definitionen und Interpretationen durch Verweise auf verschiedene Linguisten.
Welche Ansätze zur Klassifizierung der Valenz werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Ansätze verschiedener Linguisten zur Klassifizierung der Valenz, insbesondere die Einteilungen von Eisenberg und Helbig/Buscha bezüglich der Anzahl der Ergänzungen. Es werden unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der obligatorischen und fakultativen Ergänzungen diskutiert, inklusive des Weglaßtests (Eliminierungstest).
Welche Rolle spielen obligatorische und fakultative Ergänzungen?
Die Hausarbeit unterscheidet zwischen obligatorischen und fakultativen Ergänzungen (Aktanten) und erklärt deren Bedeutung für die Valenz. Es wird erläutert, wie man mithilfe des Weglaßtests (Eliminierungstest) die Notwendigkeit von Ergänzungen bestimmen kann. Auch freie Angaben werden im Kontext der Valenz diskutiert und von Ergänzungen abgegrenzt.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die wichtigsten Grundlagen der Valenztheorie darzustellen und einige Probleme und Grenzen der Forschung aufzuzeigen. Sie beschränkt sich dabei auf grundlegende Besonderheiten einzelner Ansätze, um die Komplexität des Themas zu bewältigen.
Wo finde ich das Literaturverzeichnis?
Das Literaturverzeichnis befindet sich am Ende der Hausarbeit (Kapitel 9).
- Quote paper
- M.A. Uta Ziegler (Author), 2002, Valenz deutscher Verben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15645