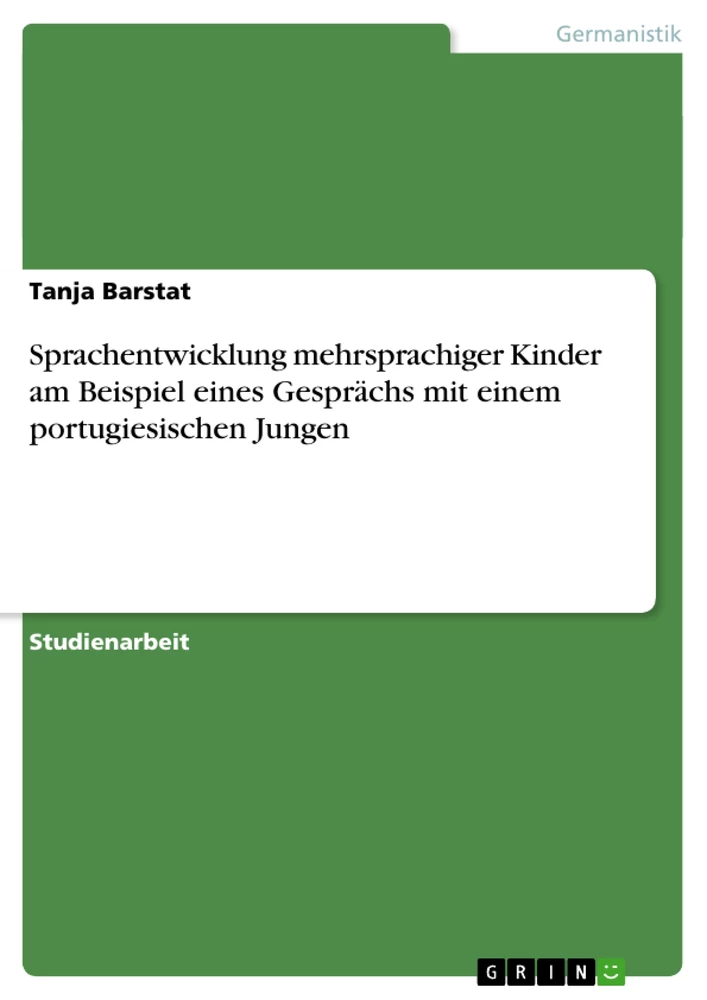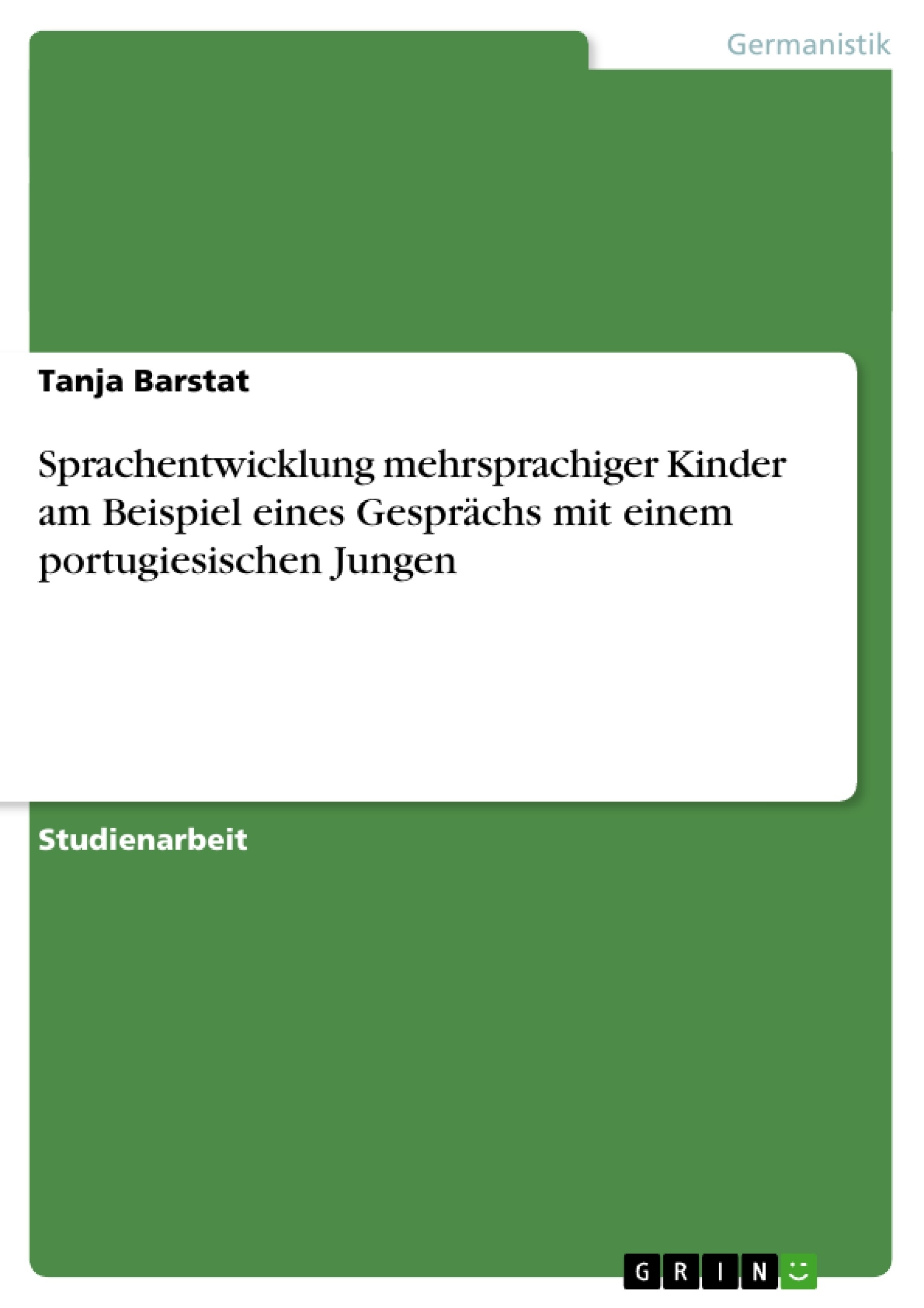In vorliegender Arbeit versuche ich anhand eines Gesprächsbeispiels mit einem
achtjährigen, portugiesischen Grundschüler zu zeigen, wie man als Lehrkraft,
auch ohne entsprechende Sprachkenntnisse, die Muttersprache von Migrantenkindern
mit der deutschen Sprache vergleichen kann, um dadurch die sprachlichen
Schwierigkeiten der Kinder im Deutschen zu verstehen. Meiner Meinung
nach erleichtert eine Gesprächsaufzeichnung die genaue Fehleranalyse, da eine
Tonbandaufnahme den enormen Vorteil hat, außerhalb des Unterrichtsgeschehens
mehrfach abgehört werden zu können. Aus dieser Gesprächsanalyse lassen sich
dann gezielte Fördermaßnahmen ableiten.
Zunächst werde ich die durchschnittliche, bereits vollzogene Sprachentwicklung
von Kindern diesen Alters darstellen, um überhaupt beurteilen zu können, welche
Sprachfertigkeiten bereits vorhanden sein müssten und welche Fehler im „Normbereich“
liegen. Normbereich darf in diesem Fall nur als Anhaltspunkt gesehen
werden, da gewisse Entwicklungsunterschiede naturgemäß auftreten und nicht
überbewertet werden dürfen. In einem weiteren Kapitel stelle ich kurz die Interdependenzhypothese
vor, da diese auf die besondere Sprachlernsituation mehrsprachiger
Kinder eingeht.
Im 4. Kapitel stelle ich das Kind, seinen Migrations- und Sprachhintergrund vor,
um hier schon Erklärungsansätze für Sprachfehlverhalten zu finden. Im darauf
folgenden Kapitel vergleiche ich die deutsche und portugiesische Sprache, sowohl
in Bezug auf Phonologie und Phonetik, als auch in Bezug auf relevante grammatische
Aspekte. Auch diese Beschreibung soll mir im Hauptteil helfen, die Äußerungen
des Kindes zu analysieren und auszuwerten.
Nachdem ich die Vorbereitung und Durchführung des Gesprächs geschildert habe,
um auch die äußeren Umstände in der Auswertung zu berücksichtigen, liegt dann
der Schwerpunkt meiner Arbeit auf der Analyse des Gesprächsausschnittes. Die mit einem Diktiergerät aufgenommenen Äußerungen des Jungen werde ich modifiziert,
orthographisch transkribieren.
Im abschließenden Kapitel werde ich Vermutungen über die weitere sprachliche
Entwicklung des Kindes anstellen und kurz auf die Fördermöglichkeiten hinweisen,
die man als Lehrkraft hätte/ hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die sprachliche Entwicklung bis zum Grundschulalter
- Die Interdependenzhypothese
- Vorstellung des Kindes und seines Sprachhintergrundes
- Unterschiede zwischen der deutschen und portugiesischen Sprache
- Phonetik/ Phonologie
- Konsonanten
- Vokale
- Silbenbetonung
- Grammatik
- Tempusformen
- Artikel
- Subjekt- und Possessivpronomen
- Negation
- Satzbau
- Phonetik/ Phonologie
- Ein Gesprächsbeispiel
- Vorbereitung und Durchführung
- Transkription
- Analyse
- Aussprache
- Tempusformen
- Artikel
- Pronomen
- Negation
- Satzbau
- Auswertung
- Resümee/ Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die sprachliche Entwicklung eines achtjährigen, portugiesischen Grundschülers anhand eines Gesprächsbeispiels. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Lehrkräfte die Muttersprache von Migrantenkindern mit der deutschen Sprache vergleichen können, um deren sprachliche Schwierigkeiten zu verstehen. Die Arbeit beleuchtet die durchschnittliche Sprachentwicklung von Grundschülern, die Interdependenzhypothese im Kontext des mehrsprachigen Spracherwerbs und die sprachlichen Unterschiede zwischen Deutsch und Portugiesisch.
- Sprachentwicklung mehrsprachiger Kinder
- Vergleich der deutschen und portugiesischen Sprache
- Analyse eines Gesprächsbeispiels
- Identifizierung von sprachlichen Schwierigkeiten
- Möglichkeiten der Sprachförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Zielsetzung der Arbeit und die Vorgehensweise bei der Analyse des Gesprächsbeispiels. Im zweiten Kapitel wird die durchschnittliche Sprachentwicklung von Kindern bis zum Grundschulalter dargestellt. Kapitel 3 stellt die Interdependenzhypothese vor, die die besonderen Bedingungen des Spracherwerbs für mehrsprachige Kinder beleuchtet. Kapitel 4 präsentiert das Kind und seinen Sprachhintergrund. In Kapitel 5 werden Unterschiede zwischen der deutschen und portugiesischen Sprache in Bezug auf Phonetik, Phonologie und Grammatik hervorgehoben. Kapitel 6 beschreibt die Vorbereitung, Durchführung und Analyse des Gesprächsbeispiels. Die Auswertung des Gesprächs fokussiert auf die Aussprache, Tempusformen, Artikel, Pronomen, Negation und den Satzbau. Abschließend werden im Resümee Vermutungen zur weiteren sprachlichen Entwicklung des Kindes angestellt und mögliche Fördermaßnahmen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Sprachentwicklung, Mehrsprachigkeit, Portugiesisch, Deutsch, Interdependenzhypothese, Sprachvergleich, Gesprächsanalyse, Fehleranalyse, Sprachförderung.
- Quote paper
- Tanja Barstat (Author), 2003, Sprachentwicklung mehrsprachiger Kinder am Beispiel eines Gesprächs mit einem portugiesischen Jungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15592