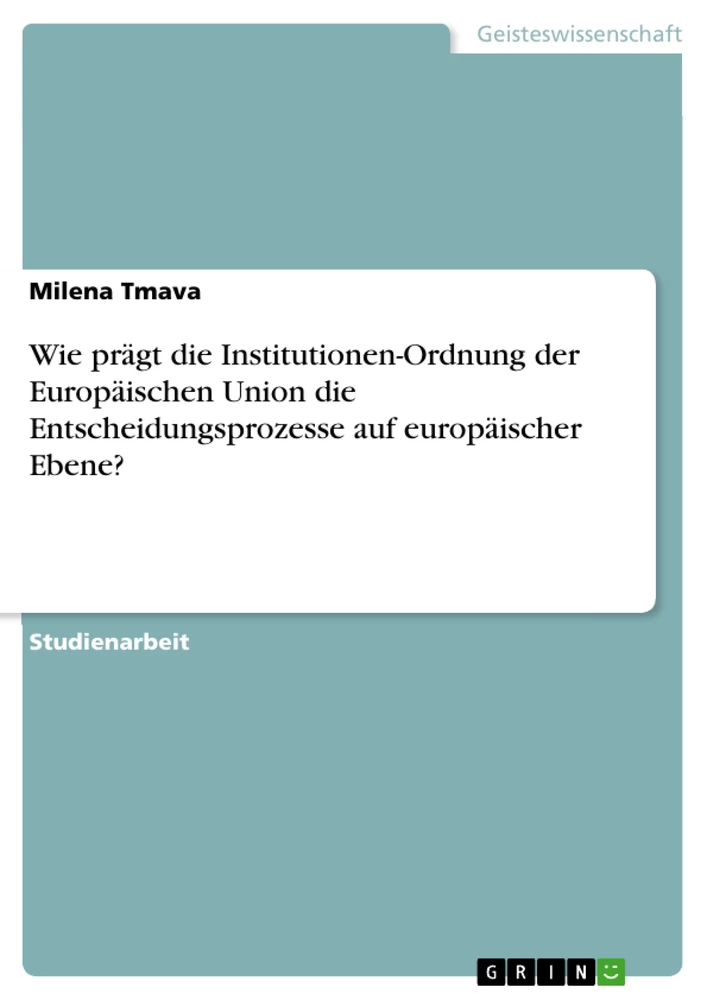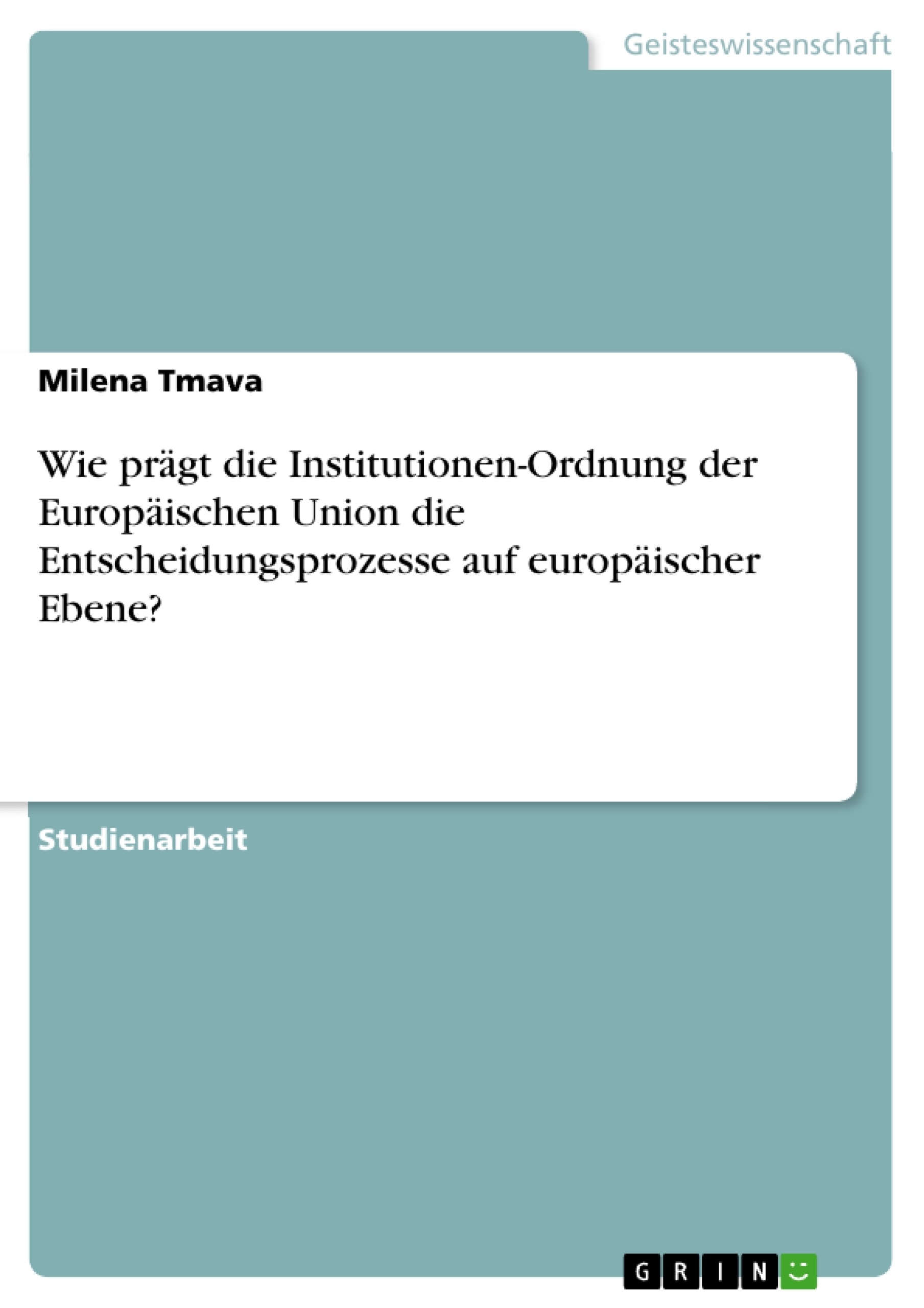Niklas Luhmann nennt das Treffen verbindlicher Entscheidungen als das „Zweckprogramm“
und damit die Kernfunktion politischer Instituitionen (Röhrich 1977: 76).
Doch wie kommen Entscheidungen in politischen (Mehrebenen-)Systemen zustande und
durch was werden Decision-Making-Prozesse beeinflusst? Ausgehend von diesen
Überlegungen versucht die vorliegende Arbeit die Frage zu beantworten, wie die
Institutionen-Ordnung der Europäischen Union die Entscheidungsprozesse auf europäischer
Ebene prägt.
Um sich der Frage zu nähern, scheint es sinnvoll, zunächst die Organe des politischen
„Mehrebenensystems“ der Europäischen Union zu analysieren und zu untersuchen, welche
Interessen hinter den einzelnen Organen in den europäischen Gesetzgebungs- und
Entscheidungsprozessen stehen, um nachzuvollziehen, welche Positionen sie im Decision-
Making-Prozess (beispielsweise aufgrund ihres Selbstverständnisses und ihrer
Zusammensetzung) vertreten. Hierzu werden sowohl die Organe selbst (Kommission, der Rat
und das Europaparlament) als auch die Ausschüsse analysiert, da diese die Legislative der EU
repräsentieren. Außerdem wird das „Institutionellen Gleichgewicht“1 als die Grundlage dieser
Institutionenordnung und der damit verbundenen Kompetenzverteilung untersucht, um das
Spannungsverhältnissen zwischen sowohl europäischen und nationalstaatlichen als auch interorganischen
Interessen besser nachvollziehen zu können (vgl. Bach 2008b: 296).
Dahingehend muss dann untersucht werden, wie der Interessenkonflikt zwischen den Organen
ausgestaltet ist und ausgeglichen wird.
Auf diese Weise kann dann wiederum ebenso nachvollzogen werden, welche Systemlogik
hinter dem gesamten Herrschaftssystem der EU steht und welche Bedeutung der neuartige
Gewaltenteilungsgrundsatz in diesem Zusammenhang für die Organisationsstruktur, d.h. die
Kompetenzverteilung und die Verfahrensordnung besitzt.
Daneben soll diese Arbeit die These überprüfen, ob es sich bei der EU eher um ein
„multidimensionales, vernetztes Verhandlungssystem“ handelt als um ein
Entscheidungsregime im eigentlichen Sinne (vgl. Grande 1995: 332).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Institutionenbegriff und die Europäische Union
- Politische Institutionen
- Die Europäische Institutionenlogik
- Die Institutionenordnung der Europäischen Union
- Das „Institutionelle Gleichgewicht“
- Die Organe
- Das Europaparlament
- Die Kommission
- Der Rat
- Die Ausschüsse
- Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Institutionenordnung der Europäischen Union die Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene prägt. Sie analysiert die Organe der Europäischen Union, ihre Interessen und ihre Rolle im Decision-Making-Prozess. Darüber hinaus wird das "Institutionelle Gleichgewicht" und die Kompetenzverteilung untersucht, um das Spannungsverhältnis zwischen europäischen, nationalstaatlichen und interorganischen Interessen zu verstehen.
- Analyse der Organe der Europäischen Union (Kommission, Rat, Europaparlament, Ausschüsse)
- Untersuchung des "Institutionellen Gleichgewichts" und der Kompetenzverteilung
- Analyse des Interessenkonflikts zwischen den Organen
- Erforschung der Systemlogik des Herrschaftssystems der EU
- Bewertung der These, ob die EU eher ein "multidimensionales, vernetztes Verhandlungssystem" oder ein Entscheidungsregime im eigentlichen Sinne ist.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage, welche die Prägung von Entscheidungsprozessen durch die Institutionenordnung der Europäischen Union untersucht.
- Kapitel 2 beleuchtet den Begriff der Institution im politischen Sinne und untersucht die Europäische Union als Institutionensystem.
- Kapitel 3 analysiert die Institutionenordnung der Europäischen Union, einschließlich des "Institutionellen Gleichgewichts" und der einzelnen Organe (Kommission, Rat, Europaparlament, Ausschüsse).
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem komplexen Zusammenspiel von Institutionen, Entscheidungsprozessen und Interessenkonflikten in der Europäischen Union. Die wichtigsten Themen sind die politische Institutionenordnung, das europäische Entscheidungsregime, das "Institutionelle Gleichgewicht", die Organe der EU und die Analyse der europäischen Gesetzgebungsprozesse. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Konsensmaschinerie, der Gewaltenteilung und des multidimensionalen Verhandlungssystems in der Europäischen Union.
Häufig gestellte Fragen
Wie kommen Entscheidungen in der EU zustande?
Entscheidungen basieren auf einem komplexen Zusammenspiel der Organe (Kommission, Rat, Parlament) und hängen stark von der jeweiligen Verfahrensordnung und Kompetenzverteilung ab.
Was bedeutet "Institutionelles Gleichgewicht" in der EU?
Es beschreibt das Prinzip, dass jedes EU-Organ seine Befugnisse unter Beachtung der Befugnisse der anderen Organe ausüben muss, um ein Machtgleichgewicht zu wahren.
Welche Rolle spielt die EU-Kommission im Entscheidungsprozess?
Die Kommission besitzt das Initiativrecht für Gesetzgebungsverfahren und vertritt primär die gemeinschaftlichen europäischen Interessen.
Ist die EU eher ein Verhandlungssystem oder ein Entscheidungsregime?
Die Arbeit prüft die These, dass die EU ein multidimensionales, vernetztes Verhandlungssystem ist, in dem Konsensfindung oft wichtiger ist als klassische Mehrheitsentscheidungen.
Warum sind Ausschüsse für die EU-Legislative so wichtig?
In den Ausschüssen findet die detaillierte fachliche Vorarbeit und Interessenabwägung statt, bevor Gesetzesvorlagen in den Rat oder das Parlament gelangen.
- Quote paper
- Milena Tmava (Author), 2010, Wie prägt die Institutionen-Ordnung der Europäischen Union die Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155860