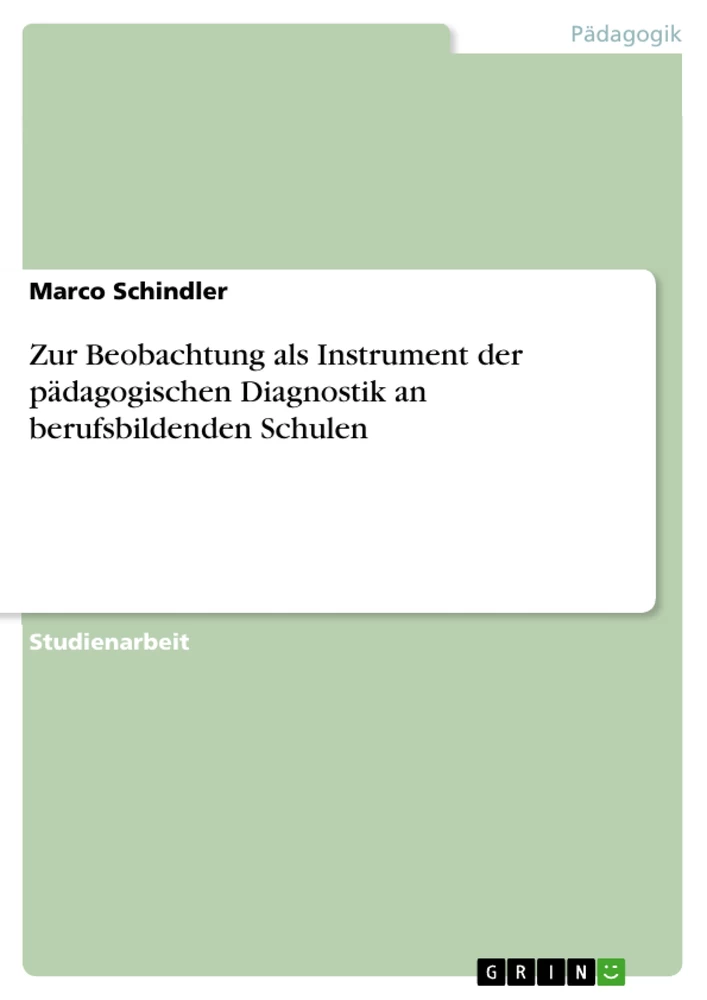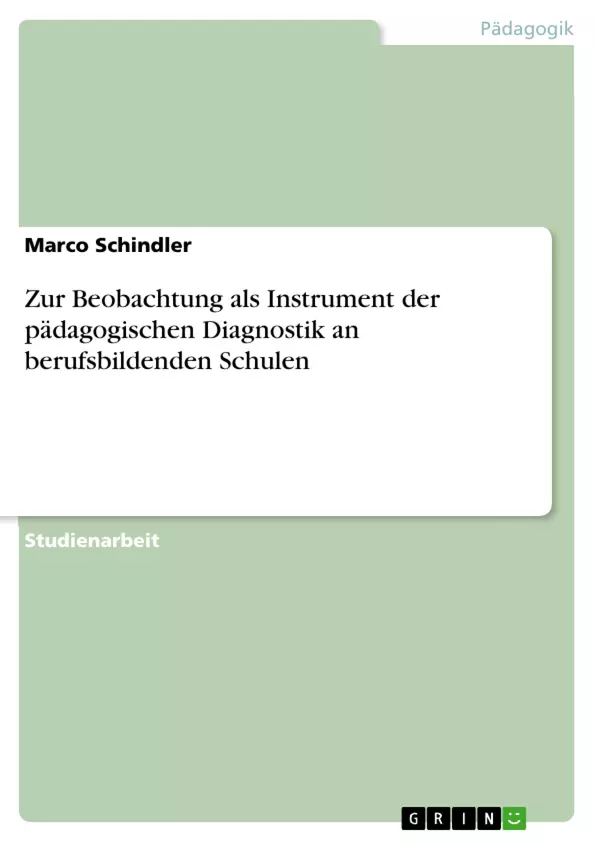„Das Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland ist durch eine sehr große Differenziertheit gekennzeichnet“ (Gauger & Kraus 2007). Im deutschen Schulsystem befinden sich neben einer Vielzahl von allgemeinbildenden auch berufsbildende Schulformen, auf die im weiteren Verlauf dieser Arbeit Bezug genommen wird. Sie sollen dazu dienen, die Schüler an die Herausforderungen der heutigen beruflichen Umwelt heranzuführen. Die angeführte berufliche Umwelt ist dabei geprägt von einem gesamtwirtschaftlichen Phänomen – der Globalisierung. Weltweit operierende Unternehmen legen einen großen Stellenwert auf eine ganzheitliche Form der schulischen Bildung, die den neuen Anforderungen der Arbeitswelt gerecht werden. Dabei steht die berufliche Handlungskompetenz im Vordergrund, denn die Schüler an berufsbildenden Schulen, also die Arbeitskräfte von morgen, sollen neben fachlichen Kenntnissen auch Kompetenzen in den Bereichen Methoden, Soziales, Abstraktion oder Moral und Ethik erlangen. (vgl. Rebmann, Tenfelde & Uhr 2005, S. 116 f.) Daraus ergeben sich spezifische Anforderungen an die berufsbildenden Schulen, die ihren Unterricht auf die veränderten Rahmenbedingungen auslegen müssen, um die Schüler auf die Arbeitswelt vorzubereiten. In diesem Zusammenhang wird von Bildungsexperten häufig die Art der Leistungsmessung durch die Lehrer kritisiert. „Insbesondere die Form der Ziffernzensur und die Auslese von Schülern anhand der Noten waren dabei immer wieder Stein des Anstoßes“ (Winter 2004, S. 3). Die Kritik richtet sich primär auf die Erhebung der Leistungsbewertung, die im alltäglichen Unterricht in Form von Klausuren durchgeführt wird. Dabei ist diese Art der Lernstandskontrolle auf eine Produktbewertung ausgerichtet. Werden jedoch Anforderungen der Arbeitswelt in diesen Kontext integriert, so ergeben sich entscheidende Nachteile der Bewertungsmethode Klausur, da der Entstehungsprozess und damit einhergehend die Entwicklung des Schülers nicht berücksichtigt werden (vgl. Gudjons 2008, S. 27 f.; Ledl 1994, S. 23 ff.; Altrichter & Posch 2007, S. 110 ff.). Die kritische Sichtweise auf Klausuren als weitestgehend alleinige Lernstandskontrolle ist mit der Forderung nach einer zeitgemäßen Lernkultur verbunden, dessen Ausgestaltung sich auf den Lernprozess fokussiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Vorgehensweise
- Die pädagogische Diagnostik im schulischen Einsatz
- Systematische Beobachtungen im Unterricht an berufsbildenden Schulen
- Notwendigkeit zur Beobachtung schulischer Leistung
- Beobachtungsbereiche schulischer Leistungen
- Beobachtungsschwerpunkte im schulischen Alltag
- Beobachtung der Schüleraktivität durch Lehrende
- Der Schüler als Beobachter schulischer Leistung
- Wirksamkeit von Beobachtungen schulischer Aktivität als Instrument der pädagogischen Diagnostik zur Leistungsmessung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Beobachtung als Instrument der pädagogischen Diagnostik an berufsbildenden Schulen. Ziel ist es, die Bedeutung von Beobachtungen im Unterricht aufzuzeigen, um die individuelle Entwicklung von Schülern nachvollziehen zu können. Die Arbeit beleuchtet die Notwendigkeit und die Praxis systematischer Beobachtungen, um die Leistungsentwicklung der Schüler zu erfassen und den Unterricht entsprechend anzupassen.
- Bedeutung der pädagogischen Diagnostik an berufsbildenden Schulen
- Systematische Beobachtung als Instrument der Leistungsbeurteilung
- Bedeutung des Lernprozesses für die Schülerentwicklung
- Herausforderungen und Möglichkeiten der Beobachtung im schulischen Alltag
- Wirksamkeit von Beobachtungen im Hinblick auf die Zielsetzung des Unterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung dar, die sich aus der Notwendigkeit ergibt, den Lernprozess von Schülern in berufsbildenden Schulen durch geeignete Instrumente zu erfassen und zu bewerten. Die Arbeit argumentiert, dass die traditionelle Fokussierung auf Klausuren als primäres Instrument der Leistungsmessung unzureichend ist, um die komplexen Anforderungen der heutigen Arbeitswelt zu erfüllen. Als Alternative wird die Beobachtung von Schülern im Unterricht vorgeschlagen, um die Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen im Prozess der Leistungserstellung nachzuvollziehen.
Kapitel 2 erläutert den Begriff der pädagogischen Diagnostik und ihre Bedeutung im schulischen Kontext. Es wird die Rolle des Lehrers als Diagnostiker hervorgehoben, der in der Lage sein sollte, die individuellen Lernbedürfnisse der Schüler zu erkennen und den Unterricht entsprechend zu gestalten. Die Wichtigkeit einer individuellen Förderplanung und die Herausforderungen der individuellen Gestaltung des Unterrichts in Klassen mit großer Schülerzahl werden ebenfalls angesprochen.
Kapitel 3 befasst sich mit den systematischen Beobachtungen im Unterricht an berufsbildenden Schulen. Es werden die Gründe für die Notwendigkeit von Beobachtungen dargelegt, und es werden verschiedene Beobachtungsbereiche schulischer Leistungen erläutert, die für die pädagogische Diagnostik relevant sind. Die unterschiedlichen Schwerpunkte der Beobachtung und die verschiedenen Perspektiven von Lehrenden und Schülern auf den Unterricht werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Pädagogische Diagnostik, Beobachtung, berufsbildende Schulen, Lernprozess, Leistungsmessung, Schüleraktivität, Objektivität, Wirksamkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist pädagogische Diagnostik?
Sie umfasst alle Tätigkeiten, mit denen Lehrer Lernvoraussetzungen analysieren und Lernprozesse beobachten, um Schüler individuell zu fördern.
Warum wird die Ziffernzensur oft kritisiert?
Noten allein bilden oft nur das Ergebnis (Produkt) ab, lassen aber den individuellen Lernweg und soziale Kompetenzen unberücksichtigt.
Welchen Vorteil hat die systematische Beobachtung im Unterricht?
Sie ermöglicht es, die berufliche Handlungskompetenz und den Entstehungsprozess einer Leistung direkt im schulischen Alltag zu erfassen.
Wie können Schüler selbst als Beobachter fungieren?
Durch Peer-Feedback oder Selbsteinschätzungsbögen lernen Schüler, ihre eigenen Leistungen und die ihrer Mitschüler kritisch und konstruktiv zu reflektieren.
Was sind Beobachtungsschwerpunkte in berufsbildenden Schulen?
Schwerpunkte sind neben Fachwissen vor allem Methodenkompetenz, Sozialverhalten, Abstraktionsvermögen und die Fähigkeit zur Problemlösung.
- Quote paper
- B.A. Marco Schindler (Author), 2010, Zur Beobachtung als Instrument der pädagogischen Diagnostik an berufsbildenden Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153472