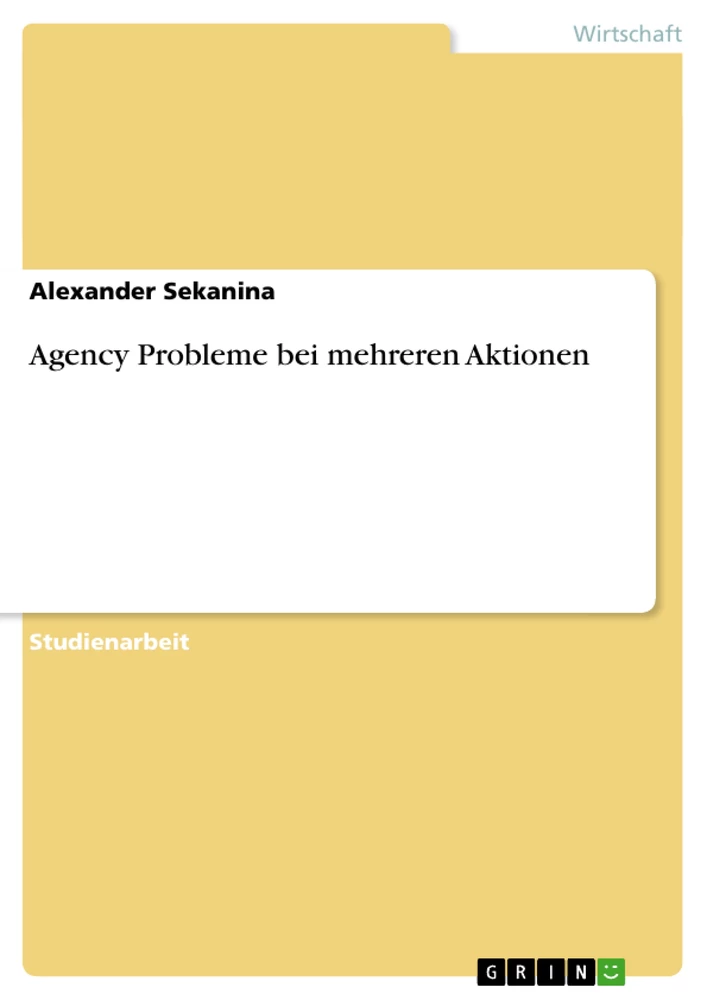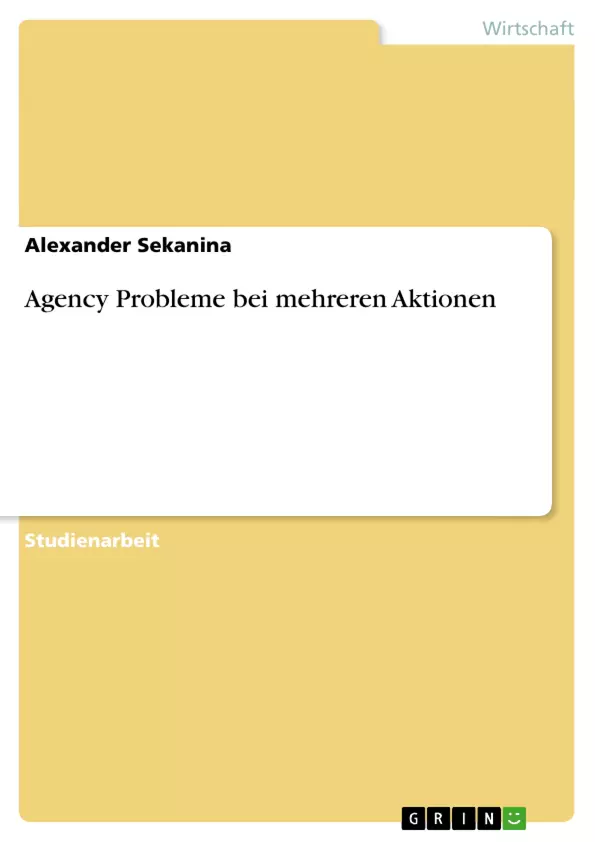Eine der grundlegendsten Fragen, die bei der Produktion von Dienstleitungen und
Gütern auftauchen und maßgeblich die Anreizstruktur im Unternehmen beeinflussen ist
die „make or buy“ Entscheidung – welche Güter oder Leistungen sollen von
Beschäftigten im eigenen Betrieb erledigt werden und welche von „Außenstehenden“
Unabhängigen. Der große Unterschied zwischen beiden Gruppen besteht in den
Anreizen die für sie in deren Entlohnung bestehen. Der angestellte Beschäftigte im
Betrieb erhält zumeist eine fixe Entlohnung für die er seine „Arbeitskraft zur Verfügung
zu stellen hat“. Anreiz seine Arbeit in ausreichender Qualität und Quantität auszuführen
besteht in der möglichen Entlassung oder Versetzung der Person in ungeliebte
Arbeitsbereiche. Ganz anders stellt sich die Situation für Externe da – sie werden
zumeist nach Erfolg, dass heißt nach messbaren Größen beurteilt, die dann deren
Entlohnung bestimmt. Die Vorteile eines solchen Systems liegen klar auf der Hand.
Dadurch, dass der der Auftragnehmer mit seinem Verhalten die Höhe seiner Entlohnung
selbst bestimmen kann hat er einen direkten Ansporn eine möglichst gute und effiziente
Arbeitsweise an den Tag zu legen.
Diese vermeintlich bessere Effizienz ist es, die einen „Prinzipal“, den Eigentümer eines
Unternehmens dazu veranlasst eine ähnliche Struktur auf diejenigen die maßgeblichen
Einfluss auf die Verwaltung seines Eigentums haben, die „ Agenten“, anzuwenden. Mit
einem bestimmten System von Anreizen versucht der Prinzipal seinen Agent, der rein
rational nach seinen „Bedürfnissen“ handelt, dazu zu bewegen seine Tätigkeit genau im
Sinne des Prinzipal auszuführen. Die einzige Möglichkeit, außer einer Fixentlohnung,
die eben nicht sehr effizient ist, dies zu bewerkstelligen besteht darin die Entlohnung
des Agenten so von seinen Erfolgen abhängig zu machen, sodass ein rationaler Denker
von sich aus die vom Prinzipal gewünschten Effekte anstrebt.
Ziel dieser Arbeit ist es zunächst in das Thema des „Principal-Agent-Problems“
mittels eines einfachen Modells einzuführen um dann Lösungen in der Situation von
mehreren Aktionen zu diskutieren. Dabei werden die Fälle auf einen Agenten mit 2
Aufgaben beschränkt. Nach der Modellanalyse einmal mit einer additiv separierbaren
Disnutzenfunktion des Agenten und einmal mit nicht additiv separierbarem Disnutzen wird die Güte der Leistungsmessung betrachtet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das einfache Principal-Agent Modell
- 2.1 Second Best
- 2.2 First Best
- 2.3 Effizienter Vertrag
- 3 Das Principal-Agent Modell bei mehreren Aktionen
- 3.1 Mehrere Aktionen mit additiv separierbarer Disnutzenfunktion
- 3.1.1 Interpretation der Ergebnisse
- 3.2 Mehrere Aktionen mit nicht a. separierbarer Disnutzenfunktion
- 3.3 Leistungsmessung
- 3.4 Zusätzliche Beurteilungsgrößen
- 3.4.1 Balanced Incentives
- 3.4.2 Der Wert einer zusätzlichen Beurteilungsgröße
- 3.5 Fixentlohnung bei mehrdimensionaler Tätigkeit
- 3.5.1 Modell mit nur einer messbaren Leistungsgröße
- 3.1 Mehrere Aktionen mit additiv separierbarer Disnutzenfunktion
- 4 Schlussfolgerungen aus dem Multitask P-A Modell
- 5 Empirische Evidenz
- 5.1 ,,Balancing Incentives“
- 5.2 Zusätzliche Beurteilungsgrößen
- 5.2.1 Prognosen aus dem Modell und deren Verifizierung
- 5.3 Implementierung von Anreizen
- 5.3.1 Eine alternative Lösung des Problems in der Bildung
- 5.3.2 Negative und positive Aspekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Principal-Agent-Problem, insbesondere im Kontext mehrerer Aktionen. Ziel ist es, Lösungen für die Gestaltung effizienter Anreizsysteme zu entwickeln und diese anhand empirischer Beispiele zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Modellierung des Problems unter verschiedenen Annahmen, wie z.B. additiv separierbarer und nicht-additiv separierbarer Disnutzenfunktionen des Agenten.
- Das einfache Principal-Agent-Modell und seine Grenzen
- Das Principal-Agent-Modell bei mehreren Aktionen mit unterschiedlichen Disnutzenfunktionen
- Die Rolle der Leistungsmessung und die Auswirkungen von Messfehlern
- Der Einfluss zusätzlicher Beurteilungsgrößen auf die Anreizgestaltung
- Empirische Evidenz zur Wirksamkeit verschiedener Anreizsysteme
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „make or buy“-Entscheidungen und die damit verbundenen Anreizstrukturen ein. Sie vergleicht die Anreize für interne und externe Auftragnehmer und begründet die Notwendigkeit von Anreizsystemen für Agenten, um die Ziele des Prinzipals zu erreichen. Die zentrale Frage nach der Gestaltung effizienter Anreizsysteme bei mehreren Aktionen wird formuliert und der Aufbau der Arbeit skizziert.
2 Das einfache Principal-Agent Modell: Dieses Kapitel präsentiert das grundlegende Principal-Agent-Modell, indem es die Konzepte von „First Best“ und „Second Best“ erläutert und einen effizienten Vertrag definiert. Es legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse des Problems bei mehreren Aktionen. Die verschiedenen Vertragsformen werden in Bezug auf ihre Effizienz und die damit verbundenen Annahmen diskutiert. Der Fokus liegt auf der optimalen Anreizgestaltung unter Informationsasymmetrie.
3 Das Principal-Agent Modell bei mehreren Aktionen: Dieses zentrale Kapitel erweitert das einfache Modell auf die Situation, in der der Agent mehrere Aufgaben zu bewältigen hat. Es wird zwischen additiv separierbaren und nicht-additiv separierbaren Disnutzenfunktionen unterschieden und die Auswirkungen auf die optimale Anreizgestaltung analysiert. Die Bedeutung der Leistungsmessung und die Herausforderungen bei der Berücksichtigung mehrerer Leistungsgrößen werden detailliert untersucht. Die Konzepte von „Balanced Incentives“ und der Wert zusätzlicher Beurteilungsgrößen werden im Detail erklärt.
4 Schlussfolgerungen aus dem Multitask P-A Modell: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Modellanalysen zusammen und zieht Schlussfolgerungen für die praktische Gestaltung von Anreizsystemen. Es werden die wichtigsten Erkenntnisse der vorherigen Kapitel nochmals prägnant dargestellt und deren Implikationen für Unternehmen und Organisationen diskutiert. Die Grenzen des Modells und die Notwendigkeit weiterer Forschung werden hier ebenfalls angesprochen.
5 Empirische Evidenz: Das Kapitel präsentiert empirische Ergebnisse aus verschiedenen Studien, die die theoretischen Erkenntnisse des Modells untermauern oder erweitern. Es werden Beispiele aus der Tankstellen- und Pharmaindustrie sowie aus dem Hochschulbereich vorgestellt, um die praktische Relevanz des Principal-Agent-Problems und die Wirksamkeit verschiedener Anreizlösungen zu illustrieren. Die Diskussion der empirischen Evidenz dient dazu, die theoretischen Modelle durch Praxisbeispiele zu veranschaulichen und ihre Aussagekraft zu überprüfen.
Schlüsselwörter
Principal-Agent-Problem, Anreizgestaltung, Mehrere Aktionen, Leistungsmessung, Informationsasymmetrie, Disnutzenfunktion, Effizienz, Balanced Incentives, Empirische Evidenz, Fixentlohnung, Variable Entlohnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Principal-Agent-Modell bei mehreren Aktionen
Was ist der Gegenstand des Dokuments?
Das Dokument analysiert das Principal-Agent-Problem, insbesondere im Kontext von Multitasking (mehrere Aktionen des Agenten). Es untersucht die Gestaltung effizienter Anreizsysteme unter verschiedenen Annahmen und beleuchtet diese anhand empirischer Beispiele.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt das einfache Principal-Agent-Modell ("First Best" und "Second Best"), erweitert dieses auf Situationen mit mehreren Aktionen (mit additiv separierbaren und nicht-additiv separierbaren Disnutzenfunktionen), untersucht die Rolle der Leistungsmessung und den Einfluss zusätzlicher Beurteilungsgrößen ("Balanced Incentives"), und präsentiert schließlich empirische Evidenz zur Wirksamkeit verschiedener Anreizsysteme.
Welche Kapitel umfasst das Dokument und worum geht es in jedem Kapitel?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein. Kapitel 2 erklärt das einfache Principal-Agent-Modell. Kapitel 3 erweitert das Modell auf mehrere Aktionen, differenziert nach verschiedenen Disnutzenfunktionen und behandelt die Leistungsmessung. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse des Multitask-Modells zusammen. Kapitel 5 präsentiert empirische Evidenz und Beispiele zur Veranschaulichung der theoretischen Konzepte.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des Dokuments?
Die wichtigsten Erkenntnisse betreffen die Herausforderungen der Anreizgestaltung bei mehreren Aktionen, die Bedeutung der Leistungsmessung und der Einfluss von Informationsasymmetrien. Das Dokument zeigt, wie die Wahl der Anreizstruktur von der Art der Disnutzenfunktion des Agenten abhängt und welche Rolle zusätzliche Beurteilungsgrößen spielen können ("Balanced Incentives"). Empirische Beispiele verdeutlichen die praktische Relevanz der theoretischen Modelle.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Principal-Agent-Problem, Anreizgestaltung, Mehrere Aktionen, Leistungsmessung, Informationsasymmetrie, Disnutzenfunktion, Effizienz, Balanced Incentives, Empirische Evidenz, Fixentlohnung, Variable Entlohnung.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Wissenschaftler, Studierende und Praktiker, die sich mit Fragen der Anreizgestaltung, der Vertragsgestaltung und der Organisation von Arbeitsprozessen befassen. Es ist besonders nützlich für diejenigen, die sich mit den Herausforderungen der Anreizsetzung in komplexen Umgebungen mit mehreren Aufgaben auseinandersetzen.
Wo finde ich empirische Evidenz im Dokument?
Empirische Evidenz wird in Kapitel 5 präsentiert. Es werden Beispiele aus verschiedenen Branchen (z.B. Tankstellen- und Pharmaindustrie, Hochschulbereich) vorgestellt, um die praktische Relevanz des Principal-Agent-Problems und die Wirksamkeit verschiedener Anreizlösungen zu illustrieren.
Wie wird das Problem der Leistungsmessung im Dokument behandelt?
Das Problem der Leistungsmessung wird in Kapitel 3 ausführlich behandelt. Es wird untersucht, wie die Messung der Leistung des Agenten die optimale Anreizgestaltung beeinflusst, insbesondere wenn mehrere Leistungsgrößen existieren. Die Herausforderungen bei der Berücksichtigung von Messfehlern werden ebenfalls diskutiert.
- Citation du texte
- Alexander Sekanina (Auteur), 2003, Agency Probleme bei mehreren Aktionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15335