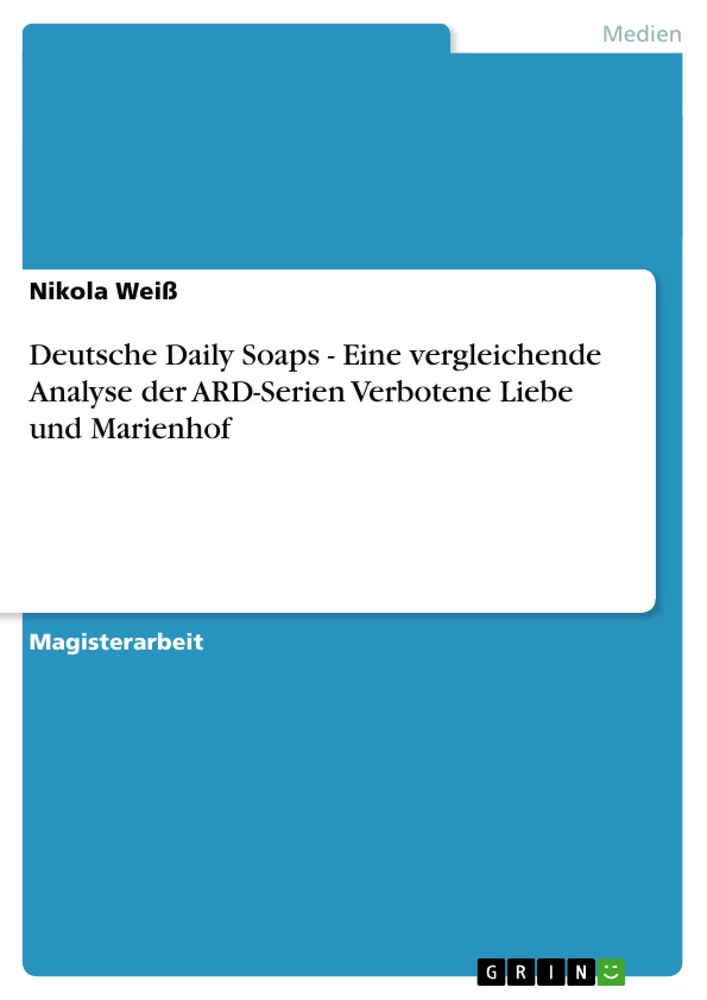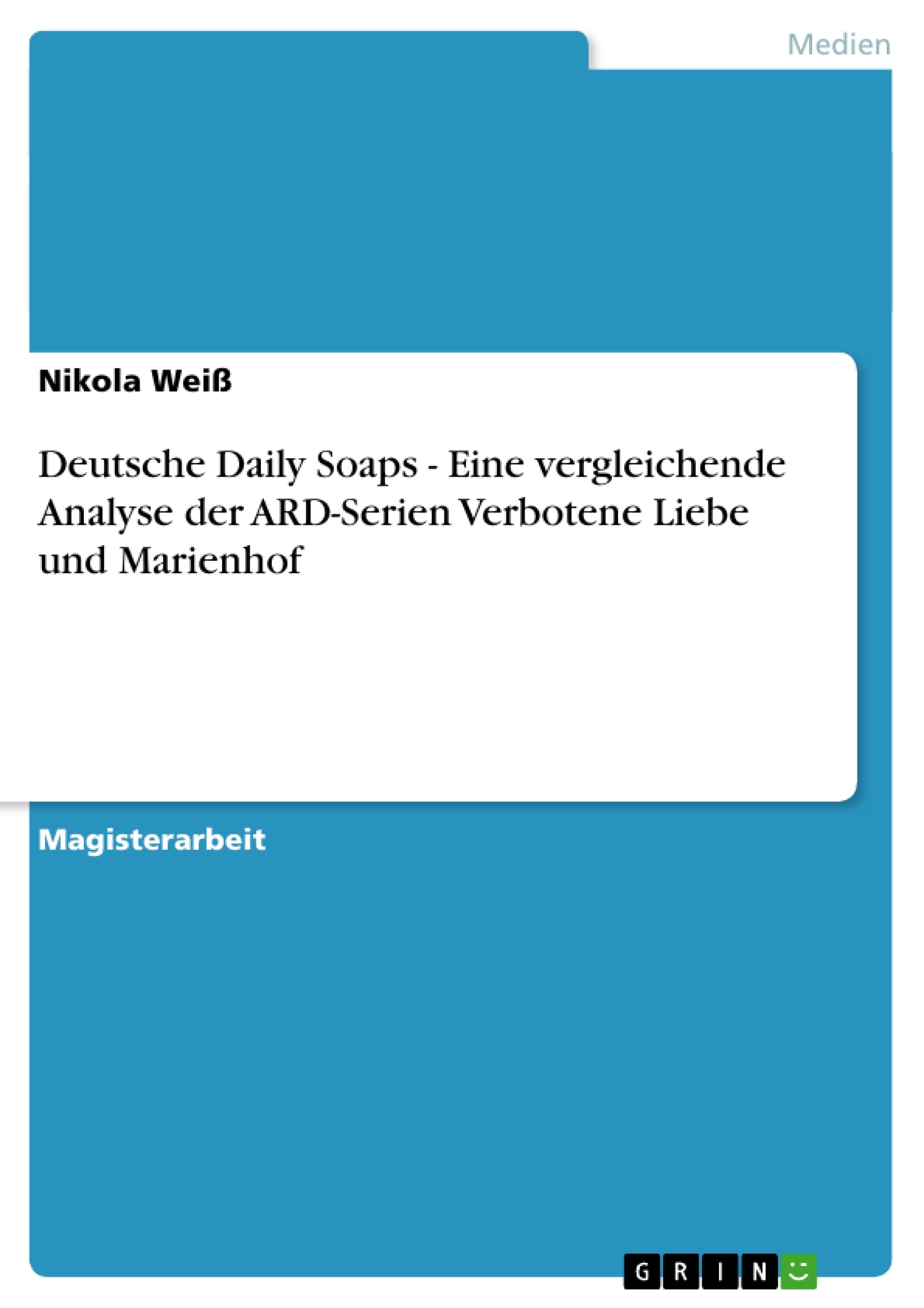„Fernsehserien wollen, nein, sie müssen den Massen gefallen. Dafür
sind sie gemacht. Manchen Serien gelingt das besonders gut.
In ihnen erkennt das Volk sich selber, seine Wünsche, seine Ängste.
Wenn wir uns diese Serien anschauen, dann schauen wir in
den Spiegel. Und weil wir uns selber ändern, ändern sich auch die
Serien, denen wir verfallen.“1 Schließt man sich dieser Aussage
von Harald Martenstein an, so „verfallen“ seit nunmehr über zehn
Jahren Teile des deutschen Volkes einer neuen Form von Fernsehserie:
der deutschen Daily Soap.
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Genre ist hierzulande
noch nicht besonders ausgereift. Auch in den USA, wo die „Soap
Opera“ ihre Wurzeln hat, war die Seifenoper gerade wegen ihrer
Trivialität und Massen-Tauglichkeit im wissenschaftliche n Diskurs
lange Zeit wenig ge- und beachtet. Nach anfänglichen Studien zur
vermeintlich schädlichen Wirkung von Radio-Seifenopern in den
vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts begannen erst in den siebziger
Jahren wieder Untersuchungen zum Soap Opera-Text. Vor allem
die feministische Forschung interessierte sich für das Frauen-
Genre, und so setzte Mitte der achtziger Jahre wieder vermehrt die
Zuschauerforschung zu den Seifenopern ein. In Deutschland erschienen
zu dieser Zeit erste Studien zu wöchentlichen Soaps wie
Dallas oder Lindenstraße. In den neunziger Jahren schließlich
wurden auch die amerikanischen Daily Soaps im deutschen Fernsehen
zum Gegenstand des Interesses.
Die eigenproduzierten deutschen Daily Soaps hingegen spielen in
der Forschung bis dato eher eine untergeordnete Rolle. Neben einigen
Diplomarbeiten zu diesem Thema beschäftigt sich nur ein
langfristig angelegtes Projekt an der Universität Duisburg mit der
Produktion, den Inhalten, den Rezipienten und vor allem mit der
Vermarktung von deutschen „Dailies“. An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Sie beschäftigt
sich mit der besonderen Situation der öffentlich-rechtlichen Daily
Soaps Verbotene Liebe (kurz: VL) und Marienhof: Beide Seifenopern
werden direkt nacheinander im Vorabendprogramm der ARD
ausgestrahlt, und obwohl anzunehmen ist, dass damit einige Besonderheiten
verbunden sind, hat sich bisher noch keine Studie explizit
mit dem Vergleich dieser beiden Soaps beschäftigt. [...]
1 Martenstein 1996, S.11f.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Seifenoper
- 1. Begrifflichkeit
- 2. Definition
- 2.1. „Series“ und „Serials“
- 2.2. „Daytime Serials“ und „Prime-time Serials“
- 2.3. Abgrenzung gegenüber anderen Serienformaten
- 2.4. Die Inhalte
- 2.5. Genre Codes
- 2.6. Darstellungsprinzipien
- 2.7. Fazit
- 3. Entstehung und Geschichte
- 3.1. Die Soap Opera im Radio
- 3.2. Die Soap Opera im Fernsehen
- 4. Seifenopern in Deutschland
- 4.1. Die Tradition der Familienserie im deutschen Fernsehen
- 4.2. Die Entwicklung der Daily Soaps in Deutschland
- 4.3. Die deutschen Daily Soaps im Überblick
- III. Analyse der ARD-Soaps
- 1. Verbotene Liebe
- 1.1. Vorgeschichte: australische Soaps / Sons and Daughters
- 1.2. Entstehungsphase
- 1.3. Produktion
- 1.4. Struktur und Aufbau
- 1.5. Charaktere und Handlungsschauplätze
- 1.6. Themen und Inhalte
- 2. Marienhof
- 2.1. Vorgeschichte: britische Soaps und Lindenstraße
- 2.2. Entstehungsphase
- 2.3. Produktion
- 2.4. Struktur und Aufbau
- 2.5. Charaktere und Handlungsschauplätze
- 2.6. Themen und Inhalte
- 3. Vergleich der Analysen
- IV. Rezeption und Funktionen der ARD-Dailies
- 1. Allgemeine Befunde zur Rezeption von Soap Operas
- 1.1. Wer rezipiert Soaps?
- 1.2. Warum rezipiert jemand Soaps?
- 1.3. Welche Auswirkungen hat die Rezeption von Soaps?
- 1.4. Funktionen der Soap Operas
- 2. Quantitative Nutzungsdaten der ARD-Dailies
- 2.1. Das Publikum der ARD-Dailies
- 2.2. ARD-Soaps: Unterschiede im Publikum
- 2.3. ARD- und RTL-Soaps: Publikumsvergleich
- 3. Motivation der Verbotene Liebe- und Marienhof-Rezipienten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die öffentlich-rechtlichen deutschen Daily Soaps „Verbotene Liebe“ und „Marienhof“ im Vergleich. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Serien hinsichtlich Entstehung, Produktion, Struktur, Inhalten und Rezeption zu analysieren und die Auswirkungen dieser Unterschiede auf die Zuschauerstruktur und -motivation zu beleuchten. Die Studie schließt die Lücke der fehlenden expliziten vergleichenden Analyse dieser beiden im ARD-Vorabendprogramm ausgestrahlten Serien.
- Begriffliche Klärung und historische Einordnung der Seifenoper
- Vergleichende Analyse der Produktion und Struktur von „Verbotene Liebe“ und „Marienhof“
- Untersuchung der Inhalte und Themen beider Serien
- Analyse der Rezeptionsgewohnheiten und -motivationen der Zuschauer
- Zusammenhang zwischen Serienmerkmalen und Zuschauerstruktur
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der deutschen Daily Soaps ein und begründet die Relevanz einer vergleichenden Analyse von „Verbotene Liebe“ und „Marienhof“, die bisher in der Forschung vernachlässigt wurde. Sie verweist auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Genre im internationalen Kontext und betont die Besonderheit der direkten Ausstrahlung beider Serien im ARD-Vorabendprogramm.
II. Die Seifenoper: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Genre "Seifenoper". Es klärt den Begriff, differenziert zwischen verschiedenen Arten von Seifenopern (z.B. "Series" und "Serials", "Daytime" und "Prime-time"), grenzt das Genre von anderen Serienformaten ab und analysiert die typischen Inhalte, Genrecodes und Darstellungsprinzipien. Die historische Entwicklung der Seifenoper, von den Anfängen im Radio bis hin zum deutschen Fernsehen, wird detailliert nachgezeichnet, wobei der Fokus auf der Tradition der Familienserie und der Entwicklung der Daily Soaps in Deutschland liegt.
III. Analyse der ARD-Soaps: Dieses zentrale Kapitel beinhaltet Einzelanalysen von "Verbotene Liebe" und "Marienhof". Für jede Serie werden die Vorgeschichte, die Entstehungsphase, der Produktionsprozess, die Struktur, die Charaktere, die Handlungsschauplätze und die Themen und Inhalte detailliert untersucht. Die verschiedenen Analyse-Kategorien ermöglichen ein umfassendes Bild der jeweiligen Seifenoper und dienen als Grundlage für den anschließenden Vergleich beider Serien, der die Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausarbeitet.
IV. Rezeption und Funktionen der ARD-Dailies: Das Kapitel befasst sich mit der Rezeption der ARD-Daily Soaps. Es gibt zunächst einen Überblick über die allgemeine Forschungslage zur Soap Opera-Rezeption, bevor es das Publikum der ARD-Soaps anhand quantitativer und qualitativer Daten untersucht. Die Analyse zielt darauf ab, die Motivation der Zuschauer zu verstehen und den Zusammenhang zwischen den Merkmalen der Serien und der Zuschauerstruktur zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Deutsche Daily Soaps, Verbotene Liebe, Marienhof, ARD, Seifenoper, Genreanalyse, Rezeptionsforschung, Serienproduktion, Fernsehprogramm, Publikumsanalyse, Vergleichende Analyse, Familienserie, Vorabendprogramm.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der ARD-Soaps "Verbotene Liebe" und "Marienhof"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert vergleichend die beiden deutschen Daily Soaps "Verbotene Liebe" und "Marienhof", die im ARD-Vorabendprogramm ausgestrahlt wurden. Der Fokus liegt auf Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Entstehung, Produktion, Struktur, Inhalten und Rezeption, sowie den Auswirkungen dieser Unterschiede auf die Zuschauerstruktur und -motivation.
Welche Aspekte der Seifenopern werden untersucht?
Die Analyse umfasst eine breite Palette an Aspekten: Begriffliche Klärung und Einordnung des Genres "Seifenoper", historische Entwicklung, Vergleich der Produktionsweisen und Strukturen von "Verbotene Liebe" und "Marienhof", detaillierte Untersuchung der Inhalte und Themen beider Serien, Analyse der Rezeptionsgewohnheiten und -motivationen der Zuschauer, sowie der Zusammenhang zwischen Serienmerkmalen und Zuschauerstruktur.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analysemethode. "Verbotene Liebe" und "Marienhof" werden anhand verschiedener Kategorien (Vorgeschichte, Entstehung, Produktion, Struktur, Charaktere, Handlungsorte, Themen) einzeln untersucht und anschließend miteinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Zusätzlich werden quantitative und qualitative Daten zur Rezeption herangezogen.
Welche konkreten Fragen werden beantwortet?
Die Arbeit beantwortet Fragen wie: Wie unterscheiden sich "Verbotene Liebe" und "Marienhof" in ihrer Entstehung und Produktion? Welche Themen und Inhalte werden in den Serien behandelt? Wer schaut diese Serien? Warum schauen sie diese Serien? Welchen Einfluss haben die Serienmerkmale auf die Zuschauerstruktur und -motivation? Wie lässt sich die Rezeption beider Serien vergleichen?
Welche Lücke schließt diese Arbeit?
Die Arbeit schließt die Lücke der fehlenden expliziten vergleichenden Analyse von "Verbotene Liebe" und "Marienhof". Bisherige Forschung hat diese beiden im ARD-Vorabendprogramm ausgestrahlten Serien oft einzeln oder im Kontext anderer Serien betrachtet, aber nicht direkt miteinander verglichen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur umfassenden Auseinandersetzung mit dem Genre "Seifenoper", ein Kapitel zur vergleichenden Analyse der ARD-Soaps "Verbotene Liebe" und "Marienhof", sowie ein abschließendes Kapitel zur Rezeption und den Funktionen der ARD-Dailies.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Deutsche Daily Soaps, Verbotene Liebe, Marienhof, ARD, Seifenoper, Genreanalyse, Rezeptionsforschung, Serienproduktion, Fernsehprogramm, Publikumsanalyse, Vergleichende Analyse, Familienserie, Vorabendprogramm.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten, die sich mit dem Genre der Seifenopern, der deutschen Fernsehgeschichte, Medienrezeption und vergleichender Medienanalyse beschäftigen.
- Quote paper
- M. A. Nikola Weiß (Author), 2003, Deutsche Daily Soaps - Eine vergleichende Analyse der ARD-Serien Verbotene Liebe und Marienhof, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15270