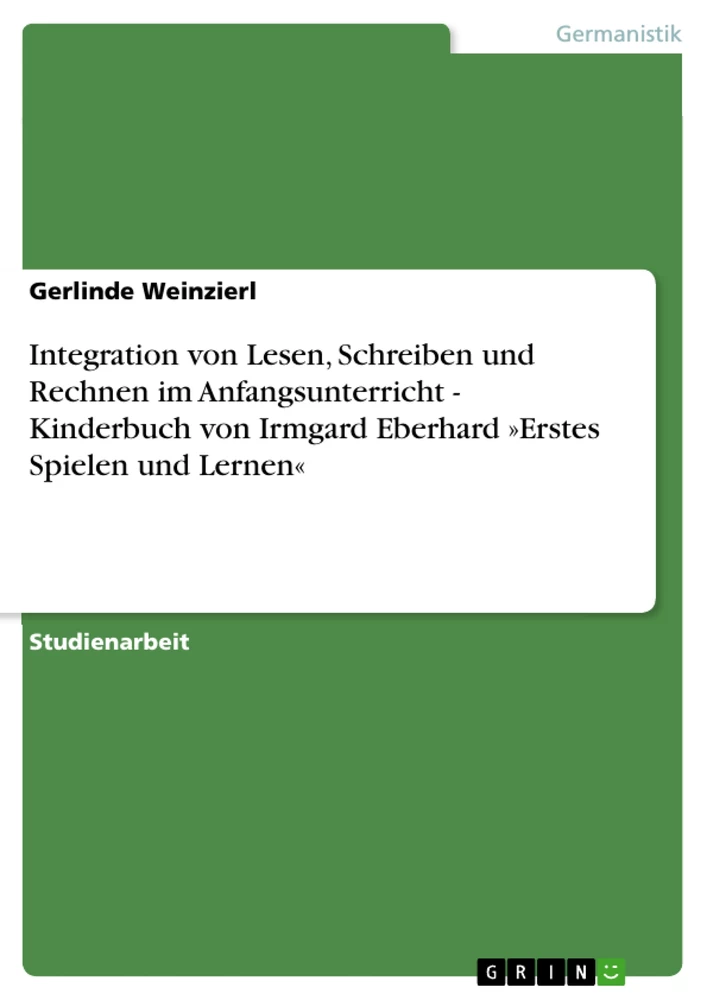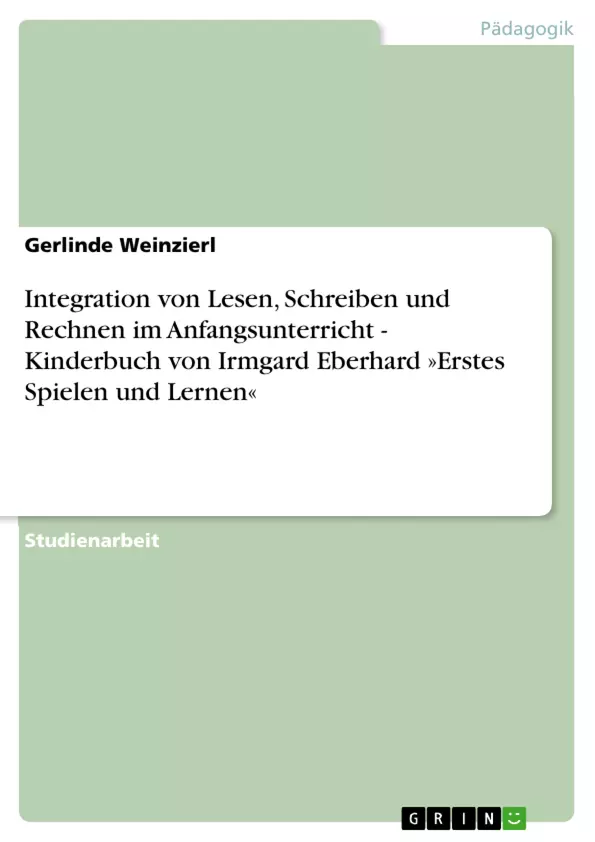Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde
Für den Lehrer der ersten Klasse, dem es vor allem aufgegeben ist, den Schülern einen Begriff von den ersten natürlichen Zahlen zu vermitteln, muß es von großem Interesse sein, auf welche Voraussetzungen er sich bei dieser Aufgabe stützen kann. Gehört es doch zu den zentralen didaktischen Prinzipien, daß der Unterricht an das Vorwissen und die Vorerfahrungen der Schüler anzuknüpfen und diese in das Neuerkannte zu integrieren habe.
Kinder fangen spätestens ab dem 3. Lebensjahr an, mit Quantitäten umzugehen; sie hören Zahlwörter und beginnen, sie auch selbst zu verwenden. Was wissen wir also über die Vorerfahrungen von Schulanfängern mit Zahlen und über die Entwicklung ihres Zahlverständnisses? Diese Frage läßt sich eigentlich nur individuell, für jeden einzelnen Schüler gesondert, beantworten. Jedoch liefern kollektive Untersuchungen und Befunde zur Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kind, wie sie nachfolgend referiert
werden, zum einen Ideen für geeignete, auch systematische Beobachtungen und zum anderen Rahmeninformationen über die im Einzelfall zu erwartenden Ergebnisse. Jedenfalls sind sie
geeignet, Problembewußtsein zu wecken und die Wahrnehmung zu schärfen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde
- 1.1 Piagets Untersuchungen zur Entwicklung des Zahlbegriffs
- 1.2 Zum Begriff der Invarianz
- 1.3 Fehlende Invarianz
- 1.4 Von der Varianz zur Invarianz
- 1.5 Invarianz der Ordnung: Versuchssituationen
- 1.6 Invarianz der Ordnung: Ergebnisse
- 1.7 Ordnung und Anzahl (Ordination und Kardination)
- 1.8 Zu Piagets Erklärungshypothesen
- 1.8.1 Operation
- 1.8.2 Entwicklungsstadien
- 2. Die Zahlen und das Zählen
- 2.1 Das Zählen
- 2.2 Die Rolle der Sprache
- 2.3 Die Symbolsprache der Mathematik
- 2.4 Wie lernen Kinder?
- 2.5 Erkunden des Vorwissens
- 2.6 Die Diskussion
- 2.7 Kreativität und Problemlösen
- 2.8 Was wir Lehrer tun können
- 3. Paradigmenwechsel
- 3.1 Detailerfindungen der Lautanalyse
- 3.2 Reformpädagogik
- 3.3 Ganzheitsmethode - Synthetische Methode
- 3.4 Vom Lesen- zum Schreibenlernen
- 3.5 Das Fehlervermeidungsprinzip
- 4.1 Schrifspracherwerb heute: Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs (v. R. L.)
- 4.2 Ausgangsschriften
- 5. Erstes Spielen und Lernen – Irmgard Eberhard (Gruppenarbeit)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Integration von Lesen, Schreiben und Rechnen im Anfangsunterricht. Sie analysiert das Kinderbuch "Erstes Spielen und Lernen" von Irmgard Eberhard und setzt dieses im Kontext der Entwicklung des Zahlbegriffs und des Schrifspracherwerbs bei Kindern ein.
- Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kind
- Piagets Untersuchungen zur Invarianz der Quantität
- Der Zusammenhang zwischen Sprache und mathematischem Denken
- Paradigmenwechsel im Lese- und Schrifterwerb
- Didaktische Ansätze für den integrativen sprachlichen Anfangsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kind anhand der Studien von Jean Piaget. Es wird die Bedeutung der Invarianz der Quantität für den Aufbau des Zahlverständnisses erläutert und anhand von Versuchen die Schwierigkeiten jüngerer Kinder im Erfassen dieser Invarianz aufgezeigt.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle von Sprache und Symbolen im mathematischen Denken. Die Bedeutung des Zählens und die Herausforderungen des mathematischen Symbolverständnisses für Kinder werden diskutiert.
Das dritte Kapitel behandelt den Paradigmenwechsel im Lese- und Schrifterwerb. Die Entwicklung von Lautanalysemethoden, die Bedeutung der Reformpädagogik und die Entwicklung von ganzheitlichen Lernansätzen werden vorgestellt.
Schlüsselwörter
Zahlbegriff, Invarianz, Quantität, Piaget, Sprache, Zählen, Mathematik, Symbolsprache, Schrifspracherwerb, Lautanalyse, Reformpädagogik, Ganzheitliche Methode, Lesen, Schreiben, Integrierter Anfangsunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Jean Piaget in der Entwicklung des Zahlbegriffs?
Piaget untersuchte maßgeblich, wie Kinder die Invarianz der Quantität verstehen, was eine Grundvoraussetzung für den Aufbau eines stabilen Zahlverständnisses ist.
Was versteht man unter „Invarianz der Quantität“?
Es ist die Erkenntnis, dass sich die Menge eines Objekts nicht ändert, nur weil sich seine äußere Form oder Anordnung verändert.
Wie hängen Sprache und mathematisches Denken zusammen?
Sprache ist das Medium, über das Kinder Zahlwörter lernen und mathematische Symbole verstehen, was für die Entwicklung des abstrakten Denkens essenziell ist.
Was ist das Ziel des Buches „Erstes Spielen und Lernen“ von Irmgard Eberhard?
Das Buch dient als pädagogisches Werkzeug, um Lesen, Schreiben und Rechnen im Anfangsunterricht integrativ und spielerisch zu vermitteln.
Welche Paradigmenwechsel gab es im Schriftspracherwerb?
Der Unterricht wandelte sich von rein synthetischen Methoden hin zu ganzheitlichen Ansätzen und der Erkenntnis, dass Lesen- und Schreibenlernen eng miteinander verknüpft sind.
Ab welchem Alter beginnen Kinder mit Zahlen umzugehen?
Spätestens ab dem 3. Lebensjahr fangen Kinder an, Zahlwörter zu verwenden und erste Erfahrungen mit Quantitäten zu sammeln.
- Quote paper
- Gerlinde Weinzierl (Author), 2001, Integration von Lesen, Schreiben und Rechnen im Anfangsunterricht - Kinderbuch von Irmgard Eberhard »Erstes Spielen und Lernen«, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1511