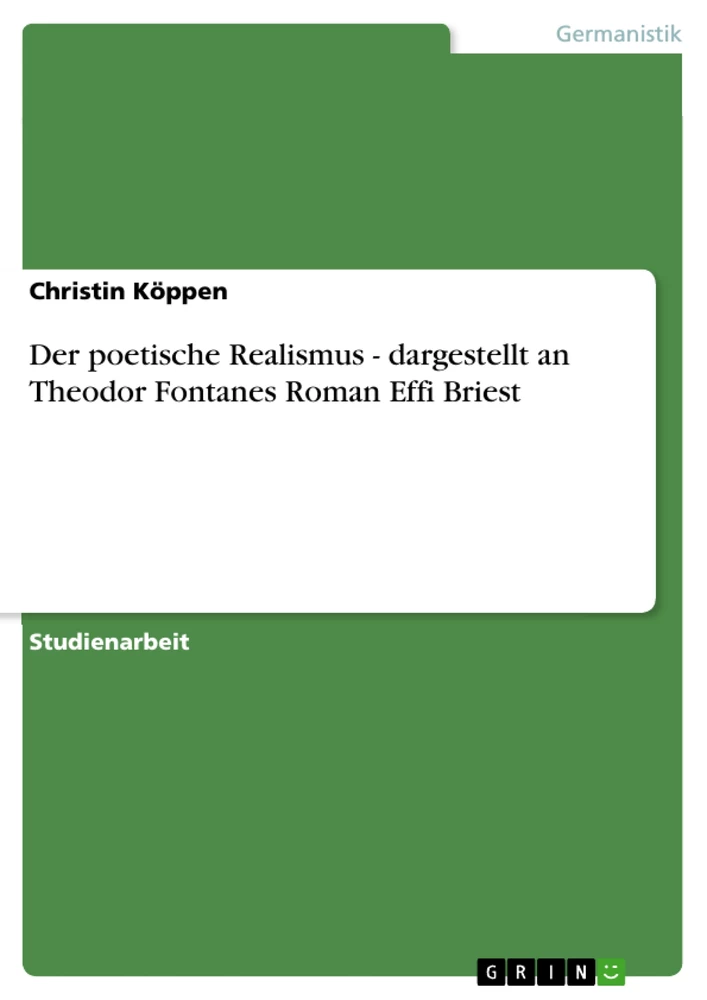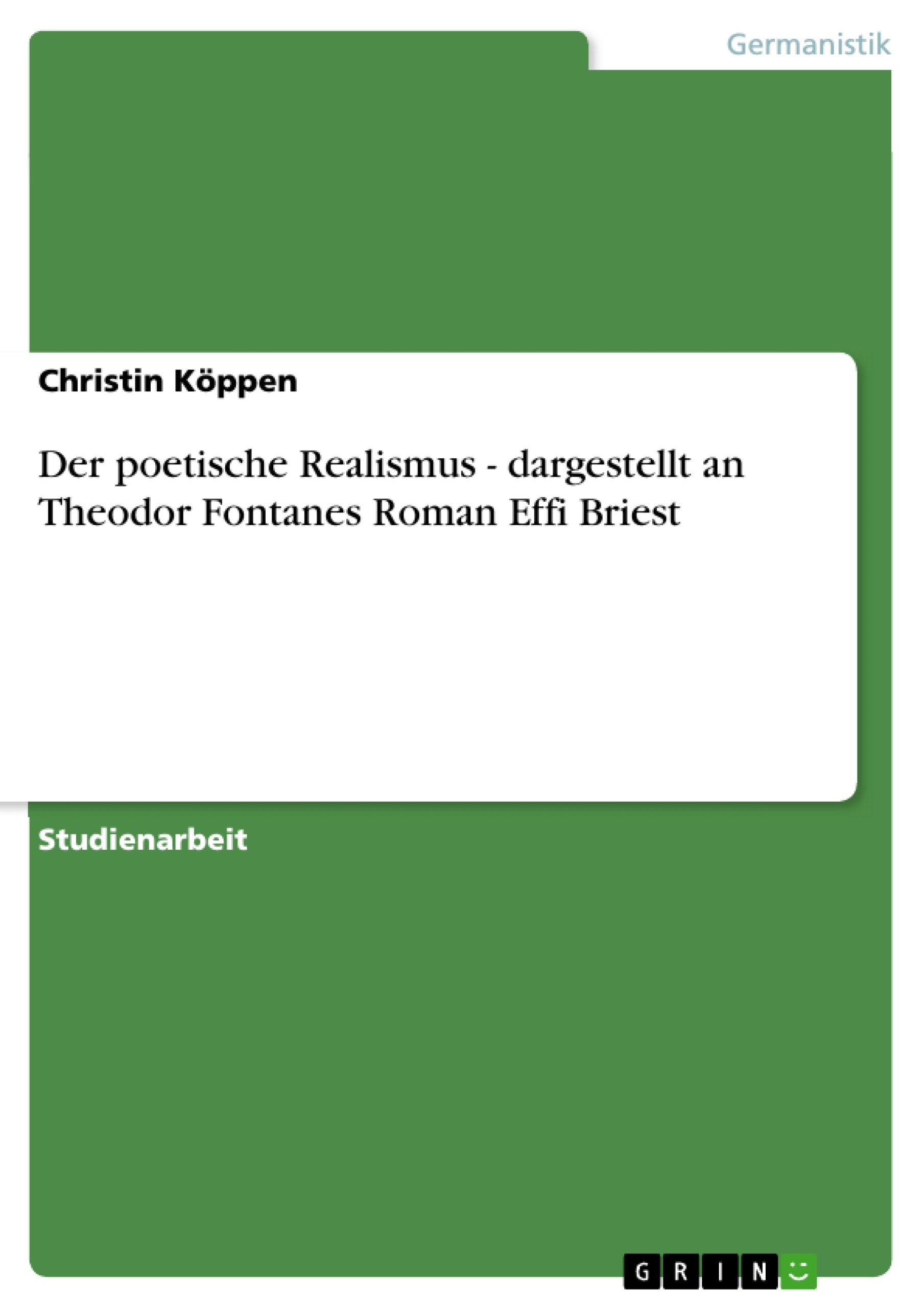Der poetische Realismus wurde für Zeitgenossen in Deutschland 1855 durch Gustav Freytags Roman „Soll und Haben“ eingeleitet. Historisch gesehen war in Deutschland gerade erst die Revolution von 1848 gescheitert, weil die unterschiedlichen Ziele der verschiedenen politischen Gruppen eine erfolgreiche Zusammenarbeit unmöglich machten. „Beides, die Enttäuschung über das machtpolitische Unvermögen der Nationalversammlung und die Furcht vor dem Chaos, führten dazu, daß man den wiederhergestellten Deutschen Bund hinnahm, wenn nicht billigte.“ Beim Bürgertum führten diese Ereignisse zu einer Abkehrung von der Politik und auch die Schriftsteller des poetischen Realismus rückten politische Fragen in den Hintergrund. Erst mit der Gründung des zweiten Deutschen Kaiserreiches 1871 war die Tagespolitik wieder ein Thema für die Autoren. Wirtschaftlich war Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Industrialisierung geprägt. Dies führte zum einen zur Herausbildung eines neuen „Großbürgertum[s] aus ‚königlichen’ Kaufleuten und Industriemagnaten“ und zum anderen aber auch zu einer rasch steigenden Zahl an Arbeitern, die oft unter schlechten Bedingungen leben mussten.
Die Literatur dieser Zeit, der poetische Realismus, soll Thema dieser Arbeit sein. Den Anfang macht eine Darstellung der theoretischen Aspekte dieser literarischen Epoche anhand des Aufsatzes „Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848“ von Theodor Fontane, der als führender Vertreter des poetischen Realismus gilt. Anschließend werden die favorisierten Themen des Realismus vorgestellt, mit Hilfe von Beispielen aus Theodor Fontanes bekanntestem Roman „Effi Briest“ (1895). Abschließend gilt es, ebenfalls anhand von „Effi Briest“, ein ausgesuchtes Stilmittel, das der Poetisierung des Textes dient, zu analysieren. In diesem Fall handelt es sich um das Symbol der Schaukel, das in drei wichtigen Momenten im Roman zum Tragen kommt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der theoretische Hintergrund des poetischen Realismus
- Die Themen des poetischen Realismus
- Das Symbol als Stilmittel zur Poetisierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den poetischen Realismus am Beispiel von Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“. Die Zielsetzung besteht darin, den theoretischen Hintergrund dieser literarischen Epoche zu beleuchten und die zentralen Themen anhand von Fontanes Werk zu analysieren. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die stilistischen Mittel der Poetisierung gelegt.
- Der theoretische Hintergrund des poetischen Realismus und Fontanes Beitrag dazu.
- Die bevorzugten Themen des poetischen Realismus, insbesondere die Darstellung von Ehe und Familie.
- Die Rolle der Frau in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts im Kontext des Romans.
- Die Verwendung von Symbolen als stilistisches Mittel zur Poetisierung der Wirklichkeit.
- Der Vergleich mit anderen Werken des europäischen Realismus.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des poetischen Realismus ein und beschreibt den historischen Kontext der Epoche nach der gescheiterten Revolution von 1848. Sie betont die Abwendung von politischen Fragen im Bürgertum und in der Literatur und skizziert die wirtschaftlichen Veränderungen durch die Industrialisierung. Die Arbeit konzentriert sich auf die theoretischen Aspekte des poetischen Realismus anhand von Fontanes Aufsatz „Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848“ und analysiert die bevorzugten Themen und Stilmittel am Beispiel von „Effi Briest“, insbesondere das Symbol der Schaukel.
Der theoretische Hintergrund des poetischen Realismus: Dieses Kapitel beleuchtet die Definition und Abgrenzung des poetischen Realismus gegenüber anderen Epochen. Es analysiert Fontanes Aufsatz „Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848“, in dem er den Realismus als „Wiederspiegelung alles wirklichen Lebens“ definiert, aber gleichzeitig eine Abgrenzung von einer bloßen Abbildung der Realität betont. Die Poetisierung der Wirklichkeit durch Stilmittel wie Verklärung, Humor und Symbole wird hervorgehoben. Der Roman als führende Gattung dieser Epoche und die Veränderung des Sprachgebrauchs sowie des auktorialen Erzählers werden ebenfalls diskutiert.
Die Themen des poetischen Realismus: Dieses Kapitel befasst sich mit den bevorzugten Themen des poetischen Realismus, die sich im Wesentlichen auf das Private konzentrieren, wie Heimat, Ehe und Familie. Es wird die Abwendung von sozialen und politischen Problemen betont und die Konzentration auf die Oberschicht, insbesondere in Fontanes Werk, erläutert. Der Vergleich mit europäischen Werken wie „Madame Bovary“ und „Anna Karenina“ hebt die europaweite Relevanz der Themen Frau und Ehe hervor, wobei die eingeschränkten Möglichkeiten der Frau in der patriarchalischen Gesellschaft beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Poetischer Realismus, Theodor Fontane, Effi Briest, Realismusdefinition, Ehe, Familie, Frau, Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Symbol, Poetisierung, Industrialisierung, Roman.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Poetischen Realismus in Fontanes "Effi Briest"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den poetischen Realismus am Beispiel von Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“. Sie beleuchtet den theoretischen Hintergrund dieser literarischen Epoche und untersucht die zentralen Themen anhand von Fontanes Werk. Besonderes Augenmerk liegt auf den stilistischen Mitteln der Poetisierung.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt den theoretischen Hintergrund des poetischen Realismus und Fontanes Beitrag dazu, die bevorzugten Themen (insbesondere Ehe und Familie), die Rolle der Frau im 19. Jahrhundert, die Verwendung von Symbolen als stilistisches Mittel und einen Vergleich mit anderen Werken des europäischen Realismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum theoretischen Hintergrund des poetischen Realismus, ein Kapitel zu den Themen des poetischen Realismus und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext und konzentriert sich auf Fontanes Aufsatz "Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848". Die weiteren Kapitel analysieren die Definition und Abgrenzung des poetischen Realismus, seine bevorzugten Themen (mit Fokus auf Ehe und Familie in der Oberschicht) und den Vergleich mit europäischen Werken wie "Madame Bovary" und "Anna Karenina".
Welche Rolle spielt das Symbol in der Analyse?
Die Arbeit untersucht die Verwendung von Symbolen als stilistisches Mittel zur Poetisierung der Wirklichkeit. Das Symbol der Schaukel in "Effi Briest" wird als Beispiel genannt.
Wie wird der poetische Realismus definiert und abgegrenzt?
Der poetische Realismus wird anhand von Fontanes Definition als "Wiederspiegelung alles wirklichen Lebens" beschrieben, wobei gleichzeitig eine Abgrenzung von einer bloßen Abbildung der Realität betont wird. Die Poetisierung der Wirklichkeit durch Stilmittel wie Verklärung, Humor und Symbole wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Poetischer Realismus, Theodor Fontane, Effi Briest, Realismusdefinition, Ehe, Familie, Frau, Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Symbol, Poetisierung, Industrialisierung, Roman.
Wie wird der historische Kontext berücksichtigt?
Die Einleitung führt in den historischen Kontext der Epoche nach der gescheiterten Revolution von 1848 ein. Sie betont die Abwendung von politischen Fragen im Bürgertum und in der Literatur und skizziert die wirtschaftlichen Veränderungen durch die Industrialisierung.
Welche Bedeutung hat Fontanes Aufsatz "Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848"?
Fontanes Aufsatz ist zentral für die Analyse des theoretischen Hintergrunds des poetischen Realismus. Er dient als Grundlage für die Definition und Abgrenzung dieser Epoche.
- Quote paper
- Christin Köppen (Author), 2008, Der poetische Realismus - dargestellt an Theodor Fontanes Roman Effi Briest, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150779