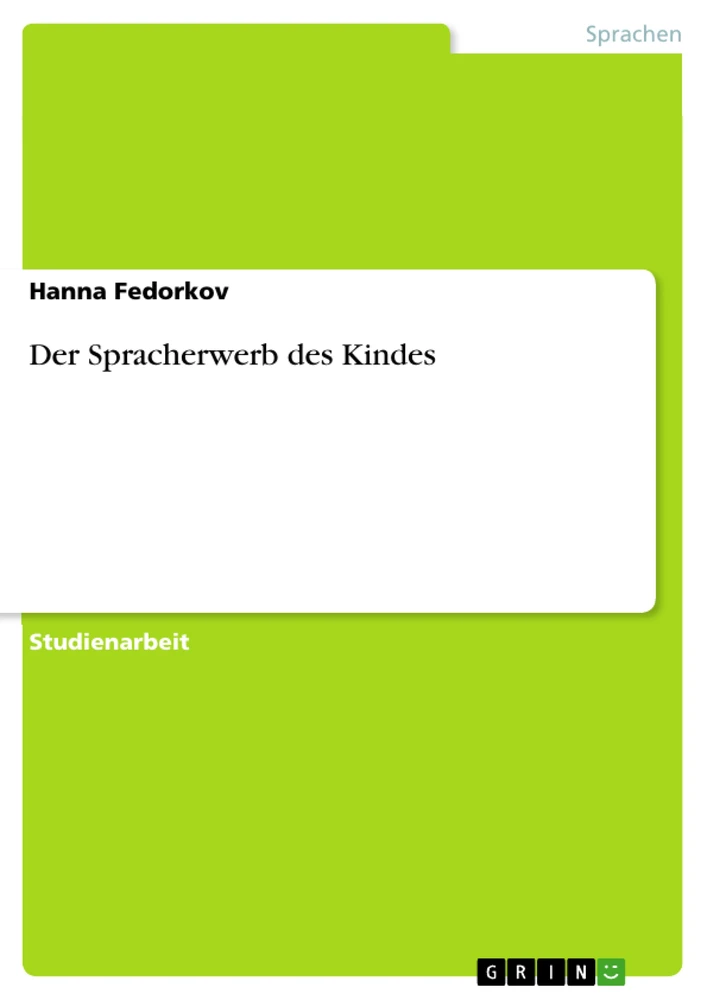Zwei dreijährige Kinder namens Tom und Amy befinden sich im Wohnzimmer und spielen
gemeinsam mit ihrem Spielzeugpferdchen und einem kleinen Holzwagen. Im Hintergrund läuft
der Fernseher und die Mutter bereitet in der Küche das Abendessen vor. Amy steckt eine Figur in
die Kutsche und ruft: „Auf geht’s zum Supermarkt!“, Tom sagt: „Papa kommt auch mit!“ und
setzt eine zweite Figur in den Wagen. Anschließend bewegt Amy das Pferdchen und zieht die
Kutsche im Pferdegalopp zum Supermarkt während sie die Szene mit Klip-Klop Lauten
untermalt. Plötzlich ruft Tom: „Nein, sie sind noch nicht fertig, sie haben ihre Kinder zu Hause
vergessen. O nein! Sie weinen ja!“ Und er setzt die beiden anderen Figuren in den Wagen. Amy
nimmt einen Holzklotz und legt ihn zu den Figuren in den Wagen und sagt: „Das ist ihr Essen!“.
Dann zieht er das Pferdchen mit dem Wagen in Richtung Supermarkt, während er die Geräusche
eines gallopierenden Pferdes nachahmt, so wie es zuvor Amy getan hat.[...]
Welche kognitiven Prozesse haben sich bei Amy und Tom vollzogen, um eine Fahrt zum
Supermarkt zu planen und welche sprachliche Entwicklung hat stattgefunden, um
miteinander auf diese Weise zu kommunizieren?
• In welchem Stadium erwerben Kinder die Wörter für die Objekte, die sie zum Spielen
verwendet haben?
• Woher wissen beide Kinder von den Kategorien wie Pferde, Wagen und Leute? Wann
erwerben Kinder die Fähigkeit Begriffe wie Vater, Kinder oder Pferd in bestimmte
Kategorien zu ordnen?
• Ist das Gehirn bereits „vorprogrammiert“ für den Spracherwerb oder haben die Kinder die
Sprache durch ihre Umwelt erworben?
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- SPRACHE UND KOGNITION
- FORSCHUNGSANSÄTZE
- ÜBER DAS VERHÄLTNIS UND DIE ENTWICKLUNG VON SPRACHE UND DENKEN
- Piaget
- Wygotski
- Diskussion
- DER SPRACHERWERB DES KINDES
- ERSTSPRACHERWERB
- KOMPONENTEN DER SPRACHE
- DER PROZESS DES SPRACHERWERBS
- Frühe Sprachwahrnehmung
- Der Erwerb der Sprachlaute
- Der Bedeutungserwerb
- Ein- Zwei- und Mehrwortäußerungen
- THEORIEN DES SPRACHERWERBS
- DER BEHAVIORISTISCHE ANSATZ
- DER KOGNITIVE ANSATZ
- DER NATIVISTISCHE ANSATZ
- EIN MÖGLICHER KOMPROMISS
- SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der komplexen Beziehung zwischen Sprache und Denken, insbesondere im Kontext der kindlichen Entwicklung. Sie erkundet die wichtigsten Theorien und Forschungsansätze, die diese Verbindung beleuchten, sowie die Frage, wie Sprache die kognitiven Prozesse beeinflusst und umgekehrt.
- Das Verhältnis von Sprache und Denken
- Die Rolle der Sprache in der kognitiven Entwicklung
- Die wichtigsten Theorien des Spracherwerbs
- Die Bedeutung der Interaktion für den Spracherwerb
- Die Entwicklung von Sprache und Denken im frühen Kindesalter
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik des Buches anhand eines Beispiels aus dem Alltag zweier dreijähriger Kinder vor. Sie illustriert, wie Sprache und Denken in komplexer Weise miteinander verwoben sind und welche Fragen sich aus dieser Interaktion ergeben.
- Sprache und Kognition: Dieses Kapitel beleuchtet die enge Beziehung zwischen Sprache und Denken und diskutiert die verschiedenen Forschungsansätze, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Dabei werden die Standpunkte von Bühler und Stern/Stern_ sowie die Theorien Piagets und der Schule Wygotskis im Detail vorgestellt.
- Der Spracherwerb des Kindes: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Erwerb der Muttersprache im frühen Kindesalter. Es behandelt die wichtigsten Komponenten der Sprache und den Prozess des Spracherwerbs, der von der frühen Sprachwahrnehmung bis hin zu Ein- Zwei- und Mehrwortäußerungen reicht.
- Theorien des Spracherwerbs: Dieses Kapitel präsentiert die wichtigsten Theorien, die sich mit dem Spracherwerb befassen. Der behavioristische Ansatz, der kognitive Ansatz und der nativistische Ansatz werden vorgestellt und diskutiert. Darüber hinaus wird ein möglicher Kompromiss zwischen den verschiedenen Ansätzen erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind Sprache, Denken, Spracherwerb, Kognition, Entwicklungspsychologie, Piaget, Wygotski, Behaviorismus, Kognitivismus, Nativismus.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Sprache und Denken zusammen?
Die Arbeit untersucht, wie kognitive Prozesse die Sprache beeinflussen und umgekehrt, wobei Theorien von Piaget und Wygotski gegenübergestellt werden.
Was ist der nativistische Ansatz des Spracherwerbs?
Dieser Ansatz geht davon aus, dass das menschliche Gehirn biologisch für den Spracherwerb "vorprogrammiert" ist (z.B. nach Noam Chomsky).
Welche Rolle spielt die Umwelt laut dem Behaviorismus?
Der behavioristische Ansatz besagt, dass Kinder Sprache primär durch Nachahmung und Verstärkung aus ihrer sozialen Umwelt lernen.
Wann beginnen Kinder, Begriffe in Kategorien zu ordnen?
Die Arbeit erläutert den Bedeutungserwerb und zeigt auf, in welchen Entwicklungsstadien Kinder lernen, Objekte wie "Pferde" oder "Wagen" gedanklich zu gruppieren.
Was ist der Unterschied zwischen Einwort- und Mehrwortäußerungen?
Dies sind Stufen des Erstspracherwerbs, bei denen das Kind zunächst einzelne Wörter als ganze Sätze nutzt, bevor es beginnt, Wörter grammatikalisch zu verknüpfen.
- Arbeit zitieren
- Hanna Fedorkov (Autor:in), 2008, Der Spracherwerb des Kindes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150453