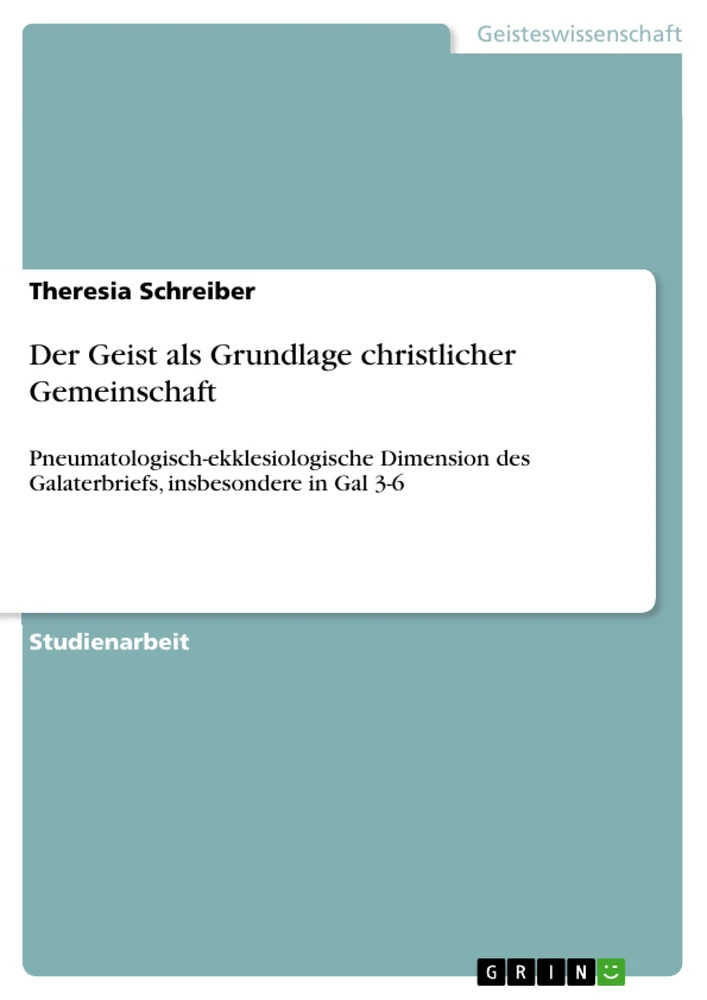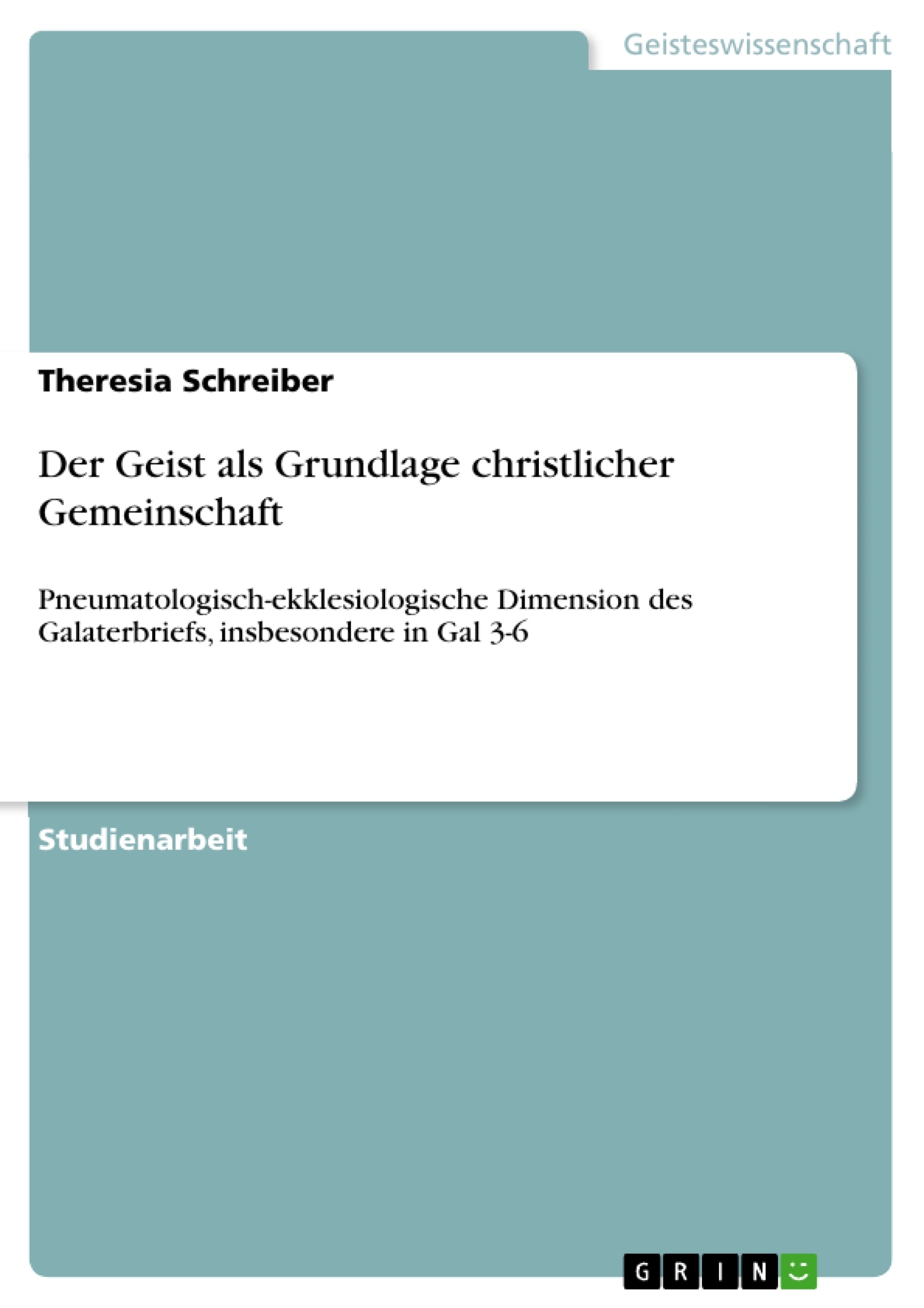Der Galaterbrief gehört zu den echten Paulusbriefen. Er beginnt als apologetischer Brief mit Blickpunkt auf die in Galatien lehrenden Gegner des Paulus. Gegen diese predigt er die Freiheit der Christen vom mosaischen Gesetz und der Beschneidung und endet mit paränetischen Ausführungen. Ein Motiv zieht sich dabei durch den ganzen Brief: der Geist, das πνευμα. Die Rede vom πνευμα verbindet deutlich die als echt anerkannten Paulusbriefe. Im Römerbrief, in beiden Korintherbriefen, im Galaterbrief: für all diese weist die Konkordanz zum Novum Testamentum Graece eine erheblich höhere Zahl von Belegen auf als in den Pastoralbriefen. Die Einbeziehung des πνευμα in seine Theologie war für Paulus also anscheinend ein zentraler Punkt. Paulus’ Sprechen vom πνευμα wurde bereits auf die verschiedensten Aspekte hin untersucht. Für diese Arbeit möchte ich den Blick auf die Bedeutung des πνευμα als Grundlage für die paulinische Ekklesiologie im Galaterbrief lenken.
Als Hauptthema des Briefes wird häufig die Kampfansage gegen das jüdische Gesetz genannt. Zu dieser These scheint der paränetische Schlusspassus allerdings nicht ganz zu passen und so müssen die Vertreter dieser Kernthematik Argumente suchen, die seine Zugehö-rigkeit doch plausibel machen. Andere Forscher versuchen, den Galaterbrief als Rede zu klassifizieren oder ihm das Grundthema der Identität und des Verhaltens der Heidenchristen zugrunde zu legen. Bisher ist keine dieser Thesen zur Kernthematik des Galaterbriefes den anderen so überlegen, dass sie ein weiteres Nachdenken in dieser Richtung ausschließen würde.
Bei der Beschäftigung mit dem Galaterbrief kam mir der Gedanke, dass ihm ein anderes Grundthema zugrunde liegen könnte: Der Zusammenhang von Geist und Gemeinde. Die christliche Gemeinde – ihr Entstehen, ihre Hoffnung, ihre Gefährdung, ihr Zusammenhalt – wird aus dem Geist heraus begründet und vorgestellt. Der rechte Weg der Gemeinde ist es, der von Paulus thematisiert wird – beginnend mit der Gabe des göttlichen Geistes. Durch diesen Geistempfang werden die Einzelnen Teil einer christlichen Gemeinschaft, deren Zusammenleben als zweiter Schritt von Paulus thematisiert wird. Schließlich nimmt Paulus die gemeinsame Hoffnung der Gemeinde auf das Heil Gottes in den Blick – alles unter der Voraussetzung des Geistempfangs und des Handelns im Geist.
Das vom Geist bestimmte Wesen der Gemeinde darzustellen, kann meiner Meinung nach als theologisches Grundthema des Galaterbriefs angesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Begriffsklärungen
- 1.1 Paulus' Auffassung von „Gemeinde“
- 1.2 „лvεvμα“ bei Paulus und im Galaterbrief
- 2. Die Herkunft des Geistes (Gal 3,2-5; 4,6)
- 3. Glaube vs. Gesetz - Rechtfertigung aus dem Geist (Gal 1,6-5,12)
- 4. Wirkungen des Geistes
- 4.1 Verhältnis der Christen zu Gott und untereinander (Gal 3,14-4,7)
- 4.1.1 Gotteskindschaft (Gal 4,6)
- 4.1.2 Neue Gleichheit aller im Glauben (Gal 3,27-29)
- 4.1.3 Erbteil am zukünftigen Heil (Gal 3,29;4,7)
- 4.2 Der Geist als Voraussetzung eines neuen Zusammenlebens (Gal 5,13-6,10)
- 4.2.1 Gebot der Nächstenliebe
- 4.2.2 Tugend und Laster
- 4.2.3 Ethische Imperative (Gal 5,25-6,6)
- 4.2.4 Ausblick: Eschatologische Verheißung (Gal 6,7-10)
- 4.1 Verhältnis der Christen zu Gott und untereinander (Gal 3,14-4,7)
- 5. Der Briefschluss - Gemeinde als kaшvý кtíσıç (Gal 6,10-16)
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Galaterbrief mit dem Ziel, die Bedeutung des „лvεvμα“ als Grundlage für die paulinische Ekklesiologie im Galaterbrief aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf der christlichen Gemeinde – ihrer Entstehung, Hoffnung, Gefährdung und ihrem Zusammenhalt – und wie diese aus dem Geist heraus begründet und vorgestellt wird.
- Die Bedeutung des „лvεvμα“ für die Entstehung und das Wesen der Gemeinde
- Der Geist als Grundlage für das Zusammenleben der Christen
- Die Rolle des Geistes in der Rechtfertigung und Heiligung der Gemeinde
- Der Geist als Quelle der Hoffnung und des Heils der Gemeinde
- Die Bedeutung des Geistes für das Handeln der Gemeindemitglieder
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Der Galaterbrief wird als apologetischer Brief vorgestellt, der die Freiheit der Christen vom mosaischen Gesetz und der Beschneidung thematisiert. Der Geist spielt eine zentrale Rolle im gesamten Brief und wird als Grundlage der christlichen Gemeinschaft betrachtet.
- 1. Begriffsklärungen: Das Kapitel definiert die Gemeinde als Versammlung der Getauften und beleuchtet die Bedeutung des Wortes „лvεvμα“ bei Paulus. Dabei wird deutlich, dass die Gemeinde als eine Einheit im Geist Gottes betrachtet wird.
- 2. Die Herkunft des Geistes: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Gabe des Heiligen Geistes, die den Gläubigen durch den Glauben an Christus zuteil wird. Die Gotteskindschaft, die neue Gleichheit aller im Glauben und die Hoffnung auf das zukünftige Heil werden als Früchte des Geistempfangs hervorgehoben.
- 3. Glaube vs. Gesetz: Hier wird die Rechtfertigung durch den Glauben als Grundlage für das neue Zusammenleben der Christen dargestellt. Die Freiheit vom Gesetz und die Einheit im Geist stehen im Vordergrund.
- 4. Wirkungen des Geistes: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Geistes auf das Leben der Gemeinde. Die Nächstenliebe, die Entwicklung von Tugenden und das ethische Handeln der Christen werden als Früchte des Geistes beschrieben.
- 5. Der Briefschluss - Gemeinde als kaшvý кtíσıç: Das Kapitel beschäftigt sich mit dem Schluss des Galaterbriefes, der die Gemeinde als neue Schöpfung im Geist Gottes darstellt. Die Einheit der Gemeinde und die Hoffnung auf das Heil werden im Licht dieser Vorstellung erhellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen des Galaterbriefes sind: „лvεvμα“, Gemeinde, Rechtfertigung, Glaube, Gesetz, Gotteskindschaft, Heiligung, Nächstenliebe, Tugend, Laster, Einheit, neue Schöpfung und eschatologische Hoffnung. Diese Schlüsselwörter spiegeln den Fokus des Briefes auf die christliche Gemeinschaft und deren Beziehung zu Gott, dem Gesetz und einander wider.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Galaterbriefes laut dieser Arbeit?
Das theologische Grundthema ist der Zusammenhang von Geist (pneuma) und Gemeinde als Grundlage der christlichen Gemeinschaft.
Was bedeutet "pneuma" bei Paulus?
Pneuma bezeichnet den göttlichen Geist, der den Gläubigen durch den Glauben zuteil wird und als verbindendes Element der Gemeinde fungiert.
Wie wirkt der Geist auf das Zusammenleben der Christen?
Der Geist ist die Voraussetzung für Nächstenliebe, ethisches Handeln und eine neue Gleichheit aller Gläubigen, jenseits von gesetzlichen Vorschriften.
Was versteht Paulus unter "Rechtfertigung aus dem Geist"?
Es beschreibt die Befreiung vom mosaischen Gesetz und die Annahme vor Gott allein durch den Glauben und das Wirken des Heiligen Geistes.
Was meint der Begriff "kaine ktisis" am Briefschluss?
Er bedeutet "neue Schöpfung" und beschreibt die christliche Gemeinde als eine durch den Geist völlig neu gestaltete Realität.
- Citation du texte
- Theresia Schreiber (Auteur), 2008, Der Geist als Grundlage christlicher Gemeinschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150361