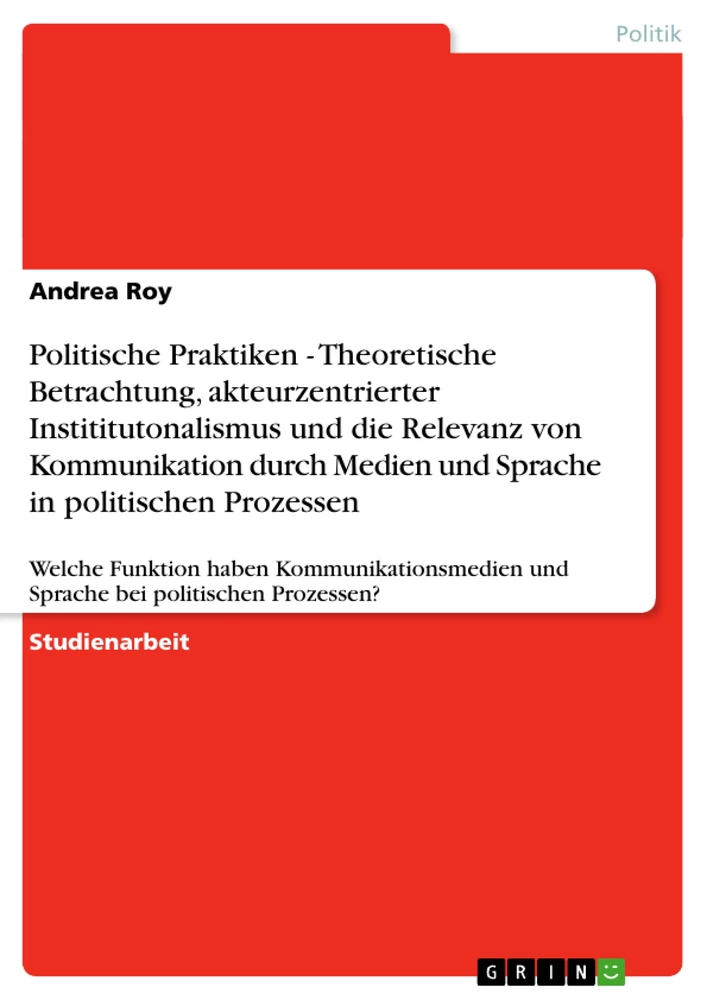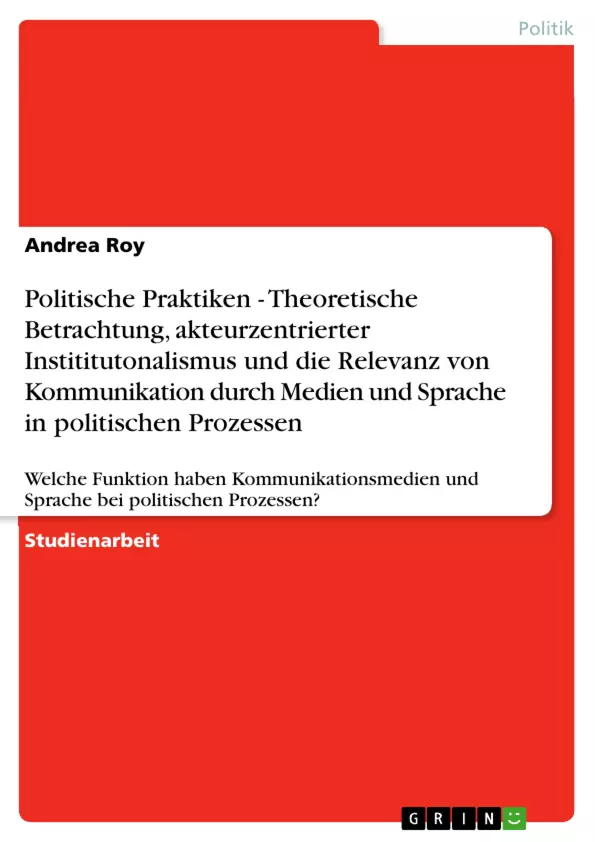Die Präsenz von Politikern und Parteien sind in den Printmedien, im Radio und im Fernsehen für die Öffentlichkeit zu festen Bestandteilen geworden. Neben Nachrichtensendungen, die über diverse politische Handlungen beziehungsweise Interaktionen, Entwicklungen und Entscheidungen, Parteiprogrammatiken oder auch über Skandale berichten und die politischen Akteure desweilen neben deren funktionalen öffentlichen Person ebenfalls als Privatperson präsentieren, inszenieren sich Politiker in politisch ausgerichteten Talkshows vielfach selbst.
Auf diese Weise erhält das Publikum einen scheinbaren Eindruck über die Person des Politikers und über die Ideologien der jeweiligen Partei, für die diese Person steht.
Die mediale Beeinflussung der potenziellen Wähler ist extrem groß. Durch zielgruppengerechte Formate wie auch aufgrund der gelockerten Parteibindungen können durch Medieninszenierungen Wähler positiv oder negativ beeinflusst werden.
Durch das medial kreierte Bild wird versucht eine angebliche Transparenz für die Öffentlichkeit zu wahren. Öffentliche Diskurse werden zu bestimmten Thematiken und Problemfeldern geführt und letztendlich erfolgt die Entscheidungsfindung, im Sinne des Kollektives, nämlich der Bevölkerung. Unklar bleibt dennoch der Aspekt, wie relevante, verbindliche Entscheidungen wirklich getroffen werden, vor allem, da politische Entscheidungen gelegentlich konträr zu den angekündigten Zielen stehen. Wie funktioniert Politik wirklich? Welches sind Praktiken und Taktiken, die herangezogen werden, um politisches Interesse durchzusetzen und verbindliche Entscheidungen zu treffen? Wozu dienen die Bilder und Informationen der Medien? Welche Funktion hat Sprache oder nonverbale Kommunikation?
Die Arbeit „Politische Praktiken – Theoretische Betrachtung, akteurzentrierter Institutionalismus und die Relevanz von Kommunikation durch Medien und Sprache in politischen Entscheidungsprozessen“ geht in diesem Sinne der Frage nach: „Welchen Funktion haben Kommunikationsmedien und Sprache bei politischen Prozessen?“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I: Theoretische Betrachtungen
- I. Mikropolitik - Thematische Eingrenzung des Feldes
- II. Akteurzentrierter Institutionalismus
- III. Theorie politischer Praktiken nach Tanja Pritzlaff und Frank Nullmeier
- 2.1. Theorie politischer Praktiken
- 2.2. Körper und Artefakte
- 2.3. Normativität von Praktiken
- 2.4. Politik als Herstellung kollektiver Verbindlichkeit
- 2.5. Minimalvoraussetzungen zur Identifikation von politischen Geschehen
- 2.6. Basale Akte zur Herstellung von Verbindlichkeit
- IV. Mikropolitische Taktiken nach Oswald Neuberger
- 3.1. Mikropolitische Taktiken
- 3.2. Täuschung und Vertretung
- 3.2.1. Vertretung
- 3.2.2. Täuschung
- V. Grundtypen politischer Praktiken
- 4.1. Beispiele für politische Praktiken
- Resumée Teil I
- Teil II: Kommunikation als Medium der Politik
- V. Medien Kommunikation - Sprache
- 5.1.1. Politik und Medien
- 5.1.2. Inszenierung durch Medien
- 5.1.3. Manipulation durch Medien
- 5.1.4. PR im politisch-parlamentarischen Raum
- 5.2. Kommunikation und Sprache
- 5.2.1. Sprache - Verbalisieren politischer Praktiken
- 5.2.2. Politische Rede
- 5.2.3. Nonverbale Kommunikation – eine politische Praktik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion von Kommunikationsmedien und Sprache in politischen Prozessen. Sie verbindet theoretische Betrachtungen der Mikropolitik und des akteurzentrierten Institutionalismus mit einer Analyse der Rolle von Medien und Sprache in der politischen Praxis. Das Ziel ist es, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie politische Entscheidungen getroffen werden und wie Medien und Sprache diese Prozesse beeinflussen.
- Mikropolitik und ihre Bedeutung in politischen Entscheidungsprozessen
- Der akteurzentrierte Institutionalismus und seine Relevanz für das Verständnis politischer Praktiken
- Die Rolle von Medien in der Inszenierung und Manipulation politischer Prozesse
- Die Bedeutung von Sprache und nonverbaler Kommunikation in der politischen Praxis
- Die Herstellung kollektiver Verbindlichkeit als zentrales Element politischer Prozesse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Funktion von Kommunikationsmedien und Sprache in politischen Prozessen. Sie beschreibt die zunehmende Präsenz von Politikern in Medien und deren Einfluss auf die öffentliche Meinung. Die scheinbare Transparenz politischer Handlungen wird hinterfragt, und die Notwendigkeit einer tiefergehenden Analyse der zugrundeliegenden Praktiken und Taktiken wird betont.
Teil I: Theoretische Betrachtungen: Dieser Teil legt das theoretische Fundament der Arbeit. Er beginnt mit einer Eingrenzung des Begriffs der Mikropolitik und führt den akteurzentrierten Institutionalismus nach Fritz W. Scharpf ein, um die Interaktion von Akteuren, Institutionen und politischen Praktiken zu beleuchten. Die Theorie politischer Praktiken nach Pritzlaff und Nullmeier wird vorgestellt, wobei die Bedeutung von Körpern, Artefakten, Normen und der Herstellung kollektiver Verbindlichkeit herausgestellt wird. Die Analyse mikropolitischer Taktiken nach Neuberger komplettiert den Überblick über die theoretischen Grundlagen, indem sie die Strategien der Täuschung und Vertretung in den Fokus rückt.
Teil II: Kommunikation als Medium der Politik: Dieser Teil analysiert die Rolle von Medien und Sprache in politischen Prozessen. Er untersucht die komplexen Interaktionen zwischen Politik und Medien, die Inszenierung und Manipulation durch Medien sowie die Bedeutung von Public Relations im politischen Raum. Die Analyse erweitert sich auf die Bedeutung von Sprache als Instrument zur Verbalisierung politischer Praktiken, politische Rede und die nicht zu vernachlässigende Rolle nonverbaler Kommunikation.
Schlüsselwörter
Mikropolitik, Akteurzentrierter Institutionalismus, Politische Praktiken, Kommunikationsmedien, Sprache, Medieninszenierung, Manipulation, kollektive Verbindlichkeit, politische Taktiken, nonverbale Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse von Kommunikationsmedien und Sprache in politischen Prozessen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Funktion von Kommunikationsmedien und Sprache in politischen Prozessen. Sie verbindet theoretische Betrachtungen der Mikropolitik und des akteurzentrierten Institutionalismus mit einer Analyse der Rolle von Medien und Sprache in der politischen Praxis. Das Ziel ist ein besseres Verständnis der Entstehung politischer Entscheidungen und des Einflusses von Medien und Sprache darauf.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den akteurzentrierten Institutionalismus (Fritz W. Scharpf), die Theorie politischer Praktiken (Tanja Pritzlaff und Frank Nullmeier) und die Analyse mikropolitischer Taktiken (Oswald Neuberger). Der Fokus liegt auf der Interaktion von Akteuren, Institutionen und politischen Praktiken, der Bedeutung von Körpern, Artefakten und Normen sowie Strategien der Täuschung und Vertretung in der Politik.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt Mikropolitik und ihre Bedeutung in politischen Entscheidungsprozessen, die Rolle des akteurzentrierten Institutionalismus, den Einfluss von Medien auf die Inszenierung und Manipulation politischer Prozesse, die Bedeutung von Sprache (verbal und nonverbal) in der politischen Praxis und die Herstellung kollektiver Verbindlichkeit als zentrales Element politischer Prozesse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Teil I mit theoretischen Betrachtungen (Mikropolitik, Akteurzentrierter Institutionalismus, Theorie politischer Praktiken, Mikropolitische Taktiken) und einen Teil II, der die Rolle von Kommunikationsmedien und Sprache in der Politik analysiert (Medienkommunikation, Sprache, nonverbale Kommunikation). Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Mikropolitik, Akteurzentrierter Institutionalismus, Politische Praktiken, Kommunikationsmedien, Sprache, Medieninszenierung, Manipulation, kollektive Verbindlichkeit, politische Taktiken und nonverbale Kommunikation.
Was ist das zentrale Forschungsinteresse?
Das zentrale Forschungsinteresse liegt in der Aufklärung der komplexen Wechselwirkungen zwischen politischen Akteuren, Institutionen, Medien und Sprache und wie diese die Entstehung und den Verlauf politischer Entscheidungsprozesse beeinflussen.
Wie wird die Rolle der Medien dargestellt?
Die Arbeit untersucht die komplexe Interaktion zwischen Politik und Medien, analysiert die Inszenierung und Manipulation durch Medien und die Bedeutung von Public Relations im politischen Raum. Die scheinbare Transparenz politischer Handlungen wird kritisch hinterfragt.
Welche Rolle spielt Sprache in der Analyse?
Sprache wird als zentrales Instrument zur Verbalisierung politischer Praktiken betrachtet. Die Analyse umfasst politische Rede und die Bedeutung nonverbaler Kommunikation als politische Praktik.
- Citar trabajo
- Andrea Roy (Autor), 2010, Politische Praktiken - Theoretische Betrachtung, akteurzentrierter Instititutonalismus und die Relevanz von Kommunikation durch Medien und Sprache in politischen Prozessen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148576