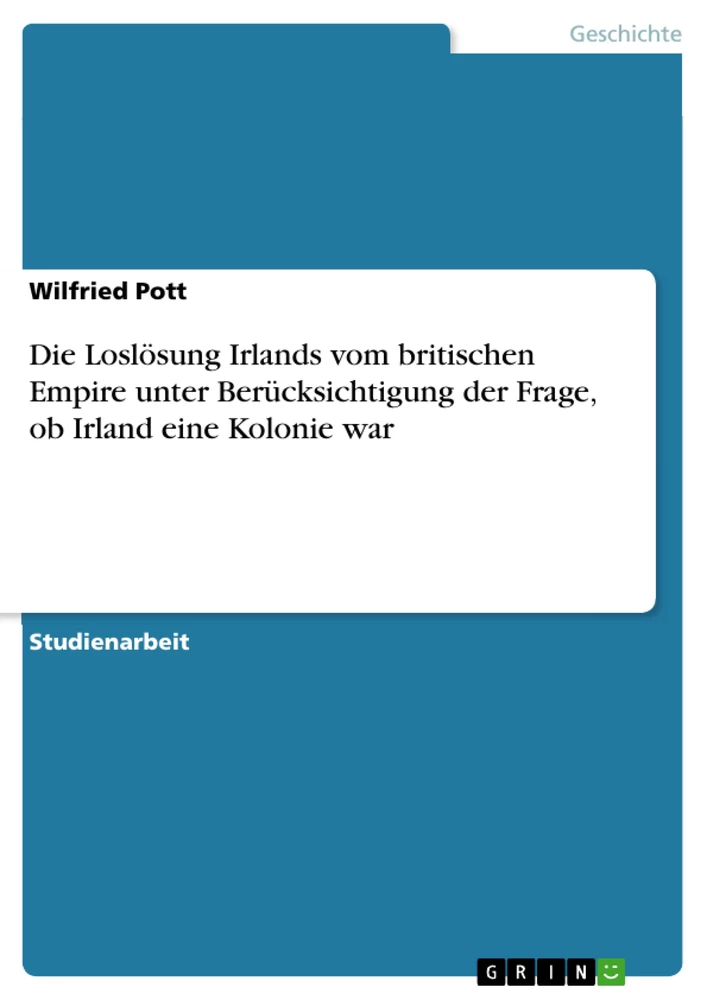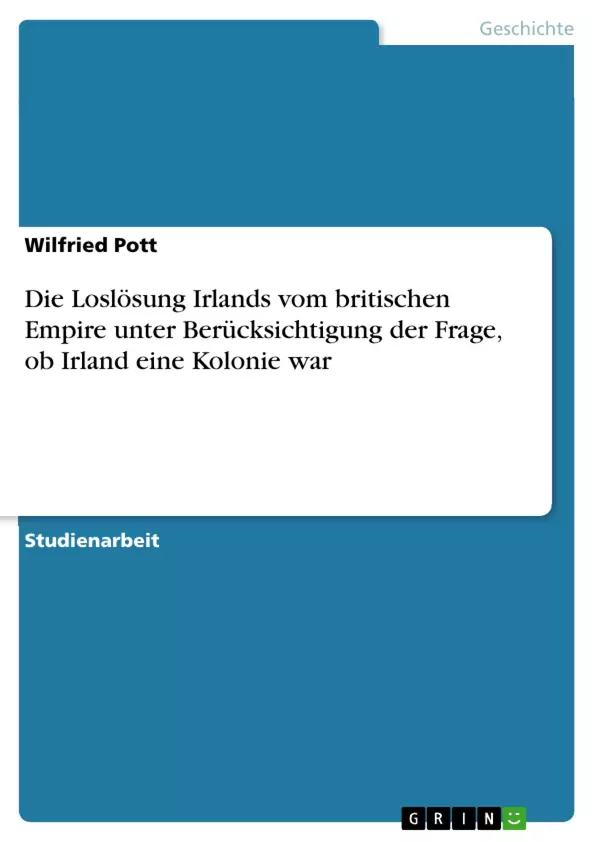Diese Hausarbeit befasst sich mit der Loslösung Irlands vom britischen Empire. Meine Themenwahl setzt die Annahme voraus, dass Irland, obwohl mit Großbritannien in einer Union verbunden, nicht gleichberechtigter Teil dieser Union war. Spricht man vom britischen Empire so meint man das britische Weltreich. Löst sich Irland also vom Britischen Empire, so müsste es zuvor einen Koloniestatus gehabt haben. Zunächst werde ich deshalb den Begriff „Kolonie“ bzw. „Kolonialismus“ näher erläutern. Hierzu dienen die Definitionen von Osterhammel und Förster. Ergänzend werde ich auch die Definition von Hechter zum internen Kolonialismus heranziehen.
Die Frage, ob Irland eine Kolonie war, wird im englischsprachigen Raum unter Historikern verstärkt diskutiert. Die Frage ist auch deswegen von Bedeutung, weil sie in die aktuelle Nordirland-Problematik und die britisch-irische Tagespolitik hineinspielt und eventuell der Provisonal IRA Unterstützung in ihrem gewaltsamen Kampf für die irische Einheit liefern könnte. Laut McDonough können aktuell in Nordirland keine kolonialen Zustände gesehen werden, wenn es sie nicht bereits im 19. Jahrhundert in Irland gab. Die oben genannte Fragestellung ist damit zumindest auf der irischen Insel aktuell, während der von Hechter aufgegriffene Begriff des internen Kolonialismus von Osterhammel eher angezweifelt wird. Förster weist zudem darauf hin, dass die Entwicklung einer Theorie des internen Kolonialismus noch in den Kinderschuhen steckt.
Im Rahmen dieser Hausarbeit ist deshalb ausgehend von den Definitionen des Begriffs „Kolonialismus“ insbesondere zu klären, ob es Ansatzpunkte gibt, die die Behauptung, Irland sei eine Kolonie gewesen, untermauern können.
Hierzu könnten aus meiner Sicht zahlreiche Ereignisse und Maßnahmen einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Ich werde deshalb eine Eingrenzung auf das Verhalten der Briten während der großen Hungersnot und die Haltung der Gegner der drei Home Rule-Gesetze vornehmen. Unabhängig von möglichen Anhaltspunkten für einen Kolonialstatus werde ich zudem in einem Ausblick die Staatswerdung, die weitere Bindung an Großbritannien und die Mitgliedschaft im Commonwealth bis zur völligen Unabhängigkeit darstellen.
Eine abschließende Beantwortung der Frage, ob Irland tatsächlich eine Kolonie war, kann allerdings mit dieser Hausarbeit nicht geleistet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition „Kolonie“ und „Kolonialismus“
- 3 Das Verhalten der Briten während der Großen Hungersnot 1845 - 1849
- 4 Die Haltung der Gesetzesgegner in der Home Rule-Frage
- 5 Ausblick: Die Lösung vom Empire, die weitere Bindung an Großbritannien und die Mitgliedschaft im Commonwealth
- 6 Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Loslösung Irlands vom britischen Empire und befasst sich kritisch mit der Frage, ob Irland als Kolonie betrachtet werden kann. Die Arbeit analysiert verschiedene historische Ereignisse und politische Entwicklungen, um diese Frage zu beleuchten.
- Definition von „Kolonie“ und „Kolonialismus“
- Das Verhalten Großbritanniens während der Großen Hungersnot
- Der Widerstand gegen die Home Rule-Bewegung
- Irlands Weg in die Unabhängigkeit und seine Beziehung zum Commonwealth
- Bewertung des Kolonialstatus Irlands anhand verschiedener Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der irischen Unabhängigkeit vom britischen Empire ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach Irlands möglichem Kolonialstatus. Sie skizziert die historische Vorgeschichte der Union zwischen Großbritannien und Irland und hebt die Bedeutung der Frage für die aktuelle Nordirland-Problematik hervor. Die Arbeit kündigt die methodische Vorgehensweise an: die Definition des Kolonialismus, die Analyse des britischen Verhaltens während der Großen Hungersnot und im Kontext der Home Rule-Bewegung sowie ein Ausblick auf die weitere Entwicklung bis zur vollständigen Unabhängigkeit.
2 Definition „Kolonie“ und „Kolonialismus“: Dieses Kapitel definiert die Kernbegriffe „Kolonie“ und „Kolonialismus“ anhand der Werke von Osterhammel und Förster. Es werden verschiedene Kolonietypen (Beherrschungs-, Stützpunkt- und Siedlungskolonien) unterschieden und die Definition des internen Kolonialismus nach Hechter erläutert. Die verschiedenen Perspektiven und die Komplexität der Begriffsbestimmung werden herausgestellt, um den Rahmen für die spätere Analyse des irischen Falls zu schaffen. Die fünf Variablen Hechters zur Bestimmung von internen Kolonien werden vorgestellt und diskutiert.
3 Das Verhalten der Briten während der Großen Hungersnot 1845 - 1849: Dieses Kapitel untersucht das Handeln der britischen Regierung während der Großen Hungersnot in Irland. Es widerlegt die These von einer reinen Naturkatastrophe und analysiert die politischen und wirtschaftlichen Ursachen der Hungersnot. Die unzureichenden und oftmals gefühllosen Hilfsmaßnahmen der britischen Regierung werden detailliert beschrieben, und der eklatante Widerspruch zwischen den Getreideexporten nach England und dem Hungertod in Irland wird herausgestellt. Das Kapitel zeigt die mangelnde Fürsorge der britischen Regierung und die schwerwiegenden Folgen für die irische Bevölkerung auf.
4 Die Haltung der Gesetzesgegner in der Home Rule-Frage: Das Kapitel analysiert die Gegenwehr gegen die Home Rule-Bewegung in Großbritannien und Irland. Es werden die unterschiedlichen Motive der Gegner (Grundbesitzer, Industrielle, Protestanten) und ihre Strategien zur Verhinderung der irischen Selbstverwaltung dargestellt. Der Widerstand wird im Kontext des britischen Imperialismus und des nationalen Selbstverständnisses Englands interpretiert. Die Rolle der Unionisten und des Orange Order sowie die gewaltvollen Auseinandersetzungen werden beschrieben. Das Kapitel zeigt, wie die unterschiedlichen Interessen und die Angst vor einer Schwächung des Empire die Home Rule-Bewegung behinderten.
5 Ausblick: Die Lösung vom Empire, die weitere Bindung an Großbritannien und die Mitgliedschaft im Commonwealth: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die weiteren Entwicklungen nach dem Scheitern der ersten Home Rule-Gesetze bis zur Unabhängigkeit Irlands. Der Osteraufstand, der Unabhängigkeitskrieg und die Verhandlungen zum Anglo-Irish Treaty werden kurz dargestellt. Der erzwungene Dominion-Status Irlands und seine spätere vollständige Unabhängigkeit sowie der Austritt aus dem Commonwealth werden beschrieben. Die widersprüchliche Entwicklung vom erzwungenen Dominion-Status zur vollständigen Unabhängigkeit wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
Irland, Britisches Empire, Kolonialismus, Große Hungersnot, Home Rule, Unabhängigkeit, Dominion-Status, Commonwealth, interne Kolonie, Dependenztheorie, Protestanten, Katholiken, Act of Union.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Irlands Loslösung vom Britischen Empire
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Loslösung Irlands vom britischen Empire und analysiert kritisch, ob Irland als Kolonie betrachtet werden kann. Sie beleuchtet verschiedene historische Ereignisse und politische Entwicklungen, um diese Frage zu beantworten.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von „Kolonie“ und „Kolonialismus“, das Verhalten Großbritanniens während der Großen Hungersnot, den Widerstand gegen die Home Rule-Bewegung, Irlands Weg in die Unabhängigkeit und seine Beziehung zum Commonwealth sowie eine Bewertung des Kolonialstatus Irlands anhand verschiedener Theorien.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition von „Kolonie“ und „Kolonialismus“, Das Verhalten der Briten während der Großen Hungersnot, Die Haltung der Gesetzesgegner in der Home Rule-Frage, Ausblick: Die Lösung vom Empire, die weitere Bindung an Großbritannien und die Mitgliedschaft im Commonwealth, sowie Zusammenfassung und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Forschungsfrage.
Wie wird der Begriff „Kolonie“ und „Kolonialismus“ definiert?
Die Arbeit definiert die Begriffe „Kolonie“ und „Kolonialismus“ anhand der Werke von Osterhammel und Förster. Es werden verschiedene Kolonietypen (Beherrschungs-, Stützpunkt- und Siedlungskolonien) unterschieden und der interne Kolonialismus nach Hechter erläutert. Die fünf Variablen Hechters zur Bestimmung von internen Kolonien werden vorgestellt und diskutiert.
Welche Rolle spielt die Große Hungersnot in der Analyse?
Das Verhalten der britischen Regierung während der Großen Hungersnot wird detailliert analysiert. Die Arbeit widerlegt die These einer reinen Naturkatastrophe und untersucht die politischen und wirtschaftlichen Ursachen. Die unzureichenden Hilfsmaßnahmen und der eklatante Widerspruch zwischen Getreideexporten nach England und dem Hungertod in Irland werden als Belege für ein koloniales Machtverhältnis interpretiert.
Wie wird der Widerstand gegen die Home Rule-Bewegung dargestellt?
Die Hausarbeit analysiert die Gegenwehr gegen die Home Rule-Bewegung in Großbritannien und Irland, indem sie die Motive der Gegner (Grundbesitzer, Industrielle, Protestanten) und ihre Strategien zur Verhinderung der irischen Selbstverwaltung darstellt. Der Widerstand wird im Kontext des britischen Imperialismus und des nationalen Selbstverständnisses Englands interpretiert. Die Rolle der Unionisten und des Orange Order sowie die gewaltvollen Auseinandersetzungen werden ebenfalls beschrieben.
Was wird im Ausblick behandelt?
Der Ausblick beschreibt die Entwicklungen nach dem Scheitern der ersten Home Rule-Gesetze bis zur Unabhängigkeit Irlands. Der Osteraufstand, der Unabhängigkeitskrieg, die Verhandlungen zum Anglo-Irish Treaty, der erzwungene Dominion-Status und die spätere vollständige Unabhängigkeit sowie der Austritt aus dem Commonwealth werden zusammengefasst. Die widersprüchliche Entwicklung vom erzwungenen Dominion-Status zur vollständigen Unabhängigkeit wird beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Irland, Britisches Empire, Kolonialismus, Große Hungersnot, Home Rule, Unabhängigkeit, Dominion-Status, Commonwealth, interne Kolonie, Dependenztheorie, Protestanten, Katholiken, Act of Union.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann Irland als Kolonie betrachtet werden?
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit analysiert verschiedene historische Ereignisse und politische Entwicklungen, um die Forschungsfrage zu beantworten. Sie stützt sich auf die Definition des Kolonialismus, die Analyse des britischen Verhaltens während der Großen Hungersnot und im Kontext der Home Rule-Bewegung sowie einen Ausblick auf die weitere Entwicklung bis zur vollständigen Unabhängigkeit.
- Citar trabajo
- Wilfried Pott (Autor), 2006, Die Loslösung Irlands vom britischen Empire unter Berücksichtigung der Frage, ob Irland eine Kolonie war, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148247