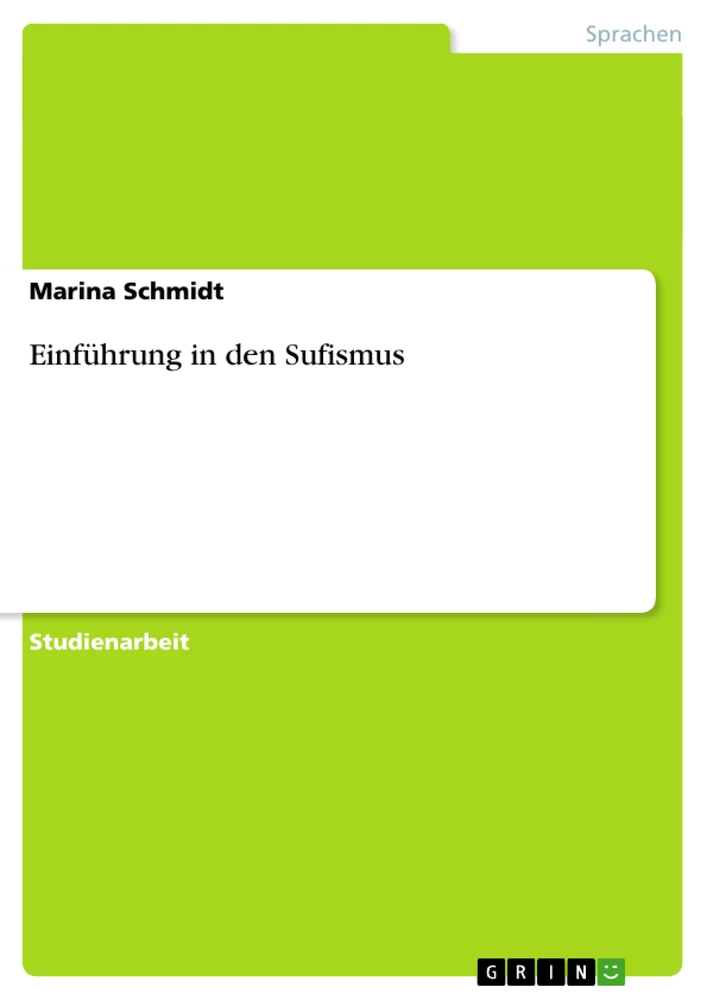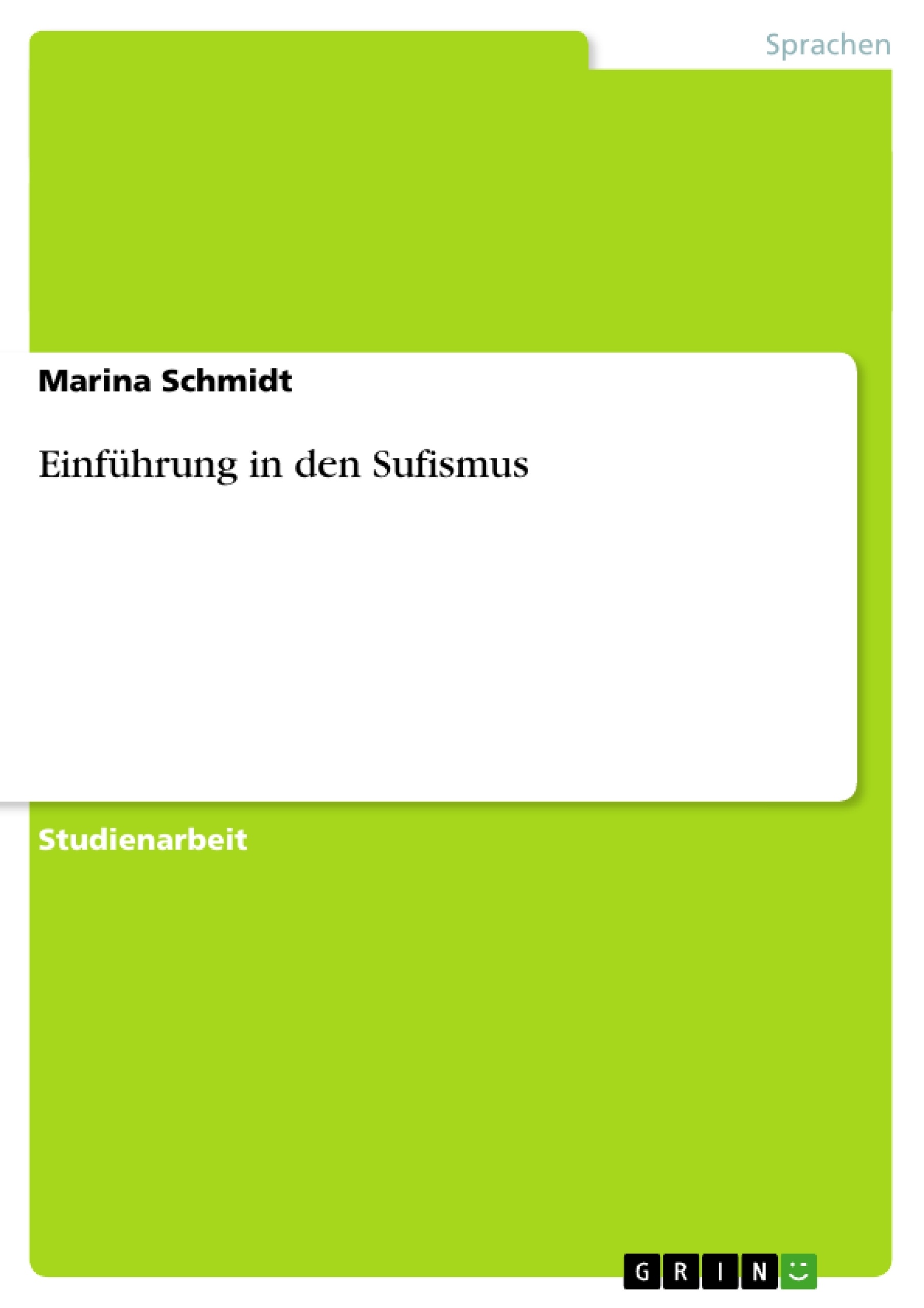Jede Religion hat im Laufe der Zeit eine mystische Lehre entwickelt. In dieser Ausarbeitung soll die Mystik des Islams, der Sūfīsmus, näher betrachtet werden. Nachdem grundsätzliche Ideen und Praktiken vorgestellt wurden, möchte ich auf die geschichtliche Entwicklung der mystischen Strömung im Islam eingehen und letztlich kurz die Organisation islamischer Mystiker in Orden bzw. Bruderschaften, die bis heute existent sind, skizzieren. Jede mystische Bewegung grenzt sich durch spezielle Praktiken von ihrer ursprünglichen Gemeinde ab. Im Verlaufe dieser Ausarbeitung soll nicht nur festgestellt werden, inwieweit diese Abgrenzung stattfindet, sondern es sollen vor allem Gründe dafür gefunden werden, warum der Sūfīsmus von vielen Seiten äußerst skeptisch beäugt wird, vor allem in muslimischem Umfeld. Weshalb könnte man Sūfīs kritisieren? Eine Antwort auf diese Frage soll am Ende der Ausarbeitung gegeben werden, die einen oberflächlichen Einblick in die Thematik geben soll. Zur Vertiefung finden sich im anhängenden Literaturverzeichnis einige Lesetipps.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Ideen und Praktiken
3. Entwicklung
4. Orden/Bruderschaften
5. Fazit
Literaturliste
1. Einleitung
Jede Religion hat im Laufe der Zeit eine mystische Lehre entwickelt. In dieser Ausarbeitung soll die Mystik des Islams, der Sūfīsmus, näher betrachtet werden. Nachdem grundsätzliche Ideen und Praktiken vorgestellt wurden, möchte ich auf die geschichtliche Entwicklung der mystischen Strömung im Islam eingehen und letztlich kurz die Organisation islamischer Mystiker in Orden bzw. Bruderschaften, die bis heute existent sind, skizzieren. Jede mystische Bewegung grenzt sich durch spezielle Praktiken von ihrer ursprünglichen Gemeinde ab. Im Verlaufe dieser Ausarbeitung soll nicht nur festgestellt werden, inwieweit diese Abgrenzung stattfindet, sondern es sollen vor allem Gründe dafür gefunden werden, warum der Sūfīsmus von vielen Seiten äußerst skeptisch beäugt wird, vor allem in muslimischem Umfeld. Weshalb könnte man Sūfīs kritisieren? Eine Antwort auf diese Frage soll am Ende der Ausarbeitung gegeben werden, die einen oberflächlichen Einblick in die Thematik geben soll. Zur Vertiefung finden sich im anhängenden Literaturverzeichnis einige Lesetipps.
2. Ideen und Praktiken
Allgemein versteht man unter einem Anhänger des Sūfīsmus, arab. تصوف (Tasawwuf), einen Muslim, der seinen Glauben auf zweierlei Arten lebt. Einerseits ist das der „äußere Rahmen“ seines islamischen Glaubens, also das Verhalten gemäß Kur’ān und Sunna. Andererseits versucht der Sūfī, Gott innerhalb dieses Rahmens möglichst nahe zu sein, indem er sich stark auf seine Seele rückbesinnt. „Das Erkennen des Inneren Selbst“, arab. ´ilm al-bātin, wurde in der Geschichte des Sūfīsmus als Wissenschaft begriffen und fortführend weiterentwickelt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Ausarbeitung über den Sūfīsmus?
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Mystik des Islams, dem Sūfīsmus. Sie untersucht die grundlegenden Ideen und Praktiken, die geschichtliche Entwicklung dieser mystischen Strömung im Islam und die Organisation islamischer Mystiker in Orden bzw. Bruderschaften.
Was sind die Hauptziele der Ausarbeitung?
Die Ziele sind, die Abgrenzung des Sūfīsmus von der ursprünglichen Gemeinde zu untersuchen, die Gründe für die Skepsis gegenüber dem Sūfīsmus, insbesondere in muslimischem Umfeld, zu ergründen und einen Einblick in die Thematik zu geben.
Was sind die grundlegenden Ideen und Praktiken des Sūfīsmus?
Ein Anhänger des Sūfīsmus lebt seinen Glauben auf zweierlei Arten: einerseits gemäß Kuran und Sunna (der „äußere Rahmen“), andererseits versucht er, Gott durch Rückbesinnung auf seine Seele möglichst nahe zu sein (´ilm al-bātin, das "Erkennen des Inneren Selbst"). Ein wichtiger Bestandteil ist dhikr, das Gottesgedenken, bei dem man ununterbrochen in Gedanken bei Gott ist.
Was ist dhikr?
Dhikr ist das Gottesgedenken, ein wichtiger Bestandteil des mystischen Lebens im Sūfīsmus. Es beinhaltet, in Gedanken ununterbrochen bei Gott zu sein. Dies kann durch ständige Wiederholung des Namens Allah oder des Glaubensbekenntnisses geschehen, oft in Verbindung mit Atemtechniken, um Ekstase zu erreichen.
Was ist der „Weg zu Gott“ im Sūfīsmus?
Der „Weg zu Gott“ ist der Pfad, den ein Sūfī beschreitet, um Erleuchtung und Loslösung vom Körper zu erreichen. Er besteht aus zwölf verschiedenen Stationen (maqām) und Zuständen (hāl). Anfängliche Stationen sind beispielsweise Reue und das Abbrechen der Beziehungen zum alten Leben.
Welche Rolle spielt der Rückzug aus der Welt im Sūfīsmus?
Der Rückzug aus der Welt ist die Basis für den „Weg zu Gott“, da menschliche Gelüste und deren Erfüllung vom Dialog mit Gott ablenken. Dies beinhaltet oft ein längeres Exil, Fasten und die Einhaltung des Grundsatzes: „Wenig essen, wenig sprechen, wenig schlafen“.
Warum sind Armut (faqīr/darwisch) wichtige Begriffe im Sūfīsmus?
Armut ist eine wichtige Station des Weges, da materieller Besitz den Sūfī daran hindert, seinen Blick von der Welt ab- und Gott zuzuwenden. Faqīr (arabisch) und Darwisch (persisch) sind volkstümliche Bezeichnungen für Sūfīs, die diesen Zustand anstreben.
Welche weiteren Stationen und Zustände gibt es auf dem „Weg zu Gott“?
Weitere Stationen und Zustände sind absolutes Gottvertrauen, Dankbarkeit, Geduld, Hoffnung und Furcht (oft als „Flügel, mit denen man zum Paradies fliegt“ bezeichnet). Ein hoher Grad ist die Zufriedenheit (ridā), und das Endziel ist die Gotteserkenntnis.
Welche Kritik wird am Sūfīsmus geäußert?
Die Ausarbeitung zielt darauf ab, die Gründe für die Skepsis gegenüber dem Sūfīsmus zu untersuchen, insbesondere in muslimischem Umfeld. Am Ende soll eine Antwort auf die Frage gegeben werden, weshalb Sūfīs kritisiert werden könnten.
- Citar trabajo
- Marina Schmidt (Autor), 2007, Einführung in den Sufismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147983