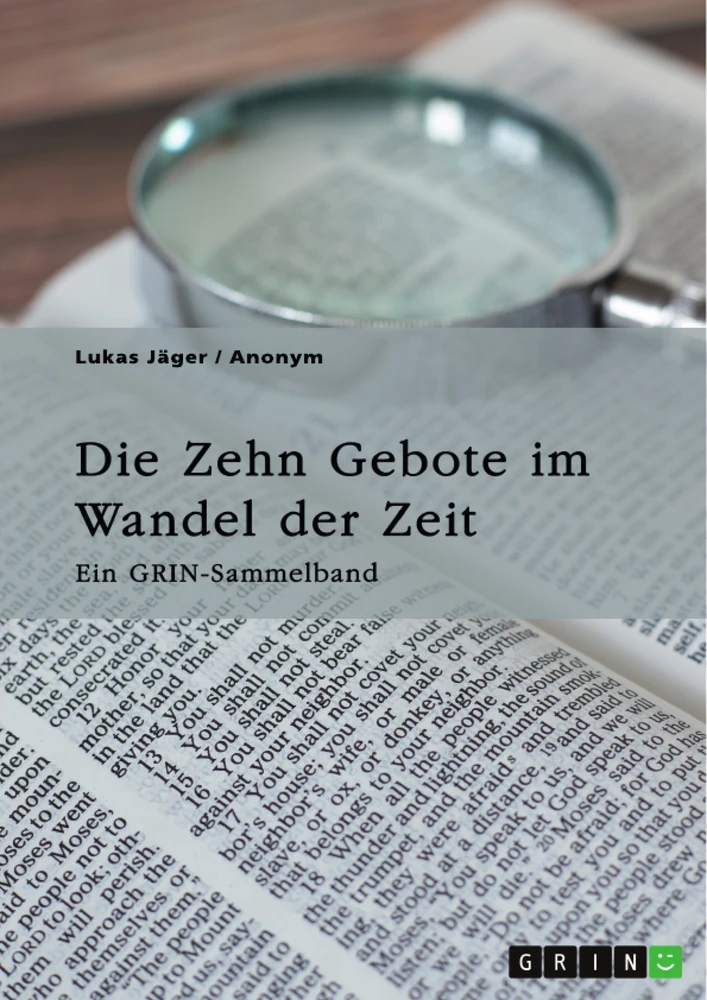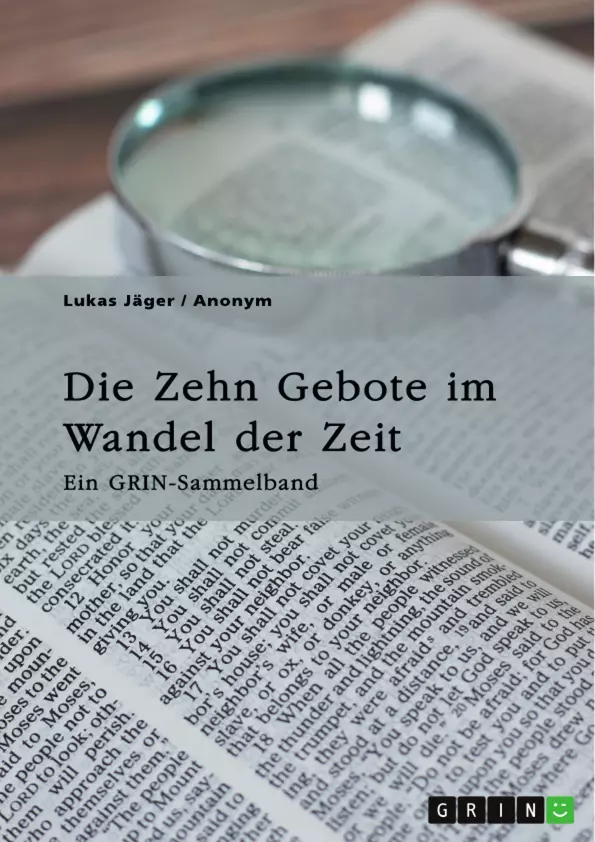Dieser Sammelband enthält drei Hausarbeiten.
Die erste Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage: Wie sah eine Ehe im Alten Testament aus und wie wurde das Ehebruchsverbot des Dekalogs befolgt und umgesetzt? Dazu wird zunächst allgemein auf die Ehe im Alten Testament eingegangen, wobei zunächst der Begriff "Ehe" sowie die rechtlichen Bestimmungen näher erläutert werden. Anschließend werden mehrere Faktoren, die in der Ehe im Alten Orient eine Rolle spielten, thematisiert: Mitgift, Ehevertrag, Brautgeld sowie die Partnerwahl. Schlussendlich wird ein kurzer Überblick über die Ehescheidung gegeben und ein genauerer Blick auf das Ehebruchsverbot im Dekalog geworfen.
Die nächste Arbeit dreht sich um das Begehrensverbot, was eine besondere Stellung im Dekalog einnimmt, da es diesen abschließt und nachhaltig wirkt. Es bezieht sich auf das Begehren, aber es stellt sich die Frage, ob seine Bedeutung darauf reduziert werden kann. Es bleibt unklar, was genau in Bezug auf Mitmenschen verboten ist, und warum es zwei Fassungen des Dekalogs mit unterschiedlichen Objektreihen gibt. Die Arbeit untersucht den ursprünglichen Sinn des Verbots, die Verbwahl und die Objektreihen. Sie vergleicht die Fassungen aus Ex 20,17 und Dtn 5,21 und analysiert die Rezeption des Verbots im Alten und Neuen Testament. Abschließend wird die heutige Bedeutung des Begehrensverbots erörtert.
In der letzten Arbeit soll herausgearbeitet werden, auf welche Weise Ulrich Kühn den Dekalog aktualisiert und welche Verfahrensweise er dazu nutzt. Zu diesem Zweck werden die Untersuchungen von Kühn an den einzelnen Geboten kurz nachgezeichnet. Im zweiten Teil wird der Frage nachgegangen, inwieweit der Dekalog für das Christentum nach Ulrich Kühn heute noch allgemeine Gültigkeit besitzt. Die Ergebnisse werden abschließend gebündelt und die Vorgehensweise von Kühn kommentierend nachvollzogen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Ehe im Alten Testament und das Ehebruchsverbot im Dekalog
- Einleitung
- Ehe im AT
- Rechtliche Bestimmungen
- Heirat
- Ehevertrag
- Brautgeld
- Mitgift
- Partnerwahl
- Ehescheidung
- Ehebruch
- Rechtsfall
- Folgen
- Ehebruchsverbot im Dekalog
- Schluss
- Literaturverzeichnis
- Die Bedeutung des Begehrensverbots (Ex 20,17 und Dtn 5,21). Ursprüngliche Intention und Wirkungsgeschichte
- Einleitung
- Die Bedeutung des Begehrensverbots
- Bedeutung im Kontext des Alten Testaments
- Wirkungsgeschichte des Begehrensverbots in der Bibel
- Gegenwartsbezug des Begehrensverbots
- Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Die aktuelle Bedeutung des Dekalogs nach Ulrich Kühn. Welchen Gehalt hat der Dekalog noch für das Christentum?
- Einleitung
- Bedeutung der einzelnen Gebote des Dekalogs
- Das erste Gebot
- Das zweite Gebot
- Das dritte Gebot
- Das vierte Gebot
- Das fünfte Gebot
- Das sechste Gebot
- Das siebte Gebot
- Das achte Gebot
- Das neunte und zehnte Gebot
- Frage nach der Allgemeingültigkeit des Dekalogs für das Christentum
- Der Dekalog – ein Gesetzbuch nur für die Juden?
- Wird der Dekalog durch das Neue Testament außer Kraft gesetzt?
- Die bleibende Bedeutung des Dekalogs
- Schlussbemerkungen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Sammelband befasst sich mit der historischen und aktuellen Relevanz des Dekalogs, insbesondere im Kontext der Ehe und des Begehrensverbots. Die einzelnen Arbeiten beleuchten die Entwicklung und die Bedeutung der Zehn Gebote in verschiedenen Zeiträumen und kulturellen Kontexten, wobei der Fokus auf dem Alten Testament und dem Christentum liegt.
- Die Rolle der Ehe im Alten Testament und die rechtlichen Bestimmungen
- Die Interpretation und die Wirkungsgeschichte des Ehebruchsverbots
- Die Bedeutung des Begehrensverbots im Alten Testament und seine Relevanz in der heutigen Zeit
- Die Bedeutung der einzelnen Gebote des Dekalogs für das Christentum
- Die Frage nach der Allgemeingültigkeit des Dekalogs für das Christentum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Ehe im Alten Testament und das Ehebruchsverbot im Dekalog
Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der Ehe im Alten Testament und die Rolle des Ehebruchsverbots im Dekalog. Es beleuchtet die rechtlichen Bestimmungen der Ehe, wie zum Beispiel Heirat, Ehevertrag, Brautgeld und Mitgift, sowie die Partnerwahl. Außerdem werden Ehescheidung und die Folgen von Ehebruch im Alten Testament diskutiert.
Die Bedeutung des Begehrensverbots (Ex 20,17 und Dtn 5,21). Ursprüngliche Intention und Wirkungsgeschichte
Dieses Kapitel widmet sich dem Begehrensverbot im Dekalog und untersucht seine ursprüngliche Intention und seine Wirkungsgeschichte. Es analysiert die Bedeutung des Verbots im Kontext des Alten Testaments und verfolgt seine Relevanz in der Bibel bis in die Gegenwart.
Die aktuelle Bedeutung des Dekalogs nach Ulrich Kühn. Welchen Gehalt hat der Dekalog noch für das Christentum?
Dieses Kapitel untersucht die aktuelle Bedeutung des Dekalogs für das Christentum, basierend auf den Analysen von Ulrich Kühn. Es analysiert die Bedeutung der einzelnen Gebote des Dekalogs und stellt die Frage nach deren Allgemeingültigkeit für das Christentum.
Schlüsselwörter
Dekalog, Zehn Gebote, Ehe, Ehebruch, Begehrensverbot, Altes Testament, Christentum, Rechtliche Bestimmungen, Wirkungsgeschichte, Bedeutung, Allgemeingültigkeit, Ulrich Kühn.
- Citar trabajo
- GRIN Verlag (Hrsg.) (Editor), Lukas Jäger (Autor), 2024, Die Zehn Gebote im Wandel der Zeit. Ehe, Begehrensverbot und die moderne Relevanz des Dekalogs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1477889