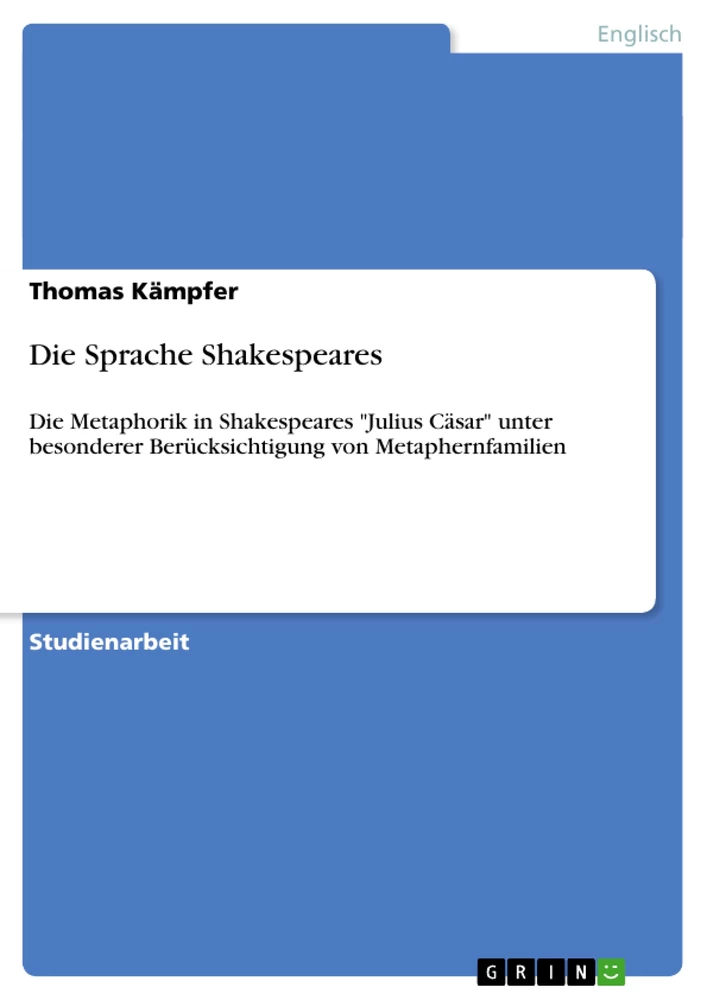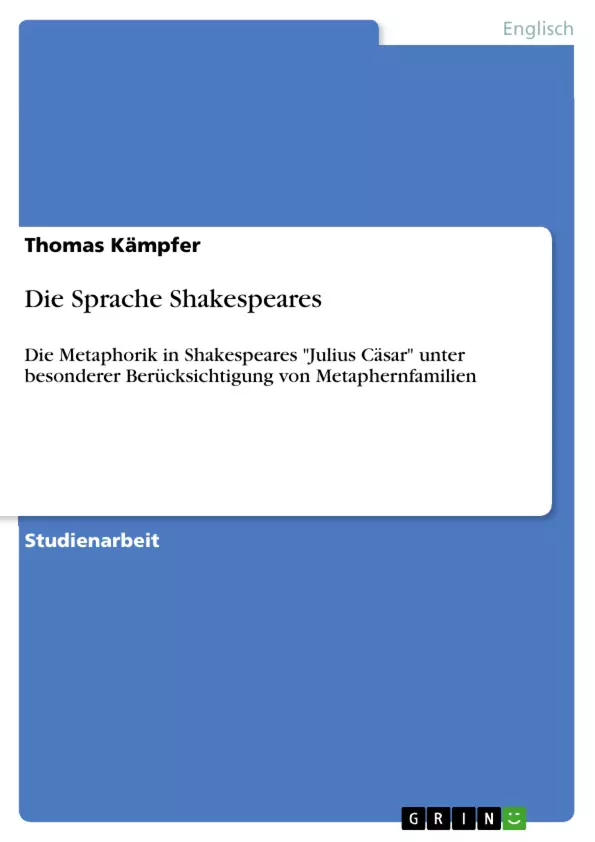Gegenstand der Arbeit
Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der in Shakespeares Julius Cäsar (im folgenden JC) vorliegenden Metaphorik und der Frage, in wie weit die von Shakespeare verwendeten Metaphern zu Gruppen oder Familien zusammengefaßt werden können. Des weiteren wird untersucht, wie diese Metaphern eingesetzt werden und ob der Verwendung bestimmter Gruppen von Metaphern ein System zugrunde liegt. Ich beziehe mich in meiner Hausarbeit bei der Zeilenangabe und der Übersetzung von Textstellen auf die engl.-dt. Studienausgabe des Julius Cäsar, erschienen bei Francke, 1986.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorwort
- 1.1 Gegenstand der Arbeit
- 1.2 Struktur der Hausarbeit
- 2. Funktionsweise und Struktur der Metapher
- 2.1 Definition der Metapher und ihrer Struktur
- 2.1.1 Analyse der Struktur von Metaphern nach Leech
- 2.1.2 Ähnlichkeit als Grundprinzip der Metapher nach Sapir
- 2.1.3 Interne und externe Metaphern
- 3. Die Metaphorik im JC unter Berücksichtigung der Idee der Metaphernfamilie
- 3.1 Ausgewählte Belegstellen für die drei Hauptfamilien von Metaphern im Julius Cäsar
- 3.1.1 Die erste Familie von Metaphern im JC: Blut und Körper (-Säfte)
- 3.1.2 Die zweite Metaphernfamilie im JC: Tier- und Jagdmetaphern
- 3.1.3 Die dritte Metaphernfamilie im JC: Metaphern der Bewegung, des Wandels und des Aufruhrs
- 3.2 Verteilung der Metaphernfamilien im Text des JC
- 4. Analyse ausgewählter Metaphern auf Basis der Analysemodelle von Leech und Sapir
- 4.1 JC I.3.104-6
- 4.1.1 Analyse nach Leech
- 4.1.2 Analyse nach Sapir
- 4.2 JC III.1.36-7
- 4.2.1 Analyse nach Leech
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Metaphorik in Shakespeares Julius Cäsar und analysiert, ob sich die verwendeten Metaphern in Gruppen oder Familien zusammenfassen lassen. Weiterhin wird der Einsatz dieser Metaphern und die Frage nach einem zugrundeliegenden System untersucht. Die Arbeit bezieht sich dabei auf verschiedene Theorien zur Metapher.
- Analyse der Struktur und Funktion von Metaphern basierend auf den Theorien von Leech, Sapir, Lakoff und Johnson.
- Identifizierung von Metaphernfamilien in Shakespeares Julius Cäsar.
- Untersuchung der Verteilung der Metaphernfamilien im Text.
- Empirische Analyse ausgewählter Metaphern anhand der Theorien von Leech und Sapir.
- Erforschung eines möglichen Systems hinter der Verwendung bestimmter Metapherngruppen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorwort: Das Vorwort beschreibt den Gegenstand der Arbeit, die Analyse der Metaphorik in Shakespeares Julius Cäsar und die Untersuchung der Gruppierung von Metaphern in Familien. Es wird die Methodik erläutert, welche auf Theorien von Leech, Sapir, Goatly, Lakoff und Johnson aufbaut, und die Struktur der Arbeit skizziert, die aus theoretischen Überlegungen und einer empirischen Analyse besteht. Der Fokus liegt auf der systematischen Untersuchung des metaphorischen Sprachgebrauchs in Shakespeares Drama.
2. Funktionsweise und Struktur der Metapher: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Metapher etymologisch und anhand der Definitionen von Goatly und Sapir. Es wird der Aspekt der Übertragung von Bedeutung von einer Sache auf eine andere betont. Goatlys Definition von Metapher als unkonventioneller Bezugnahme auf Basis von Ähnlichkeit wird erläutert, ebenso die Notwendigkeit von Vergleichen in der Kommunikation aufgrund der Vielfältigkeit von Lexika und Registern. Ein Kommunikationsmodell von Goatly veranschaulicht den indirekten Bezug zwischen sprachlichen Zeichen und Referenten.
3. Die Metaphorik im JC unter Berücksichtigung der Idee der Metaphernfamilie: Dieses Kapitel widmet sich der Identifizierung von Metaphernfamilien im Julius Caesar. Es werden ausgewählte Belegstellen für drei Hauptfamilien vorgestellt: Blut und Körpermetaphern, Tier- und Jagdmetaphern sowie Metaphern der Bewegung, des Wandels und des Aufruhrs. Der Schwerpunkt liegt auf der Illustration des Prinzips der Metaphernfamilie durch die Auswahl besonders signifikanter Beispiele. Die Verteilung dieser Familien im gesamten Text wird ebenfalls betrachtet.
4. Analyse ausgewählter Metaphern auf Basis der Analysemodelle von Leech und Sapir: Dieses Kapitel führt eine empirische Analyse ausgewählter Metaphern durch, die auf den im ersten Teil dargestellten Theorien von Leech und Sapir basieren. Es werden konkrete Textstellen analysiert und anhand der beiden Modelle interpretiert. Dies dient der Veranschaulichung der Anwendung der theoretischen Ansätze auf konkrete Beispiele aus dem Drama.
Schlüsselwörter
Metaphorik, Shakespeare, Julius Cäsar, Metaphernfamilien, Leech, Sapir, Lakoff, Johnson, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Textanalyse, Kommunikation, Bedeutungsübertragung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Metaphorik in Shakespeares Julius Cäsar
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Metaphorik in Shakespeares Julius Cäsar. Im Fokus steht die Untersuchung, ob sich die verwendeten Metaphern in Gruppen oder Familien zusammenfassen lassen und ob ein zugrundeliegendes System in ihrem Einsatz erkennbar ist. Die Analyse basiert auf verschiedenen Theorien zur Metapher, insbesondere von Leech, Sapir, Lakoff und Johnson.
Welche Theorien zur Metapher werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Leech, Sapir, Lakoff und Johnson zur Metapher. Diese Theorien liefern das theoretische Fundament für die Analyse der Struktur und Funktion der Metaphern im Julius Cäsar und die Identifizierung von Metaphernfamilien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, ein Kapitel zur Funktionsweise und Struktur der Metapher, ein Kapitel zur Metaphorik im Julius Cäsar mit Fokus auf Metaphernfamilien und ein Kapitel zur empirischen Analyse ausgewählter Metaphern anhand der Theorien von Leech und Sapir. Das Vorwort beschreibt den Gegenstand und die Methodik der Arbeit. Die Kapitel entwickeln die theoretischen Grundlagen und wenden diese dann auf konkrete Beispiele aus dem Drama an.
Welche Metaphernfamilien werden im Julius Cäsar identifiziert?
Die Arbeit identifiziert drei Hauptfamilien von Metaphern im Julius Cäsar: Blut- und Körpermetaphern, Tier- und Jagdmetaphern sowie Metaphern der Bewegung, des Wandels und des Aufruhrs. Ausgewählte Belegstellen illustrieren diese Familien und ihre Verteilung im Text wird untersucht.
Wie wird die empirische Analyse durchgeführt?
Die empirische Analyse basiert auf den Theorien von Leech und Sapir. Ausgewählte Textstellen aus dem Julius Cäsar werden anhand dieser Modelle interpretiert und analysiert, um die Anwendung der theoretischen Ansätze zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Metaphorik, Shakespeare, Julius Cäsar, Metaphernfamilien, Leech, Sapir, Lakoff, Johnson, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Textanalyse, Kommunikation, Bedeutungsübertragung.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit beinhaltet folgende Kapitel: * **Vorwort:** Gegenstand der Arbeit, Methodik und Struktur. * **Funktionsweise und Struktur der Metapher:** Definition und theoretische Grundlagen. * **Die Metaphorik im Julius Cäsar:** Identifizierung und Analyse von Metaphernfamilien. * **Analyse ausgewählter Metaphern:** Empirische Analyse anhand der Theorien von Leech und Sapir.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Metaphorik in Shakespeares Julius Cäsar, analysiert die Gruppierung von Metaphern in Familien und erforscht ein mögliches System hinter der Verwendung bestimmter Metapherngruppen. Der Einsatz dieser Metaphern und die zugrundeliegenden Prinzipien werden untersucht.
- Citation du texte
- Thomas Kämpfer (Auteur), 1998, Die Sprache Shakespeares, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147626