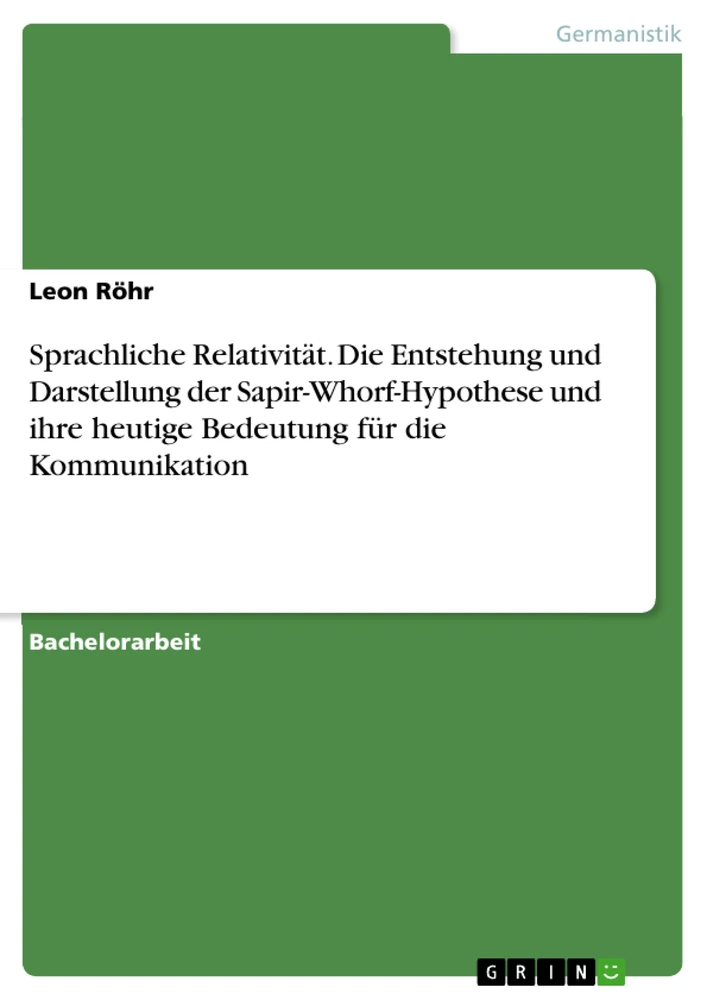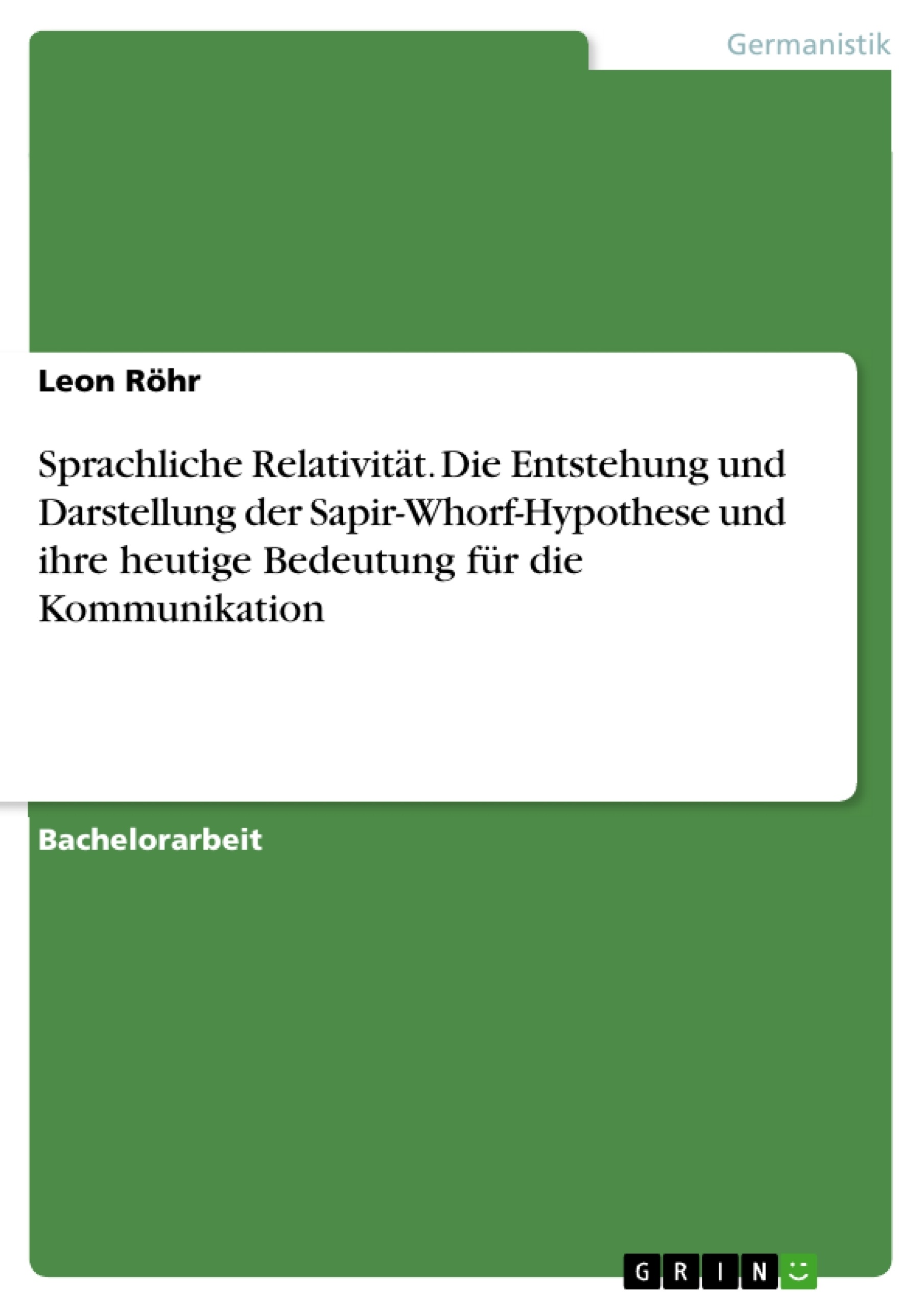Bestimmt unsere Sprache unsere Art, in der wir denken und unsere Welt sehen? Was genau ist dran am sprachlichen Relativitätsprinzip, welches bekannt als die Sapir-Whorf-Hypothese Mitte des letzten Jahrhunderts erstmalig für Unruhe gesorgt hat. Verschiedene Sprachen bringen verschiedene Funktionsweisen, verschiedene Grammatiken, mit sich, die wir wie selbstverständlich erlernen und zumeist gar unhinterfragt anwenden. Solch Unterschiedene können beispielsweise die Rolle des Subjekts im Satz betreffen, die explizite Kennzeichnung von Geschlechtszugehörigkeit oder die Beschreibungsweisen transzendenter Weltaneignung, wie die deiktischen Kennzeichnungen 'links' und 'rechts' oder morphosyntaktische Betrachtungsweisen auf die eigene Person: ich, mich, mir. Viele Sprache haben ihre Besonderheiten, die sie von anderen Sprachen unterscheiden, wodurch es oft eine schwierige Aufgabe ist, sie ineinander zu übersetzen. Einige Sprachen bestehen aus einem gigantischen Wortschatz und komplexen grammatikalischen Strukturen, andere sind scheinbar viel simpler aufgebaut. Können sie aber das gleiche aussagen, und viel wichtiger: erfassen sie beiden den epistemologischen Sinn der Welt in gleichem Maße oder erscheint uns die Welt auf eine andere Art und Weise, je nachdem wie wir gelernt haben, über unsere Welt zu sprechen?
Denn das ist der Kern der Sapir-Whorf-Hypothese: wir denken in den Strukturen und Kategorien, die uns unsere (Erst)sprache vorgibt. Verschiedene Sprecher besitzen kulturell divergierende Fertigkeiten, die Welt d.h. den stream of consciousness zu dekodieren. Diese Arbeit zeigt die Entstehungsgeschichte dieser Forschungsarbeit, indem sie sich engmaschig insbesondere an die Originalschrift von Benjamin Whorf hält und nicht nur einzelne Zitate verwendet, welche in Vergangenheit oft zu wörtlich genommen und falsch verstanden wurden. Später schließt sie ein Resumée in Kontext zum heutigen Forschungsstand der kommunikativen Wirklichkeit. Muss ich tatsächliche alle Sprachen der Welt sprechen und gegeneinander abwiegen, um die Einsicht in eine objektive Wirklichkeit zu erhalten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das sprachliche Relativitätsprinzip
- Sprache, Denken und Welt
- Darstellung und Entstehung der Sapir-Whorf-Hypothese
- Wilhelm von Humboldt
- Edward Sapir
- Benjamin Lee Whorf
- Heutige kommunikative Bedeutung der Sapir-Whorf-Hypothese
- Nichtsprachliche Konzeptualisierungen
- Die sprachliche Beschreibung der Welt
- Konklusion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sapir-Whorf-Hypothese und untersucht deren Entstehungsgeschichte, zentrale Aussagen und heutige Relevanz für die Kommunikation. Die Hypothese besagt, dass Sprache das Denken und unsere Wahrnehmung der Welt beeinflusst.
- Die Entstehung der Sapir-Whorf-Hypothese und die Einflussnahme von Wilhelm von Humboldt, Edward Sapir und Franz Boas
- Die zentrale Aussage der Sapir-Whorf-Hypothese: Sprache als Wirklichkeitskonstruktion
- Die Bedeutung der Sapir-Whorf-Hypothese für die Kommunikation und die Frage nach einem schwachen Determinismus
- Die kritische Betrachtung der Sapir-Whorf-Hypothese und deren heutige Relevanz
- Die Analyse der sprachlichen Relativität anhand von Beispielen und Forschungsergebnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Sapir-Whorf-Hypothese ein und beleuchtet die öffentliche Wahrnehmung der Hypothese. Sie beschreibt die zentrale Aussage der Hypothese, wonach Sprache das Denken und die Weltwahrnehmung beeinflusst. Außerdem wird die Zielsetzung der Arbeit und die Vorgehensweise erläutert.
Das sprachliche Relativitätsprinzip
Dieses Kapitel beleuchtet das Prinzip der sprachlichen Relativität, welches eng mit dem Namen Benjamin Lee Whorf verbunden ist. Es geht auf die starke deterministische Ausdrucksweise Whorfs ein, die den damaligen Zeitgeist erschütterte. Außerdem werden die Wegbereiter Whorfs, wie Wilhelm von Humboldt und Edward Sapir, vorgestellt. Das Kapitel erläutert die Bedeutung der Sapir-Whorf-Hypothese für die Sprachforschung und die unterschiedlichen Interpretationen seiner Arbeiten.
Sprache, Denken und Welt
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie Sprache das Denken und die Weltwahrnehmung beeinflusst. Es werden grundlegende linguistische Begriffe und Erkenntnisse dargestellt, die für das Verständnis der Sapir-Whorf-Hypothese relevant sind. Das Kapitel beleuchtet die Rolle der Sprache als Wirklichkeitskonstruktion und die Frage, ob es Sprachen gibt, die die Welt besser beschreiben können als andere.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Sapir-Whorf-Hypothese, sprachliche Relativität, Sprache, Denken, Weltwahrnehmung, Kommunikation, Determinismus, Wirklichkeitskonstruktion, Wilhelm von Humboldt, Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf, Franz Boas.
- Citar trabajo
- Leon Röhr (Autor), 2019, Sprachliche Relativität. Die Entstehung und Darstellung der Sapir-Whorf-Hypothese und ihre heutige Bedeutung für die Kommunikation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1474071