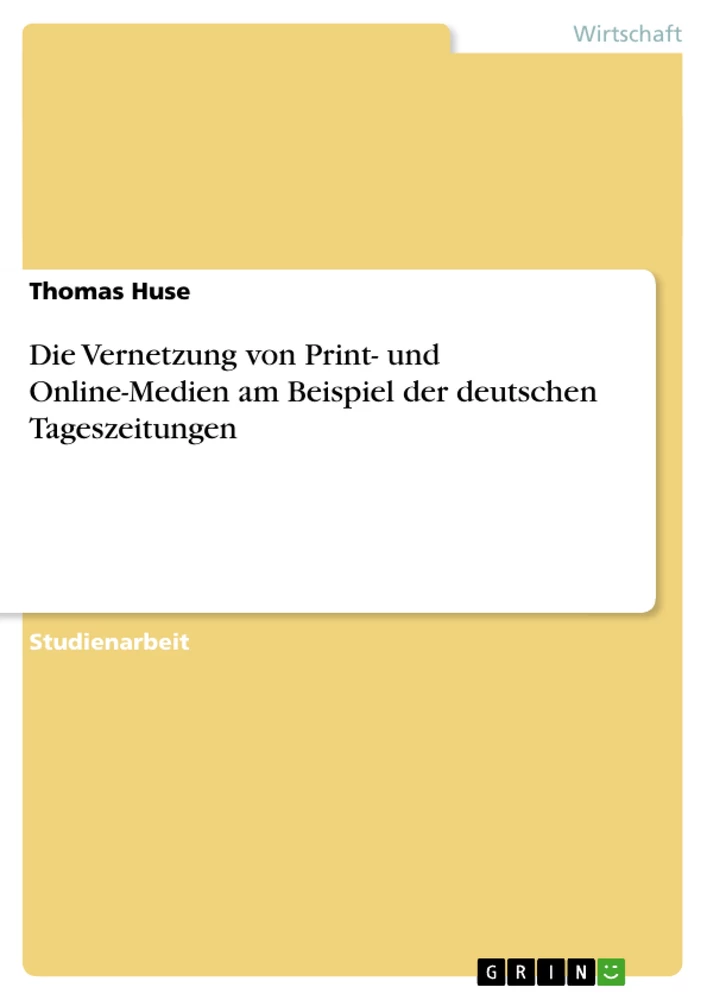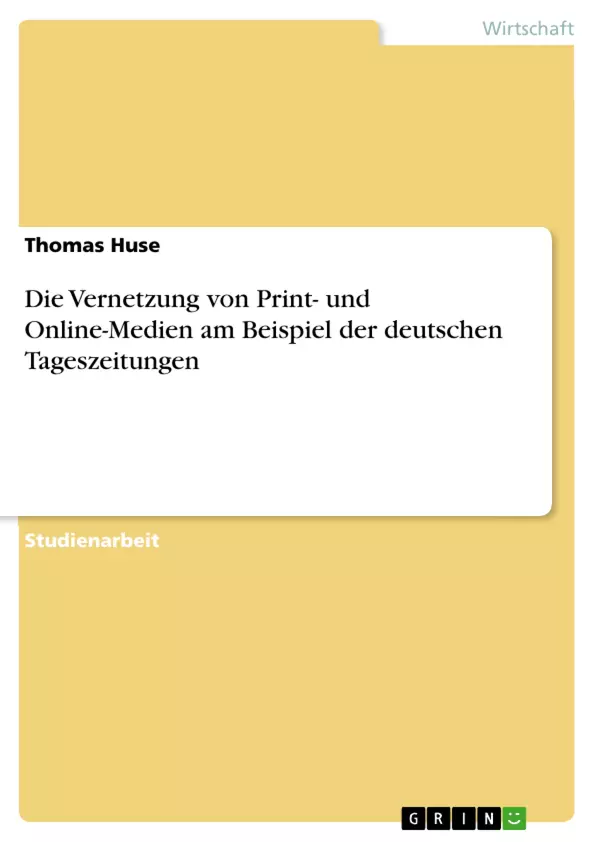Nur wenige Innovationen prägten das Leben von so vielen Menschen, wie das Internet. Vor allem seit den 1990er Jahren nimmt es einen stetig wachsenden Platz in unserem Alltag ein. Ob in Form von neuen Kommunikationswegen, via E-Mail oder in sozialen Netzwerken, in neuen Handelsplattformen oder durch die dauerhafte Verfügbarkeit von Wissen und Nachrichten.
Für die Verlage, die Nachrichten an Leser „verkaufen“, bedeutete das neue Medium Internet eine völlig neue Herausforderung. Ihr Geschäftsmodell war für eine Welt von „vernetzten Computern“ nicht ausgerichtet. Es stellt die klassischen Medien (TV, Radio, Zeitungen/Zeitschriften) auf den Kopf, inhaltlich wie wirtschaftlich.
Eine 1913 von Wolfgang Riepl formulierte These besagt, dass neue, höher entwickelte Medien die alten bestehenden Medien nicht vollständig ersetzen. Nach dem sogenannten „Rieplschen Gesetz“, verändert sich nur das Nutzungsverhalten und der Zeithaushalt der Rezipienten (= Menschen, Empfänger), zu Gunsten des neuen Mediums . Dennoch nahmen sich die Verlage dem Internet nur zögerlich an. Erst in den letzten Jahren verstärkten die deutschen Zeitungsverlage ihr Online-Engagement im Internet.
Doch die Strategien mit dem Internet Geld zu verdienen, um damit die schrumpfenden Umsätze aus dem Printbereich auszugleichen, gingen bisher nicht auf. Die Auseinandersetzung mit dem Internet und die Entwicklung wirtschaftlicher Konzepte, ist aktuell das bestimmende Thema der Verlagsbranche. Welche Strategien haben Verlage die beiden Bereiche Print und Online miteinander zu verknüpfen?
Diese Frage steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Die sich hinsichtlich der Komplexität des Themas, dabei auf das Online-Engagement der deutschen Tageszeitungen beschränkt. Als Grundlage werden zunächst in Kapitel 2 die Strukturen des klassischen Mediums Zeitung vorgestellt und folgende Fragen beantwortet: Wie ist die Zeitung charakterisiert? Welche Möglichkeiten der Finanzierung werden genutzt? Wie ist der Zeitungsmarkt beschaffen? Mit welchen Maßnahmen reagieren Verlage auf die Medienkrise und dem Internet?
Kapitel 3 stellt die neuen Online-Angebote in den Vordergrund und beantwortet die Fragen: Wie sind die Begriffe Internet und Online-Medien definiert? Welche Optionen der Vernetzung bestehen für die Verlage? Wie können sich Online-Angebote finanzieren? Welche Marktstrukturen haben sich bereits entwickelt?
In einer abschließenden Betrachtung wird das Thema zusammen gefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das klassische Medium Zeitung
- 2.1 Der Begriff Zeitung
- 2.2 Die Finanzierung von Zeitungen
- 2.3 Der Zeitungsmarkt in Deutschland
- 2.4 Trends und Entwicklungen
- 3. Die neuen Online-Medien
- 3.1 Begriffliche Erläuterungen
- 3.2 Die Online-Strategien der Tageszeitungsverlage
- 3.3 Die Finanzierung von Online-Angeboten
- 3.4 Der Markt der Online-Angebote
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vernetzung von Print- und Online-Medien am Beispiel deutscher Tageszeitungen. Ziel ist es, die Strategien der Verlage zur Verknüpfung beider Bereiche zu analysieren und die Herausforderungen im Kontext der Medienkrise und des aufkommenden Internets zu beleuchten.
- Charakterisierung des klassischen Mediums "Zeitung" und seiner Finanzierung
- Analyse des deutschen Zeitungsmarktes und bestehender Trends
- Definition und Erläuterung von Online-Medien im Kontext der Tageszeitungen
- Untersuchung der Online-Strategien deutscher Tageszeitungsverlage
- Analyse der Finanzierung und Marktstrukturen von Online-Angeboten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Herausforderungen für Verlage durch das Aufkommen des Internets. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Strategien zur Verknüpfung von Print und Online dar und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die These von Wolfgang Riepl, dass neue Medien bestehende nicht vollständig ersetzen, sondern das Nutzungsverhalten verändern, wird erwähnt, ebenso die zögerliche Anfangsreaktion der Verlage auf das Internet und die aktuelle Dominanz der Frage nach wirtschaftlich tragfähigen Online-Konzepten in der Verlagsbranche.
2. Das klassische Medium Zeitung: Dieses Kapitel charakterisiert das klassische Medium Zeitung, untersucht verschiedene Finanzierungsmodelle, analysiert den deutschen Zeitungsmarkt und beleuchtet die Reaktionen der Verlage auf die Medienkrise und die Herausforderungen durch das Internet. Es beschreibt den Begriff der Zeitung, die wirtschaftlichen Grundlagen ihres Bestehens und die Entwicklungen im Markt, um ein umfassendes Bild des traditionellen Zeitungswesens zu zeichnen und den Kontext für die folgenden Kapitel zu schaffen. Es werden die verschiedenen Faktoren betrachtet, die den Erfolg oder Misserfolg einer Zeitung beeinflussen, von der Glaubwürdigkeit bis zu den Werbeeinnahmen.
3. Die neuen Online-Medien: Kapitel 3 konzentriert sich auf die neuen Online-Medien. Es definiert die Begriffe Internet und Online-Medien im Kontext der Tageszeitungen und untersucht die Möglichkeiten der Vernetzung für die Verlage. Im Mittelpunkt stehen die Strategien der Online-Finanzierung und die Entwicklung der Marktstrukturen. Das Kapitel analysiert die verschiedenen Ansätze, die Verlage verfolgen, um im digitalen Raum erfolgreich zu sein, von kostenpflichtigen Modellen bis hin zu werbefinanzierten Plattformen. Es beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich durch die Digitalisierung für die Tageszeitungen ergeben.
Schlüsselwörter
Tageszeitungen, Printmedien, Online-Medien, Internet, Vernetzung, Medienkrise, Finanzierungsmodelle, Online-Strategien, Marktstrukturen, Medienwandel.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Vernetzung von Print- und Online-Medien
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Vernetzung von Print- und Online-Medien am Beispiel deutscher Tageszeitungen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Strategien von Verlagen zur Verknüpfung von Print- und Online-Bereichen im Kontext der Medienkrise und des Internets.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Das klassische Medium Zeitung, 3. Die neuen Online-Medien und 4. Zusammenfassung. Kapitel 2 befasst sich mit der Charakterisierung des klassischen Mediums "Zeitung", einschließlich Finanzierung und Markt. Kapitel 3 konzentriert sich auf Online-Medien, deren Definition, Strategien der Verlage, Finanzierung und Marktstrukturen.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Arbeit untersucht die Strategien deutscher Tageszeitungsverlage zur Verknüpfung von Print- und Online-Medien. Sie analysiert die Herausforderungen im Kontext der Medienkrise und des Internets und beleuchtet die wirtschaftlichen Aspekte beider Medienformen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind: die Charakterisierung des klassischen Mediums Zeitung und seiner Finanzierung, die Analyse des deutschen Zeitungsmarktes und bestehender Trends, die Definition und Erläuterung von Online-Medien im Kontext der Tageszeitungen, die Untersuchung der Online-Strategien deutscher Tageszeitungsverlage sowie die Analyse der Finanzierung und Marktstrukturen von Online-Angeboten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Tageszeitungen, Printmedien, Online-Medien, Internet, Vernetzung, Medienkrise, Finanzierungsmodelle, Online-Strategien, Marktstrukturen, Medienwandel.
Welche These wird im Dokument diskutiert?
Die These von Wolfgang Riepl, dass neue Medien bestehende nicht vollständig ersetzen, sondern das Nutzungsverhalten verändern, wird im Dokument erwähnt.
Welche Herausforderungen für Verlage werden angesprochen?
Das Dokument thematisiert die Herausforderungen für Verlage durch das Aufkommen des Internets und die Notwendigkeit wirtschaftlich tragfähiger Online-Konzepte.
Wie werden die Online-Strategien der Verlage analysiert?
Die Analyse der Online-Strategien umfasst die Untersuchung verschiedener Ansätze zur Online-Finanzierung und die Entwicklung der Marktstrukturen im digitalen Raum, von kostenpflichtigen Modellen bis hin zu werbefinanzierten Plattformen.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und die zentrale Forschungsfrage stellt. Es folgen Kapitel, die das klassische Medium Zeitung und die neuen Online-Medien detailliert untersuchen. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
- Quote paper
- Thomas Huse (Author), 2009, Die Vernetzung von Print- und Online-Medien am Beispiel der deutschen Tageszeitungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147071