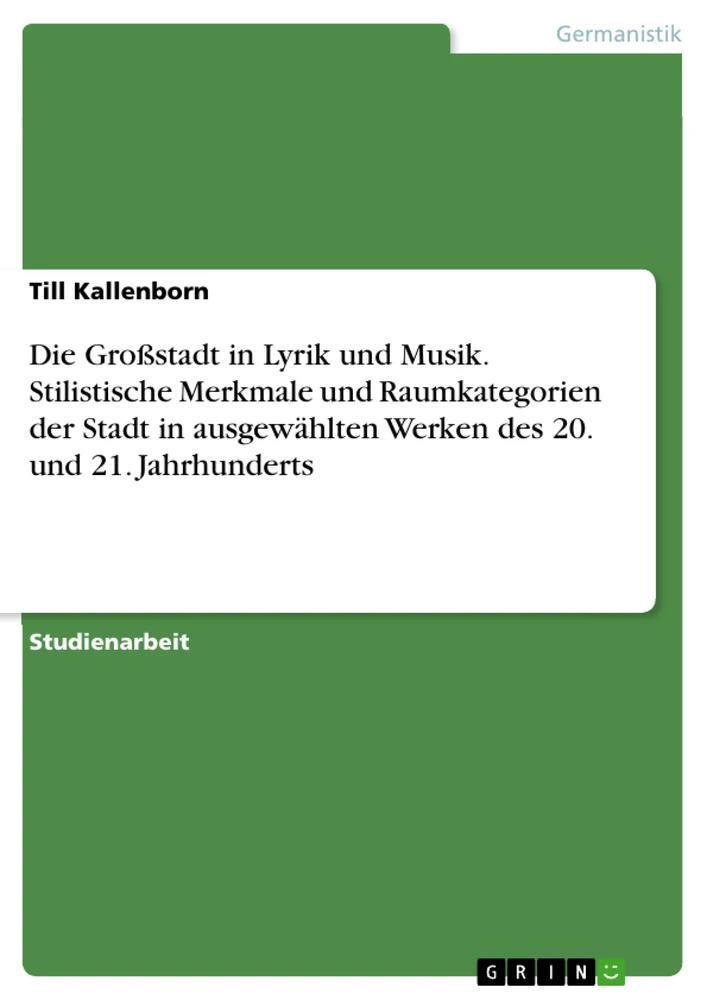Ich werde in dieser Arbeit Merkmale herausarbeiten, die sich in einer Auswahl von Gedichten und Liedtexten wiederfinden lassen und dabei untersuchen, ob sich erkennbare Muster finden lassen. Außerdem werde ich auf die Thematik der Raumtheorien eingehen und das spezielle von Konzept von Henri Lefebvre erklären und anwenden. Beginnen werde ich mit einer Auswahl von jeweils zwei Gedichten und Songs, die ich mir genauer anschaue und analysiere. Daraufhin folgt nochmals je ein Werk, das sich speziell dem Thema Berlin widmet. Zum Schluss folgt das Fazit.
Die Stadt faszinierte in ihrer sozialen und räumlichen Beschaffenheit seit jeher ihre Einwohner*innen und Besucher*innen. Früher waren es vor allem Gedichte, die das Stadtleben literarisch beschrieben, heute sind es meist Liedtexte, die diese künstlerische Spiegelung übernehmen. Doch unabhängig vom Zeitpunkt der Entstehung oder der Darstellung in Lyrik oder Musik hat sich eine wichtige Differenzierung in der künstlerischen Darstellung der Städte nie geändert. Zu denken, alle Texte lobpreisen die Städte dieser Welt in einem ähnlichen Maße wie Sinatra es tut wäre eine absolute Fehlannahme. Die Stadt stand schon immer auch für negative Faktoren der Lebens- und Emotionswelt. Verschmutzung, Armut, Kriminalität, Einsamkeit und Abschottung gehören zu jeder Stadt genauso dazu wie ihre schönen Parks und Einkaufsstraßen. Als der gesellschaftliche Durchschnitt vor einigen Jahren noch durchweg verarmt war, war die Stadt ein Sammelbecken für Menschen, die meist weder Geld, noch Unterkunft besaßen. Heute ist das globalisierte Bild der allermeisten Städte natürlich aufgehübscht worden und die Mittelschicht ist viel wohlhabender als früher, dennoch sind die negativen Motive nie aus den Städten und somit auch nicht aus den Gedichten und Liedern entschwunden. Somit stellt die Stadt als räumliche Gegebenheit eine Dialektik dar, die sehr interessant und spannend zu untersuchen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Großstadt in Lyrik und Musik
- 3. Raumtheorien
- 3.2 Die Stadt als eigene Raumkategorie
- 4. Analytischer Teil
- 4.1 Lyrik
- 4.2 Musik
- 4.3 Das Beispiel Berlin
- 5. Anwendung der Raumtheorie
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Großstadt in Lyrik und Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Ziel ist es, stilistische Merkmale und Raumkategorien der Stadt in ausgewählten Werken zu analysieren und wiederkehrende Muster aufzuzeigen. Dabei wird die Raumtheorie von Henri Lefebvre angewendet.
- Stilistische Merkmale der Großstadt in Lyrik und Musik
- Raumkategorien der Stadt als kultureller Bedeutungsträger
- Anwendung der Raumtheorie von Henri Lefebvre
- Analyse ausgewählter Gedichte und Lieder
- Die Stadt Berlin als Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit dem bekannten Sinatra-Song "New York, New York" als Einstieg in die Thematik der Großstadt in Kunst und Kultur. Sie stellt die Faszination und die ambivalente Darstellung der Stadt heraus: positive Aspekte wie Urbanität und Schnelllebigkeit stehen im Kontrast zu negativen Aspekten wie Armut, Kriminalität und Einsamkeit. Die Arbeit kündigt die Analyse stilistischer Merkmale in Gedichten und Liedern sowie die Anwendung der Raumtheorie von Henri Lefebvre an.
2. Die Großstadt in Lyrik und Musik: Dieses Kapitel diskutiert die Rolle der Großstadt als Inspiration für Künstler. Im Gegensatz zur romantisierten Natur wird die Stadt als Gegenbild mit Merkmalen wie Angst, Einsamkeit und Anonymität dargestellt. Es werden Fragen zur Definition von „Großstadtlyrik“ aufgeworfen, und die besonderen Bedeutungen von Städten wie New York, London, Rom, Paris und insbesondere Berlin als häufiges Motiv werden erläutert. Berlins besondere Bedeutung aufgrund seiner wechselvollen politischen Geschichte wird hervorgehoben.
3. Raumtheorien: Das Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Darstellung von Raum in der Literatur und stellt verschiedene theoretische Ansätze zur Konzeptualisierung von Raum vor. Es wird der „spatial turn“ als Paradigmenwechsel in den Sozialwissenschaften erwähnt, der den Raum als kulturelle Größe neben der Zeit hervorhebt. Der Fokus liegt auf der kulturellen Bedeutung von Raum, und wie Normen, Vorstellungen von Zentralität und Marginalität sowie individuelle Erfahrungen im Raum manifestiert werden.
4. Analytischer Teil: Dieser Abschnitt kündigt die detaillierte Analyse ausgewählter Gedichte und Lieder an, gefolgt von einer Fallstudie zu Berlin. Die methodische Vorgehensweise wird hier nur angedeutet, der Schwerpunkt liegt auf der Ankündigung der folgenden Analysen.
5. Anwendung der Raumtheorie: Dieses Kapitel beschreibt die Anwendung der Raumtheorie auf die zuvor analysierten Werke. Es wird erwartet, dass hier die theoretischen Überlegungen des Kapitels 3 mit den konkreten Beispielen der Kapitel 4 verknüpft werden. Nähere Einzelheiten fehlen jedoch in der vorliegenden Textpassage.
Schlüsselwörter
Großstadtlyrik, Großstadtmusik, Raumtheorie, Henri Lefebvre, Urbanisierung, Stilmerkmale, Raumkategorien, Berlin, 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, Stadtlandschaft, Ambivalenz, Anonymität, Entfremdung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Großstadt in Lyrik und Musik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Großstadt in Lyrik und Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Sie analysiert stilistische Merkmale und Raumkategorien der Stadt in ausgewählten Werken und zeigt wiederkehrende Muster auf. Dabei wird die Raumtheorie von Henri Lefebvre angewendet.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, stilistische Merkmale der Großstadt in Lyrik und Musik zu identifizieren, Raumkategorien der Stadt als kulturelle Bedeutungsträger zu untersuchen, die Raumtheorie von Henri Lefebvre anzuwenden, ausgewählte Gedichte und Lieder zu analysieren und die Stadt Berlin als Fallbeispiel zu betrachten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die stilistischen Merkmale der Großstadt in Lyrik und Musik, die Raumkategorien der Stadt als kulturelle Bedeutungsträger, die Anwendung der Raumtheorie von Henri Lefebvre, die Analyse ausgewählter Gedichte und Lieder sowie Berlin als Fallbeispiel. Die ambivalente Darstellung der Stadt – zwischen Faszination und negativen Aspekten wie Armut und Einsamkeit – spielt eine zentrale Rolle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Die Großstadt in Lyrik und Musik, Raumtheorien, Analytischer Teil, Anwendung der Raumtheorie und Fazit. Die Einleitung verwendet "New York, New York" von Sinatra als Einstieg. Kapitel 2 diskutiert die Großstadt als künstlerische Inspiration. Kapitel 3 befasst sich mit Raumtheorien, insbesondere dem "spatial turn". Kapitel 4 kündigt die detaillierte Analyse an. Kapitel 5 verbindet Theorie und Analyse. Das Fazit wird in der Zusammenfassung nicht detailliert beschrieben.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit wendet die Raumtheorie von Henri Lefebvre an und analysiert stilistische Merkmale in ausgewählten Gedichten und Liedern. Die genaue methodische Vorgehensweise wird im Text nur angedeutet, der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Ergebnisse.
Welche Rolle spielt Berlin in der Arbeit?
Berlin dient als Fallbeispiel und wird aufgrund seiner wechselvollen politischen Geschichte besonders hervorgehoben. Die Arbeit erläutert Berlins besondere Bedeutung als häufiges Motiv in der Großstadtlyrik und -musik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Großstadtlyrik, Großstadtmusik, Raumtheorie, Henri Lefebvre, Urbanisierung, Stilmerkmale, Raumkategorien, Berlin, 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, Stadtlandschaft, Ambivalenz, Anonymität, Entfremdung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit ist für den akademischen Gebrauch bestimmt und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Weise. Die OCR-Daten wurden von einem Verlag bereitgestellt.
- Citar trabajo
- Till Kallenborn (Autor), 2023, Die Großstadt in Lyrik und Musik. Stilistische Merkmale und Raumkategorien der Stadt in ausgewählten Werken des 20. und 21. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1467354