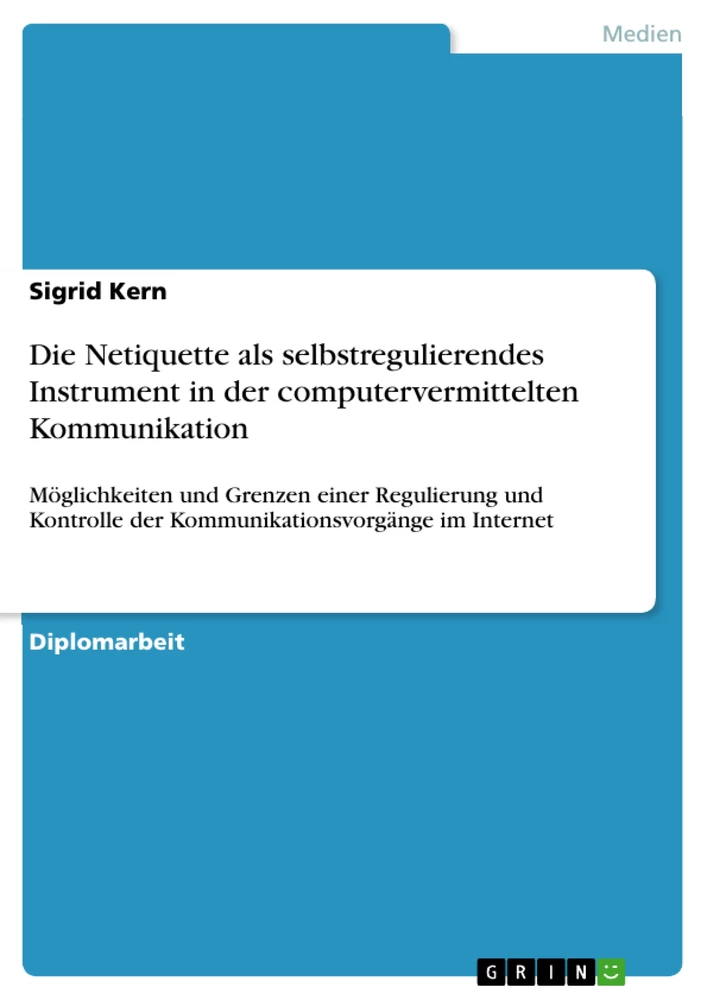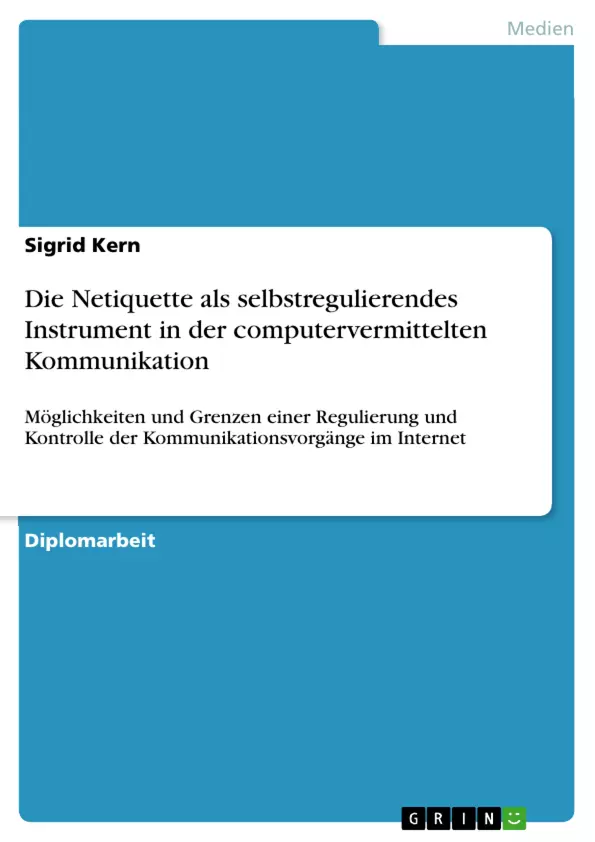EINLEITUNG
Ziele der theoretischen Überlegungen
Das Internet spielt als relativ neues Kommunikationsmedium eine immer größere Rolle im weltweiten Austausch von digitalen Informationen. Immer häufiger läuft der gesamte Kommunikations-prozess zwischen zwei und mehreren Individuen gänzlich über
Anwendungen des Internet ab.
Für eine optimale Gestaltung der Kommunikationsabläufe im Internet, gleichgültig, ob es sich dabei lediglich um private, virtuelle Unterhaltungen in der Freizeitgestaltung oder aber um geschäftliche Kommunikationstätigkeiten im Rahmen von z.B. PR- oder
Werbeaktionen für ein Unternehmen handelt, ist es notwendig, sich mit den Regeln auseinander zu setzen, welche die Kommunikation im Netzwerk Internet bestimmen.
Nur auf diese Weise lässt sich die zwischenmenschliche Kommunikation optimieren und die gewünschten (Kommunikations-)Ziele (z.B. Verständigung, Unterhaltung, Profitmaximierung, usw...) erreichen.
Kommunikation verläuft generell immer nach bestimmten Regeln und ohne das Wissen um diese Regeln ist es nicht möglich, einen erfolgreichen Austausch von Informationen zu gewährleisten. Für jedes neue Medium entstehen in der Kommunikationspraxis
medienspezifische Regeln und Verhaltensvorschreibungen, die nach einer Optimierung der Kommunikationsabläufe streben. Diese Regeln, die anfangs explizit gemacht werden müssen, wenn das Medium noch relativ neu und ungewohnt für seine Nutzer ist, werden später in sozialen Prozessen normiert und verinnerlicht. Internalisierte
Verhaltensnormen haben das Ziel Verständigungsprobleme und andere Konflikte in der Kommunikation, die durch die Beschaffenheit des Mediums auftreten können, im Vorfeld auszuschließen.
Das Internet bietet seinen Anwendern sehr vielfältige Möglichkeiten Kommunikation zu betreiben. Von einem einfachen Austausch von elektronischen Nachrichten (E-Mail) bis hin zu komplexeren Konferenzsystemen (Mailing Lists, Newsgroups) und virtuellen
„Plauderecken“ (Chatrooms), ist im weltweiten Netz alles möglich. Gerade die Vielfältigkeit der Kommunikationsmöglichkeiten und die Tatsache, dass es keine geographische Begrenzung für sie gibt, macht es sehr wichtig, die strukturgebenden Regeln der Internet-Kommunikation zu kennen und zu verstehen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Ziele der theoretischen Überlegungen...
- Zum Aufbau der Arbeit..
- Ziele der empirischen Datenerhebung, Untersuchungsgegenstände…......
- THEORETISCHER TEIL
- 1. DIE TECHNISCHE STRUKTUR DES NETZWERKS INTERNET
- 1.1. Netzwerk Internet - eine Vielzahl von lokalen Netzwerken in einem globalen Metanetzwerk.....
- 1.2. Vom ARPANET zum WWW - zur Geschichte des Internet.
- 1.3. Zentrale Administration im Metanetzwerk Internet - Adressenzuordnung der Rechner, IP-Adresse und Domain Name
- 1.4. Asynchrone Kommunikationsanwendungen im Internet..
- 1.4.1. E-Mail - die älteste Kommunikationsanwendung.....
- 1.4.2. Das Usenet – eine Vielzahl von Nachrichtenforen, Newsgroups..............
- 1.4.2.1. Die Struktur des Usenet....
- 1.4.2.2. Moderierte und unmoderierte Diskussionsgruppen.
- 1.5. Die Auswirkungen der technischen Struktur auf die Möglichkeiten und Grenzen einer Regulierung und Kontrolle der Online-Kommunikation......
- 1.5.1. Die paketvermittelte Kommunikation
- 1.5.2. Der Zugang zur Kryptografie und zu anonymisierenden Werkzeugen.....
- 1.5.3. Die dezentrale Organisation.….…………………………..\n
- 2. DIE SOZIALE STRUKTUR DES GLOBALEN NETZWERKES INTERNET -,,VIRTUELLE GEMEINSCHAFTEN\"?
- 2.1. Die Akteure im Internet
- 2.1.1. Die Typologie von Internetnutzern nach Döring (1999b)..
- 2.1.1.1. Newbie und Oldbie – Neulinge treffen auf bereits Dagewesene.......
- 2.1.1.2. Lurker und Poster - passives und aktives Kommunikationsverhalten..
- 2.1.1.3. Light User und Heavy User - vom Gelegenheitsnutzer zum Computerfreak........
- 2.1.2. Institutionen und Vereinigungen...
- 2.1.2.1. Normative Organisationen: Die Internet Society (ISOC), die Electronic Frontier Foundation (EFF) und die Cyberangels......
- 2.1.2.2. Administrative Organisationen: Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) - eine Regierung für das Internet?...
- 2.2. Virtuelle Gemeinschaften........
- 2.2.1. Definitionen von virtuellen Gemeinschaften......
- 2.2.2. Kritik am virtuellen Gemeinschaftsbegriff – sind „Virtual Communities” Mythos oder Realität? ......
- 3. WESEN UND EIGENSCHAFTEN DER COMPUTERVERMITTELTEN KOMMUNIKATION
- 3.1. Theorien zur computervermittelten Kommunikation .
- 3.1.1. Die Theorie der Kanalreduktion - Verarmung und Entleerung der Kommunikation .....
- 3.1.2. Informationsverlust durch das Fehlen sozialer Hinweisreize
- 3.1.3. Neue soziale Fertigkeiten – soziale Informationsverarbeitung..
- 3.1.4. Andere Theorien.
- 3.2. Formen des expressiven Ausdrucks in der CMC - „schriftlich sprechen\".
- 3.2.1. Emoticons
- 3.2.2. Akronyme.
- 3.2.3. Disclaimer...
- 3.2.4. Aktionswörter, Soundwörter.……….……………....
- 4. SOZIALE KONFLIKTE IN VIRTUELLEN GRUPPEN
- 4.1. CMC-bedingte Konflikte ....
- Die technische Struktur des Internet und ihre Auswirkungen auf die Regulierung und Kontrolle
- Die soziale Struktur des Internets, insbesondere die Rolle von virtuellen Gemeinschaften
- Die Besonderheiten der computervermittelten Kommunikation und ihre Auswirkungen auf soziale Konflikte
- Die Funktionsweise der Netiquette als selbstregulierendes Instrument
- Die Möglichkeiten und Grenzen der Netiquette zur Regulierung und Kontrolle von Kommunikation im Internet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Netiquette als selbstregulierendes Instrument in der computervermittelten Kommunikation. Sie beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen einer Regulierung und Kontrolle der Kommunikationsvorgänge im Internet durch Mechanismen aus dem rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt die Ziele der theoretischen Überlegungen und den Aufbau der Arbeit dar. Sie erläutert auch die Ziele der empirischen Datenerhebung und die Untersuchungsgegenstände.
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der technischen Struktur des Netzwerks Internet. Es werden die Geschichte des Internets, die zentrale Administration, die asynchronen Kommunikationsanwendungen und die Auswirkungen der technischen Struktur auf die Regulierung und Kontrolle der Online-Kommunikation behandelt.
Der zweite Teil untersucht die soziale Struktur des globalen Netzwerks Internet. Er befasst sich mit den Akteuren im Internet, der Typologie von Internetnutzern und dem Konzept der virtuellen Gemeinschaften. Kritische Aspekte des Begriffs "virtuelle Gemeinschaft" werden ebenfalls beleuchtet.
Der dritte Teil widmet sich dem Wesen und den Eigenschaften der computervermittelten Kommunikation. Verschiedene Theorien zur computervermittelten Kommunikation werden vorgestellt und die Formen des expressiven Ausdrucks in der CMC analysiert.
Der vierte Teil der Arbeit befasst sich mit sozialen Konflikten in virtuellen Gruppen. Es werden CMC-bedingte Konflikte und deren Ursachen erörtert.
Schlüsselwörter
Netiquette, computervermittelte Kommunikation, Internet, soziale Struktur, virtuelle Gemeinschaften, Regulierung, Kontrolle, Konflikte, Online-Kommunikation, technische Struktur, Kommunikationsanwendungen, Emoticons, Akronyme, Disclaimer, Aktionswörter, Soundwörter.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Netiquette?
Die Netiquette bezeichnet Verhaltensregeln und Normen für eine höfliche und effiziente Kommunikation im Internet, die Verständigungsprobleme minimieren sollen.
Warum ist die Netiquette für Unternehmen wichtig?
In der geschäftlichen Kommunikation (z.B. PR oder Werbung) hilft das Einhalten dieser Regeln, Kommunikationsziele wie Profitmaximierung und Kundenbindung besser zu erreichen.
Welche Arten von Internetnutzern werden unterschieden?
Die Arbeit nutzt eine Typologie nach Döring, die Nutzer in Kategorien wie Newbies/Oldbies, Lurker (Passive) / Poster (Aktive) sowie Light/Heavy User unterteilt.
Wie beeinflusst die technische Struktur des Internets die Regulierung?
Die dezentrale Organisation und paketvermittelte Kommunikation erschweren eine zentrale Kontrolle, weshalb selbstregulierende Instrumente wie die Netiquette entscheidend sind.
Was sind Emoticons und Akronyme in der CMC?
Es sind Formen des expressiven Ausdrucks in der computervermittelten Kommunikation (CMC), die fehlende soziale Hinweisreize wie Mimik oder Gestik ersetzen sollen.
Gibt es Kritik am Begriff der "virtuellen Gemeinschaft"?
Ja, die Arbeit diskutiert kritisch, ob virtuelle Gemeinschaften echte soziale Gefüge sind oder lediglich ein Mythos, der durch die Beschaffenheit des Mediums entsteht.
- Quote paper
- Mag. Sigrid Kern (Author), 2001, Die Netiquette als selbstregulierendes Instrument in der computervermittelten Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1465