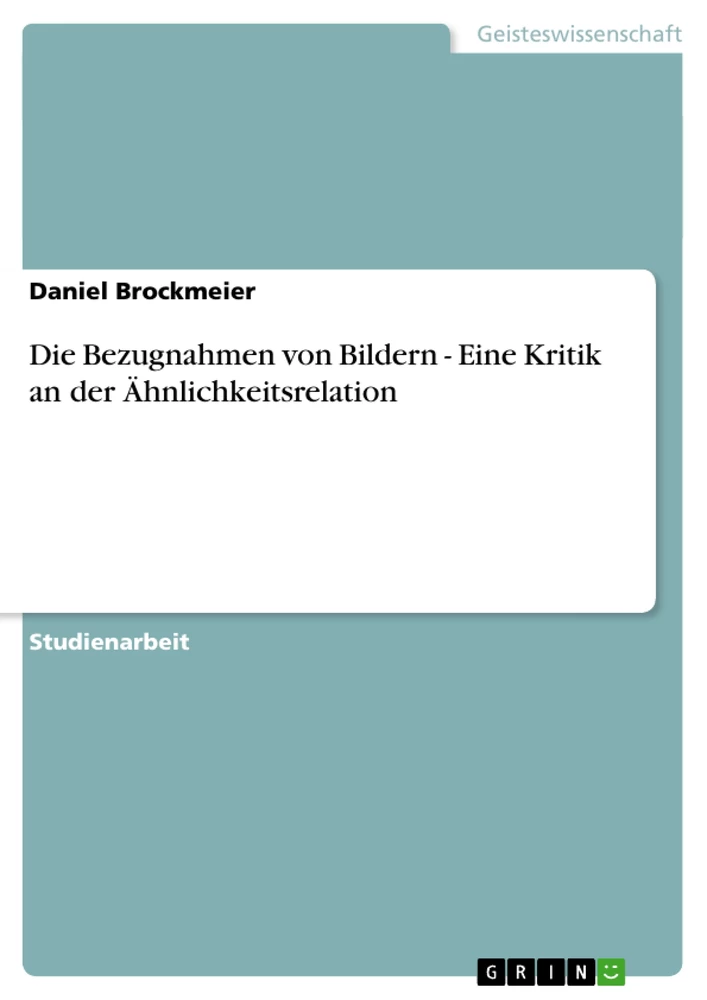In der Hausarbeit wird die Ähnlichkeitstheorie des Bildes einer kritischen Prüfung unterzogen. Zunächst wird untersucht, auf welche Art von Bildern sich der Ähnlichkeitsbegriff sinnvoll anwenden läßt. Daran anschließend werden die drei folgenden Fragen diskutiert:
Was macht ein Bild zum Bild? Wie wird der Referent eines Bildes festgelegt? Und worin besteht der Unterschied zwischen pikturaler Repräsentation und verbaler Beschreibung?
Ich beginne mit einer Untersuchung, ob Ähnlichkeit etwas dazu beitragen kann, bildliche von sprachlichen Zeichen zu unterscheiden, indem ich das Argument der semantischen Anomalie des Bildes prüfe. Im nächsten Schritt wird analysiert, ob Ähnlichkeit ein Kriterium an die Hand gibt, zu entscheiden, was ein Bild zum Bild macht, ob sie dafür notwendige oder hinreichende Bedingung sein kann. Als letzte der oben genannten Fragen wird aufgegriffen, ob Ähnlichkeit dazu beiträgt, den Referenten eines Bildes festzulegen. Am Ende dieser Hausarbeit wird dann im Fazit kurz Nelson Goodmans alternative Theorie der Bezugnahme vor- und der Ähnlichkeitstheorie gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes
- Die Ähnlichkeitstheorie
- Muß Bilderlesen gelernt werden?
- Das logische Argument
- Ähnlichkeit als notwendige Bedingung
- Ähnlichkeit als hinreichende Bedingung
- Das transzendentale Argument
- Die Welt kopieren, wie sie ist...
- Das unschuldige Auge
- Einhörner und Käfer in Schachteln
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Kritik an der Ähnlichkeitsrelation als Grundlage der bildlichen Bezugnahme, wie sie von Nelson Goodman in seinen „Sprachen der Kunst“ formuliert wird. Der Fokus liegt darauf, zu untersuchen, ob die Ähnlichkeitstheorie die Beziehung zwischen Bild und Abgebildetem hinreichend erklärt und ob sie ein geeignetes Kriterium für die Unterscheidung zwischen bildlicher und sprachlicher Darstellung bietet.
- Kritik an der Ähnlichkeitstheorie als Grundlage der bildlichen Bezugnahme
- Analyse der Funktion von Ähnlichkeit bei der Bildinterpretation
- Untersuchung, ob die Ähnlichkeitstheorie für die Unterscheidung zwischen bildlicher und sprachlicher Darstellung hilfreich ist
- Einleitung in Goodmans alternative Theorie der Bezugnahme
- Vergleich der Ähnlichkeitstheorie mit anderen Theorien der bildlichen Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Hintergrund des Themas dar und führt in die Problematik der bildlichen Bezugnahme ein. Sie präsentiert die Position der Ähnlichkeitstheorie und stellt Goodmans Kritik daran vor.
- Das zweite Kapitel definiert den Gegenstand der Untersuchung und grenzt ihn von anderen Arten von Bildern ab. Es werden die Grenzen des Begriffs „Bild“ und „Ähnlichkeit“ im Kontext der Analyse festgelegt.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit der Ähnlichkeitstheorie und untersucht, ob sie ein geeignetes Kriterium für die Unterscheidung zwischen bildlicher und sprachlicher Darstellung bietet. Es analysiert das Argument der semantischen Anomalie des Bildes.
- Das vierte Kapitel diskutiert, ob Ähnlichkeit ein notwendiges oder hinreichendes Kriterium dafür ist, was ein Bild zum Bild macht. Es untersucht, ob Ähnlichkeit zur Festlegung des Referenten eines Bildes beitragen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Schlüsselbegriffen wie Ähnlichkeit, Bild, Bezugnahme, Repräsentation, Denotation, Symbol, Exemplifikation, semantische Anomalie, Bildtheorie, und Goodmans Theorie der Bezugnahme.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Ähnlichkeitstheorie des Bildes?
Sie geht davon aus, dass ein Bild deshalb etwas Bestimmtes darstellt, weil es dem Abgebildeten ähnlich sieht.
Warum kritisiert Nelson Goodman den Ähnlichkeitsbegriff?
Goodman argumentiert, dass Ähnlichkeit weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung für Repräsentation ist; ein Bild muss vielmehr als Symbol gelesen werden.
Was ist das Argument des „unschuldigen Auges“?
Goodman widerlegt die Idee, dass wir die Welt objektiv „kopieren“ können; Wahrnehmung ist immer durch Vorwissen und kulturelle Codes geprägt.
Muss man „Bilderlesen“ erst lernen?
Ja, laut Goodman ist die pikturale Repräsentation ein Symbolsystem, dessen Regeln und Konventionen man beherrschen muss, ähnlich wie eine Sprache.
Was ist der Unterschied zwischen pikturaler Repräsentation und verbaler Beschreibung?
Die Arbeit untersucht die semantischen Unterschiede und wie der Referent (das Bezeichnete) in beiden Systemen unterschiedlich festgelegt wird.
- Arbeit zitieren
- Daniel Brockmeier (Autor:in), 2006, Die Bezugnahmen von Bildern - Eine Kritik an der Ähnlichkeitsrelation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146504